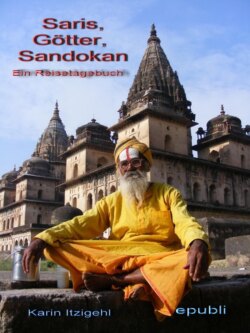Читать книгу Saris, Götter, Sandokan - Ein Reisetagebuch - Karin Itzigehl - Страница 7
2. Tag – 17. Oktober 2011 - Mandawa
ОглавлениеUm halb sieben macht der Wecker Krach. Ich hatte kaum geschlafen, mein Reisebegleiter hatte geschnarcht, und zusammen mit der lauten Klimaanlage war das nicht zum Aushalten. Deshalb schlief ich sofort wieder ein, und als wir beide merkten, dass wir verschlafen haben, war dann aber Tempo angesagt. Um 8 Uhr Frühstück – ich esse hier und fortan immer Toast mit Marmelade, Husni Rührei mit Kräutern und Gewürzen und Fladenbrot - und los geht es nach Mandawa. Aber nicht so schnell, noch lange fahren wir durch Delhi und begreifen die riesige Metropole, die 16,3 Millionen Menschen hat. Wir kommen zu einer Mautstelle. Sie sind wie bei uns, aber dahinter gibt es keine Fahrbahnmarkierungen. Auf der riesigen Fläche fahren alle schnell wie die Irren und kreuz und quer, und beinah hätte uns ein Militärfahrzeug gestreift, aber unser Fahrer Suresh ist ein wahres Genie. Er hat es kommen sehen und wich rechtzeitig aus. Das heißt nicht, dass Fahrbahnmarkierungen in Indien irgendjemanden dazu veranlassen, brav in der Spur zu fahren. Suresh bemerkt lächelnd, sie seien nur Dekoration. Der 38-Jährige fährt seit 20 Jahren Touristen durch Nordindien, vor allem durch Rajasthan, das größte Bundesland. Seine Familie – Frau, Sohn und drei Töchter - wohnt in Jaipur, der Hauptstadt Rajasthans. Er verrät uns, dass er umgerechnet 50 Euro pro Monat verdient, allerdings nur in den Saisonmonaten. Während des Monsuns – Juni bis September – kommt kaum ein Tourist. Dann ist er arbeitslos, und seine Familie lebt von den Trinkgeldern, die er von den Touristen während der Touren bekommt. Es kommen jetzt auch noch kleine Mautstellen, die uns ein bisschen mafiös erscheinen, Preise sind per Hand an die Butze geschrieben, und nachdem wir bezahlt haben, lässt ein gelangweilt wirkender Mann eine Strippe locker, und der Schlagbaum hebt sich. Wir amüsieren uns. Suresh erklärt, dass das kommunale Mautstellen sind. Wenn die Regierung kein Geld gibt oder sich damit Zeit lässt, bezahlen die beiden Dörfer die Straße in ihrer Mitte selbst und holen sich so das Geld wieder rein. Ein paar Dörfer weiter wird die Straße wieder schlechter. Suresh manövriert uns geschickt um Schlaglöcher herum. Manchmal müssen die Fahrzeuge auf die Ränder ausweichen, wenn sie sich begegnen. Wir fahren durch Dörfer. Am Straßenrand sind Geschäfte für Elektronik, Stände für Gemüse oder für die hier so heiß geliebten Chips in allen Varianten, dann wieder Reparaturwerkstätten für Motorräder, von denen viele in Indien fahren. Manche Geschäfte sind massiv aus Stein, andere sind Container. Neben offenen Garküchen, die einen Duft von herzhaften, mit Kräutern und Gewürzen versehenen Speisen verströmen, lungern heilige Kühe oder Ziegen. Sie wühlen im herumliegenden, manchmal muffig stinkenden Müll an den Straßenseiten und vor den Geschäften und finden immer etwas. Schöne Häuser und Tempel stehen zwischen Ruinen. Frauen mit Saris sitzen seitlich auf den Rücksitzen der Motorräder, der Stoff hängt sonst wo, ganz schön gefährlich. Wir mittendrin, fotografieren aus dem langsam fahrenden Auto, steigen auch mal aus, tauchen ein in diese völlig andere Welt und lassen uns viel Zeit, dem Treiben zuzuschauen. Indien ist kein Land, das ist ein Lebensgefühl. Entweder man ist bereit, sich darauf einzulassen oder nicht. Wir sind es beide. All den Müll und Dreck, die Armut und Unzulänglichkeiten kann ich mir natürlich auch nicht schön gucken. Aber ich wusste das vorher und wollte es ja auch mit eigenen Augen sehen, spüren, riechen. Aus dem Blickwinkel von Europäern sieht das arm aus, aber würde man einen Inder fragen, der würde das differenzieren und die Menschen einteilen in ein breites Spektrum von arm über mehr oder weniger vernünftig verdienend bis reich. Die so genannte zivilisierte Welt muss immer alles nach ihren Maßstäben bewerten und beurteilen. Aber in anderen Ländern lebt man eben anders. Während ich das Treiben auf der Straße beobachte und mir dies alles durch den Sinn geht, fällt mir ein Disput aus meiner Lieblingsserie „Sandokan, der Tiger von Malaysia“ ein. Sie spielt während der englischen Kolonialherrschaft, und Marianna streitet mit ihrem Onkel, einem hohen Repräsentanten der Ostindien-Company, die die Menschen dort wirtschaftlich ausbeutet. Der Onkel prahlt mit stolz geschwellter Brust, dass die Engländer den Malayen ihre Zivilisation und Kultur gebracht haben. Marianna entgegnet: „Aber sie wollen sie gar nicht. Sie haben ihre eigene.“ Genauso ist es hier. Ich denke, wir müssen keiner Nation sagen, wie sie leben soll. Sie kann sich von uns etwas abgucken, wenn sie will, aber für manche Verhaltensweisen haben die Inder auch ihre Gründe, die manchmal religiöser oder traditioneller Art sind, zum Beispiel hat die linke Hand nichts auf dem Ess-Tisch zu suchen, weil sie unrein ist. Die Inder schütteln die Köpfe über uns, weil wir uns mit Papier den Po abwischen. Danach kann der Po unmöglich sauber sein, sagen sie. Sie waschen sich nach dem Geschäft mit Wasser und der linken Hand ab und nur das akzeptieren sie als sauber. Eine andere Welt eben. Nach sechs Stunden Autofahrt, in der ich mein Netbook auf dem Schoß habe und Tagebuch führe, kommen wir am Nachmittag in Mandawa an. Dieser Ort ist nur klein, hat 21.000 Einwohner, aber er ist etwas Besonderes. Hier gibt es 92 Havelis. Das sind Kaufmannshäuser, die kunstvoll mit Naturfarben bemalt sind, mit floralen Ornamenten, in den Innenhöfen auch immer wieder mit Göttern oder Elefanten, die in Indien Glückssymbole sind. Für manche Häuser wurden auch Materialien importiert, zum Beispiel Glas aus Belgien. Türen sind aus kostbarem Teakholz geschnitzt. Ein Besitzer hat angefangen, mit Zitronensaft das Holz wieder hell zu kriegen, erzählt unser Stadtführer Hanif. Wir wohnen auch in so einem restaurierten Haveli, aus dem ein Hotel gemacht wurde wie in vielen anderen Städten in Rajasthan auch, wie wir später erleben. Mandawa liegt an der Seidenstraße. Jahrhunderte lang lebte diese Stadt vom Handel – bis zur Unabhängigkeit 1947. Dann zogen die Händler fort, die Havelis verfielen. Erst jetzt findet eines nach dem anderen einen Käufer. Einige sind schon fertig, andere werden gerade restauriert, und viele warten noch auf Käufer. Auf dem Rundgang durch Mandawa verfolgt uns eine Frau mit Kind und bettelt uns unablässig und laut an. In größerem Abstand stehen zwei andere Frauen, Kinder wuseln immer wieder um uns herum und wünschen sich Süßigkeiten oder Kosmetik. Ich habe einen ganzen Beutel Kleinkram mit, aber leider im Hotel. Kindern Geld zu geben wäre der größte Fehler, den man machen kann, sagt Hanif, und das hatte ich auch schon gelesen und im Fernsehen gesehen. Wenn andere sehen, dass man einem etwas gibt, dann hat man plötzlich eine ganze Schar um sich. Für die Frau habe ich leider nichts, den einzigen kleinen Schein, den ich hatte, habe ich im Hotel den Kofferträgern gegeben. Wir müssen uns angewöhnen, immer Kleingeld zu haben, nehme ich mir vor. Husni gibt ihr Geld in einem Augenblick, wo es niemand sieht. Frauen im Sari führen ihre Kühe nach Hause. Wir lernen, dass das alles Ochsen sind, die frei herumlaufen. Die Kühe sind zu Hause und sind für die Milchproduktion zuständig. Deswegen bleiben sie trotzdem heilig. Hanif nimmt uns am Ende seiner Führung mit ins Geschäft seines Onkels, der eine Produktvorführung vom Feinsten zelebriert. Aber wir bleiben standhaft, brauchen seine Patchwork-Decken nicht. Sie sind teuer, und ich wüsste nicht, wem ich das schenken könnte. Ich brauche keine. Aber in der Unterhaltung erfährt er, dass ich gern Kabir Bedi treffen würde, und er kennt und schätzt ihn. Dann eilen wir ins Hotelzimmer, machen uns kurz frisch und gehen essen. Das üppige Büfett bietet allerlei wirklich Leckeres: gebratene Nudeln, Tomatenreis, Hühnchen in toller, scharf-würziger Soße, Pastete aus Gemüse und Reis mit allerlei Gewürzen, dazu trinke ich zwei verschiedene Säfte, einmal Mangosaft pur, einmal ein Mix aus Mango und Ananas. Die versprochene Musikveranstaltung zum Dinner entpuppt sich als ein altes Paar in traditioneller Kleidung, das zwei Lieder darbietet. Der Mann spielt ein Instrument, die Frau kassiert an den Tischen. Als Husni bezahlt, werden aus den versprochenen 700 Rupees für jeden 1000 Rupees. Das ist teuer, fast 16 Euro. Dass das Abzocke ist, ahnen wir, aber wir wissen noch nicht, dass normale Restaurantpreise nur halb so hoch sind. In der Zwischenzeit sind Handy und Netbook aufgeladen, ich lasse alle Fotos ins Netbook laufen, dann bade ich genüsslich. Im Bad funktioniert mein Stecker vom Fön auch ohne Adapter. Darauf kann man sich aber nicht verlassen. Meistens brauchen wir unseren Weltstecker. Ich staune, wie gut ich das Klima vertrage: kein Schwitzen, keine Kopfschmerzen. Wir gewöhnen uns an, jeden Abend Kasse zu machen. Mal hat der eine die Kofferträger mit Trinkgeld beglückt, mal der andere, das Abendessen, Tuktuk-Fahrer, Schuh-Aufpasser bezahlt, und vieles mehr fällt über den Tag verteilt an. Das wird dann abends auseinander klamüsert, und danach sehen wir, wie viel Geld wir noch in bar haben und wann das nächste Geldabholen fällig ist. Wir machen die Klimaanlage aus und schalten den Ventilator an in der Hoffnung, dass wir besser schlafen können.
09 - Straßenszene in Mandawa mit Friseur
10 - Ein Haveli während der Restaurierung, Elefanten als Glückssymbole
11 - Ein restauriertes Haveli (Kaufmannshaus)
12 - Ein kunstvoll bemaltes Haveli von Innen