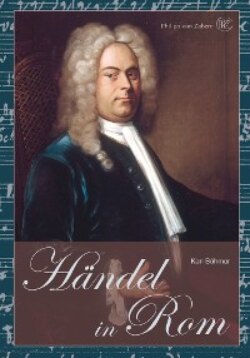Читать книгу Händel in Rom - Karl Böhmer - Страница 10
Römische Straßen
ОглавлениеDrei berühmte Straßen führen von der Piazza del Popolo ins Stadtzentrum (Abb. 3), alle drei sollten Händel zu Höhepunkten seiner römischen Karriere geleiten.
Linker Hand gelangt man über die Via del Babuino zur Piazza di Spagna, die damals noch nicht von der sogenannten „Spanischen Treppe“ beherrscht wurde, die eigentlich ein französisches Bauwerk ist, und im Bannkreis der spanischen Botschaft lag – daher ihr Name. Dass Händel dem damals residierenden Botschafter Pacheco Tellez, Herzog d’Uçeda, zumindest vorgestellt wurde, belegt seine in Rom geschriebene spanische Kantate Nò, se emenderà jamas. Der diplomatische Status des Botschafters verwandelte die Piazza samt Via del Babuino nicht nur in einen politischen Asylbereich, sondern auch in einen illegalen Markt für zollfreie Waren19.
Rechter Hand führt die Via di Ripetta zum gleichnamigen Tiberhafen (Abb. 4). Im Gegensatz zur weiter flussabwärts gelegenen „Ripa grande“ hieß dieser stadtnahe Hafen das „kleine Ufer“, denn hier wurden nur kleinere Waren und Lebensmittel, Holz und Wein verladen. Papst Clemens XI. hatte die Ripetta gerade erst durch eine prachtvolle doppelläufige Treppenanlage zum Fluss hin pittoresk ausbauen lassen. Damit setzte er sich und seiner Familie, den Albani, ein Denkmal, erleichterte die Anlieferung der Waren ins Stadtzentrum und nahm ein dringendes Problem der römischen Stadtplanung in Angriff: die Befestigung der Ufer. An den sumpfigen Gestaden des Tibers wütete nämlich – allen idyllischen Schilderungen in Händels römischen Kantaten zum Trotz – zwischen Mai und Oktober das Fieber, das nur durch eine Befestigung der Ufer dauerhaft hätte eingedämmt werden können. Es war gerade diese Anlage des heutigen Lungotevere im 19. Jahrhundert, der die Ripetta Clemens’ XI. zum Opfer fiel. Heute zeugt von ihrer Herrlichkeit nur noch ein spärlicher Rest: jener Brunnen mit der Wappen-Impresa des Papstes – der Alba, dem Morgenstern –, der zu Händels Zeit noch im Zentrum der Brunnenanlage stand, während ihn heute mitten im tosenden Verkehrslärm niemand mehr beachtet. Im Mai 1707 sollte Händel an diesem Brunnen häufig vorbeikommen, denn im Collegio Clementino, dem Priesterseminar nebenan, studierte er sein erstes Oratorium Il Trionfo del Tempo ein. Nicht zufällig enthält dieses Werk ein Duett, das den strahlenden Morgenstern preist – jene „Alba“ oder „Aurora“, die mitten in der Hafenanlage unweit des Collegio den Ruhm des regierenden Papstes aus dem Hause Albani verkündete.
An der Via del Corso, der zentralen der drei Verkehrsachsen, die von der Piazza del Popolo ausgehen, sollte Händel die größten Triumphe seiner römischen Jahre feiern: In der Kirche S. Maria di Montesanto gleich links am Eingang zum Corso führte er im Juli 1707 seine Vespermusik für die Karmeliter auf. Im heutigen Palazzo Doria Pamphilj am unteren Ende der schnurgeraden Straße erlebte im Februar 1707 seine erste große Kantate Delirio amoroso ihre Uraufführung. Unweit der Piazza Venezia, in die der Corso mündet, fanden sich im April 1708 mehr als 1500 Römer ein, um im Palazzo Bonelli die glanzvollen Aufführungen seines Osteroratoriums La Resurrezione zu erleben.
Schon damals war der Corso Roms Lebensader und Flaniermeile, obwohl von Flanieren im heutigen Sinne nicht die Rede sein konnte: Auf der staubigen Straße gingen vornehme Römer nur dann zu Fuß, wenn es sich gar nicht vermeiden ließ. Ansonsten benutzten sie die Kutsche oder die Sänfte. Auf dem Corso herrschte der „Corso“ der Pferdekutschen, das Auf und Ab der Zwei-, Vier- oder Sechsspänner, deren Kutscher mitunter nicht weniger waghalsige Wendemanöver präsentierten als die römischen Autofahrer heute. Um fünf Uhr nachmittags setzte sich der Tross der Karossen in Richtung Piazza Venezia in Bewegung und absolvierte den täglichen Rundkurs über die Piazza SS. Apostoli und die Fontana di Trevi zurück zur Piazza del Popolo20. Händel konnte dieses Schauspiel nicht nur vom Palast seines Padrone aus verfolgen, sondern selbst mittun, denn er verfügte über eine eigene Kutsche und einen Diener. Damit erfüllte er die Grundanforderungen des vornehmen Lebens am Tiber, die bereits der Hl. Karl Borromäus auf eine einfache Formel brachte: Um in Rom Erfolg zu haben, brauche man nur zwei Dinge: Gottesliebe und eine Kutsche21.
Noch eines war um 1700 auf dem Corso anders als heute: Das aktuelle Straßenbild mit seinen einheitlichen hohen Fassaden stammt aus dem 19. Jahrhundert. Zu Händels Zeit grenzten hier noch die hohen, prachtvollen Travertinfassaden der Kirchen und Palazzi unmittelbar an niedrige, ärmliche Hauswände. Der Kontrast in Lebensstil und Bauweise war schreiend: „Dieses Disparate ist ein weit verbreiteter Fehler: hier Palazzi, dort Bruchbuden! Ein erhabenes Gebäude umgeben von hundert hässlichen Häusern“, bemerkte 1740 der Franzose Charles de Brosses22. Um 1700 zählte man in der Stadt mehrere Hundert Palazzi. Dort residierten die Kardinäle, Prälaten und Adelsfamilien in höchstem Luxus, während sich der Großteil der Bevölkerung mit den engen, staubigen Mietshäusern begnügen musste. Die Palazzi waren so verschwenderisch gebaut und sparsam bewohnt, dass man ganze Raumfluchten durchqueren konnte, ohne einer Menschenseele zu begegnen. Nebenan drängten sich die ärmeren Römerinnen und Römer auf engstem Raum zusammen.
Am härtesten hatte es die Juden getroffen, die im Ghetto zusammengepfercht waren. Ihr Stadtviertel, jene notorisch von Überschwemmungen heimgesuchte Senke zwischen Marcellustheater und Tiberinsel, wurde des Nachts zugesperrt. Nur tagsüber durften sie ihren Geschäften mit der christlichen Bevölkerung nachgehen. Dazu gehörte auch das einträgliche Möblieren der Palazzi. Da die meisten Räume dieser barocken Wohnburgen für gewöhnlich leer standen, ließ man sie nur dann möblieren, wenn ein Gast zu beherbergen war. So schlief auch Händel von Februar bis Mai 1708 im Palazzo Bonelli in einem Bett, das bei einem jüdischen Händler gemietet worden war.