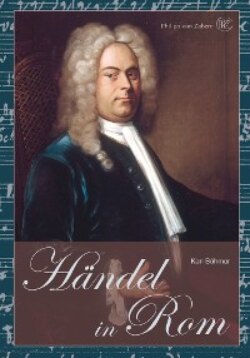Читать книгу Händel in Rom - Karl Böhmer - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVORWORT
Ende 1706 kam Georg Friedrich Händel nach Rom – ein junges Genie von 21 Jahren. Als er die Ewige Stadt Ende 1708 wieder verließ, war er ein gefeierter Maestro, der alle Gattungen des italienischen Stils beherrschte: Cantata und Concerto, Oper und Oratorium. Im Gepäck hatte er einen Fundus von rund hundert Werken und Hunderte von Melodien, aus denen er sein Leben lang schöpfen konnte.
Rom hinterließ Spuren – bei Händel wie bei jedem Romreisenden vor oder nach ihm. Die Ewige Stadt hat sein Stilgefühl geprägt, als Musiker wie als Mensch. In seinen Concerti blieb er zeitlebens Arcangelo Corelli verpflichtet, in seinen Oratorien eiferte er den sakralen Dramen Alessandro Scarlattis nach und verband sie mit tief bewegenden Chören im Stil eines Giacomo Carissimi. In seinen Opern leuchten Einfälle aus den römischen Jahren in immer neuen Varianten auf. An den Ufern des Tibers entwickelte er kompromisslose Ansprüche, was die Qualität des Musizierens und seine gesellschaftliche Stellung als Komponist betraf. Im katholischen Umfeld blieb er zwar Lutheraner, lernte aber eine weltoffene Gläubigkeit kennen. Ebenso reiften seine Vorstellungen von der eigenen Karriere. Alles in allem rief die Ewige Stadt in ihm künstlerische Visionen wach, die sich erst viel später, in seinen Londoner Oratorien und Concerti grossi, erfüllen sollten.
Auch Händel hinterließ in Rom Spuren: Die wichtigsten Musikmäzene der päpstlichen Hauptstadt erkannten sofort das Genie des jungen Deutschen, den sie, italienischen Gepflogenheiten gemäß, „Sassone“ nannten, „Sachse“. Sie förderten sein Genie nach Kräften, öffneten ihm Kirchen und Palazzi und erteilten ihm die lukrativsten Kompositionsaufträge, die in den Jahren 1707 und 1708 am Tiber zu vergeben waren. Seine römischen Werke wurden auch nach seiner Abreise kopiert und aufgeführt. In der Musik seiner römischen Kollegen spiegelt sich die Bewunderung für sein Genie wider.
All dies in einer kleinen Schrift zum Händeljahr 2009 zusammenzufassen, ist umso reizvoller, als kein Abschnitt von Händels Leben und Schaffen in den letzten Jahren so intensiv erforscht wurde wie die italienischen Lehr- und Wanderjahre. Ursula Kirkendale begann in den Sechziger Jahren, anhand von Dokumenten aus dem Fondo Ruspoli eine Chronologie der römischen Jugendwerke aufzustellen. Seitdem hat sie durch immer neue Dokumentenfunde das Bild des italienischen Händel stetig weiter erhellt und dabei auch seinen wichtigsten römischen Gönner, den Marchese Francesco Maria Ruspoli, ins rechte Licht gerückt1.
Zu diesem neuen Bild des italienischen Händel haben viele Forscherinnen und Forscher beigetragen: Hans-Joachim Marx und Reinhard Strohm, Donald Burrows, Ellen Harris, Juliane Riepe, Carlo Vitali und viele andere2. Es ist ihren Forschungen zuzuschreiben, wenn wir heute ungleich mehr über Händel in Rom wissen, als es etwa seinem ersten Biographen John Mainwaring oder seinen Jugendfreund Johann Mattheson vergönnt war.
Die meisten Biographien, die zum Händeljahr erschienen sind, haben diese neueren und neuesten Erkenntnisse schon verarbeitet3, obwohl noch immer Irrtümer von früher verbreitet werden. Daher lohnt sich eine Bestandsaufnahme dessen, was wir zurzeit über Händel in Rom wissen. Ohne Zweifel wird dieser Wissensstand schon bald erweitert und in Teilen überholt sein, denn längst noch nicht alle Reiseberichte jener Zeit wurden ausgewertet, nicht alle Zahlungsbelege, Musikerlisten und sonstigen Dokumente erfasst, in denen unbekannte Schreiber vor 300 Jahren in Rom den Namen des „Sassone“ oder des „Monsù Hendel“ eintrugen4. Unser Wissen über sein Wirken und seine Wege in Rom ist lückenhaft und wird es bleiben. Deshalb kann es auch nicht das Ziel dieses Buches sein, die Lücken zu schließen oder durch neue Hypothesen zu einer rege erwachten Forschungsdiskussion beizutragen. Eher schon soll dem mageren Bestand an Dokumenten das Leben eines historischen Panoramas eingehaucht werden, in dem das Einmalige des Augenblicks sichtbar wird: die Begegnung zwischen einem der größten musikalischen Genies des Barock und dem barocken Rom auf dem Höhepunkt seiner Prachtentfaltung.
Deshalb handelt es sich auch um ein Lesebuch für Romreisende und Romliebhaber. Obwohl in der italienischen Hauptstadt mehr authentische Händelstätten erhalten sind als in jeder anderen Lebensstation des Komponisten, sei es in London oder Hannover, Halle oder Hamburg, Venedig oder Florenz, gemahnt doch bislang nur ein einziges Erinnerungsschild an diesen berühmten Rombesucher5. Und obwohl Händel die Ewige Stadt früher, länger und in weitaus jüngeren Jahren besucht hat als Goethe, die Bedeutung Roms für seine künstlerische Entwicklung also ungleich größer war, ist ihm doch keine „Casa di Händel“ gewidmet. Seine Erinnerungsspuren in der Ewigen Stadt muss man sich vielmehr mühevoll zusammensuchen. Dabei möchte dieses Büchlein helfen.
Noch ein Letztes sei erwähnt: die erstaunliche Renaissance, die Händels römische Werke im Laufe des letzten Jahrzehnts erlebt haben. Noch Mitte der Neunziger Jahre gab es nicht einmal von allen großen römischen Kantaten Aufnahmen – von Aufführungen im Konzertsaal ganz zu schweigen. Seine beiden römischen Oratorien galten als „Geheimtipp“, sein Dixit Dominus und seine sogenannte „Karmelitervesper“ als monumentale Raritäten. Dies alles hat sich gründlich gewandelt und trägt zu einem tieferen Verständnis des jungen Händel und seiner römischen Erfahrungen bei.
Allen römischen Werken gemeinsam ist ihre jugendfrische Aura, ihre vor Einfällen geradezu strotzende Originalität. Es sind Zeugnisse einer glücklichen Zeit, denn Rom gewährte Händel Jahre ungestörten Schaffens, wie er sie später, als umtriebiger Musikunternehmer in der Weltstadt London, nie mehr erleben sollte. „In Wahrheit gäbe es nichts Höheres als die Verbindung des tätigen Lebens mit den ruhigen Genüssen der durch dieses schöne römische Klima erzeugten Seelenharmonie“, so schrieb Stendhal am 29. August 1817 in sein römisches Tagebuch6. Die Verbindung aus „tätigem Leben“ und „Seelenharmonie“, wie sie dem Franzosen im trägen Rom der Restaurationszeit als Utopie erscheinen musste, hat Händel 110 Jahre früher in die Tat umgesetzt.
Abb. 1 Stich der Teutschen Academie Joachim von Sandrarts d. Ä. aus dem Jahr 1677:„Der Statt Rom Grundris und Vorstellung, wie der Zeit alle alte Ruinen, samt neuen Gebeuen, Kirchen und Palatien, aufs herrlichst erhoben und gezieret, unter iezigem Pabst Innoc: XI. anzusehen sein.“