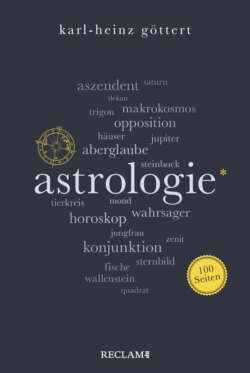Читать книгу Astrologie. 100 Seiten - Karl-Heinz Göttert - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Eine philosophische Begründung der Astrologie
ОглавлениеMan kennt Ptolemäus heute in erster Linie als den Begründer des »ptolemäischen« Weltbildes: der Lehre von der Mittelpunktstellung der Erde im Kosmos. Und man weiß natürlich, dass diese Lehre falsch war – wusste es in Einzelfällen auch schon damals. Ptolemäus’ Zeitgenosse Aristarch nämlich hatte eindrucksvoll begründet, dass nicht die Erde, sondern die Sonne im Zentrum steht – und handelte sich damit eine Anklage wegen Gottlosigkeit ein. Damit war das Problem für mehr als 1000 Jahre erledigt, bis zu Kopernikus und dessen Begründung des bis heute gültigen »kopernikanischen« Weltbildes, das bekanntlich ebenfalls die Autoritäten alarmierte: in diesem Fall die Kirche, die Probleme mit der Bibel sah.
Aber zurück zu Ptolemäus. Dieser Gelehrte war in erster Linie Mathematiker, hatte seine astronomische Theorie entsprechend auf Mathematik gebaut: in seinem Werk Almagest. Es fußt auf der Kugelgestalt der Erde (im Gegensatz zur älteren Scheibentheorie) in einem kugelförmigen Kosmos, wie es schon Aristoteles beschrieben hatte. Danach bewegten sich die Sterne gewissermaßen auf konzentrischen kristallinen Schalen, waren an sie »angeheftet«. Um die Erde waren dies zunächst die »inneren Planeten« Mond, Merkur und Venus, es folgte die Sonne in der Mitte, danach die »äußeren Planeten« Mars, Jupiter, Saturn. Ganz außen gab es eine letzte Schale mit den Sternen, die sich in Sternbildern zusammenfassen ließen.
Das ptolemäische System mit der Erde im Zentrum
Das eigentliche Problem bei diesem Modell stellten die Planeten dar. Sie umrunden die Erde aufgrund ihrer unterschiedlichen Entfernung in unterschiedlicher Zeit. Der Mond benötigt ungefähr 28 Tage, die Sonne ein Jahr, Saturn als der letzte Planet ca. 29 Jahre. Aber das war nicht das einzige Problem. Die inneren Planeten umkreisen die Erde so, dass sie Tag für Tag regelmäßig weiterrücken – wer an einem Abend zum Mond aufschaut, findet ihn am nächsten Abend ein Stück weiter, bis er nach den 28 Tagen wieder dieselbe Stelle einnimmt. Die äußeren Planeten rücken ebenfalls weiter, kehren aber plötzlich wieder zurück, um dann die alte Bewegung weiterzuführen (natürlich nur scheinbar, weil wir sie von einer Erde aus beobachten, die sich selbst mitdreht). Aristoteles hatte dafür die Theorie, dass diese Planeten nicht an einer einzigen Sphäre angeheftet sind, sondern von einer schnelleren zu einer langsameren »springen«. Das wurde sehr kompliziert, führte zu einem Rechnen mit 55 Sphären. Ptolemäus fand eine mathematisch befriedigendere Lösung, indem er von einer Art Schleifenbewegung ausging: Die Planeten führen auf ihrer (leicht »deferenten«, also gegenüber dem Mittelpunkt leicht verschobenen) Bahn kleine Kreise aus, die sich um eigene Mittelpunkte drehen, genannt »Epizyklen«, woraus sich die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung erklärt. Tatsächlich ließ sich damit sehr gut rechnen.
Darstellung von Deferent und Epizykel nach Ptolemäus
Während Ptolemäus in seinem der Astronomie gewidmeten Almagest den Kosmos also letztlich »falsch« konzipierte, hatte er bezüglich der Geographie in seiner Geographia bessere Voraussetzungen. Zwar entlehnte er die Berechnung des Erdumfangs nicht seinem Zeitgenossen Eratosthenes mit dem fast exakten Ergebnis, sondern übernahm dieses von Poseidonios, der auf wenig mehr als die Hälfte gekommen war – was noch Kolumbus zu seinem übertriebenen Optimismus hinsichtlich einer Erreichung von China bei einer Fahrt nach Westen führen sollte. Aber Ptolemäus arbeitete mit einem Nullmeridian, den er durch die kanarischen Inseln legte, führte die Einteilung nach 360 Grad Länge sowie jeweils 90 Grad nördlicher und südlicher Breite ein und spekulierte sogar über einen Subkontinent mit Namen »Terra australis«.
Man sieht also, mit welchem Kaliber man es zu tun bekommt, wenn man sich an das Metier macht, mit dem Ptolemäus letztlich am bekanntesten geworden ist: mit der Astrologie, als Buch ausgeführt in der Tetrabiblos (griechisch für »Viererbuch«). Man kann durchaus von der »Bibel« der Astrologie sprechen. Und dieses Werk beschäftigt sich nicht nur mit der »Technik«, sondern bietet eine Begründung in Zeiten, in denen die Astrologie längst unter Druck stand. Denn genau damit beginnt Ptolemäus, mit der Antwort auf Einwände. Die Astrologie habe es zwar nicht mit exakten und unumstößlichen Tatsachen zu tun, aber dies gelte auch für die Philosophie. Es liege jedoch auf der Hand, dass es himmlische Kräfte gebe, die auf Erden wirksam sind und an denen niemand jemals gezweifelt hat: das Wachstum der Pflanzen zum Beispiel. Und es gebe weitere Hinweise, die wenigstens von den Kennern nicht bestritten würden: die Abhängigkeit der Gezeiten vom Mond, sogar Reaktionen im Pflanzenreich wie das Schwellen und Strotzen bei zunehmendem, das Abnehmen und Verdorren bei abnehmendem Mond.
Wieso also sollte es nicht mehr von diesen Wirkungen geben, auch wenn sie im Einzelnen nicht sicher sind? Im Übrigen richteten sich die Schiffe auf See nach Anzeichen für Regen und Wind, auch wenn die Zeichen manchmal trögen. Unzuverlässigkeit sei jedenfalls kein Einwand, zumal sie ihren Grund oft in Unzulänglichkeiten der Verkünder habe – Irrtümer gebe es in jeder Wissenschaft. Die Vorhersagen könnten sich nur auf systematische Beobachtungen stützen, aber diese beruhten tatsächlich auf Bedingungen, die sich niemals mehr ganz genau wiederholten, weshalb Exaktheit auch nicht zu erwarten sei. Nicht nur dass es unmöglich sei, alles zu berücksichtigen, schon die Zeitnahme sei ein Problem – die damals gebräuchlichen Sonnen- wie die Wasseruhren waren einfach zu ungenau. Die Astrologie scheitere also wenn überhaupt, dann an mangelnder Technik. Dass man sich von der üblichen Geschäftemacherei nicht irritieren lassen dürfe, ist nur am Rande bemerkt.
Ptolemäus lässt sich weiter auf den philosophischen Kern des Problems ein: auf die Frage der Vorherbestimmung, der Determination. Was soll ein Vorherwissen nützen, wenn Widriges nicht abgewendet werden kann? Die Antwort des Stoikers Ptolemäus geht in eine doppelte Richtung: Erstens sei bei Vorherwissen statt des unbekümmerten und womöglich schädlichen Auslebens von Leidenschaften deren Bändigung möglich. Zweitens bestimme der Himmel Schicksale eher allgemein, weniger individuell. Pest oder Überschwemmungen zum Beispiel träfen nicht jeden gleich, und vor allem könne man ihnen vorbeugen. Der Astrologe ähnele also dem Arzt, der aus Zeichen die Zukunft eines Geschwürs »berechnet« und mit Wundbehandlung reagiert. So gesehen könne der Astrologe wie der Arzt die »notwendige« Zukunft durchkreuzen, indem er in die Verläufe eingreife.
Ptolemäus macht dies allerdings an einem denkbar schwachen Beispiel deutlich. Der Magnet ziehe Eisen an, heißt es, aber man könne diese Wirkung aufheben, wenn man den Magneten mit Knoblauch einreibe. Schon besser das Beispiel, dass man sich gegen Witterungseinflüsse bzw. die Jahreszeiten mit entsprechender Kleidung schütze. Die Tendenz ist jedoch klar: Die Astrologie sollte nützlich sein, der Lebensführung dienen, indem sich der Einzelne durch sie gegen die Einwirkungen des Himmels schützt.
Soweit war die Astrologie auf philosophischer Ebene verteidigt, gewissermaßen gesellschaftsfähig gemacht – man konnte sie nicht einfach als etwas »Irrationales« abtun. Die Verwissenschaftlichung reichte aber weiter, suchte Anschluss an die Naturphilosophie. Ein Beispiel dafür ist die Lehre vom »Charakter« der Planeten. Wenn man liest, dass Saturn träge und schwer ist und deshalb Krankheiten wie Rheuma oder Schwindsucht auslöst, während Mars als schnell und beweglich gilt und deshalb Fieber oder Blutstürze bewirkt, stützt sich Ptolemäus nämlich auf die Elementenlehre des Aristoteles. Danach ist Saturn dem Element Erde zugeordnet, dem nach Aristoteles die Qualität des Kalten und Trockenen entspricht, woraus sich dann Charakter und »Krankheit« ergeben. Genauso im Falle des Mars, der dem Element des Feuers zugeordnet ist und daher seinen Charakter hat bzw. entsprechende Krankheiten auslöst.
Allerdings stößt Ptolemäus selbst auf das Unlogische oder gar Widersprüchliche solcher Deutungen in den vorgefundenen Systemen und wundert sich etwa darüber, warum Saturn, wenn er in den ersten Graden der Waage steht, eine besondere Wirkung haben soll. Man sieht deutlich, dass Ptolemäus Bewertungen anstrebt, die sich »rational« begründen lassen. Warum sind Trigon (Dreieckstellung) und Sextil (Sechseckstellung) harmonisch, Quadrat und Opposition disharmonisch? In diesem Fall zeigt der Blick auf den kompletten Tierkreis, dass sich in den Trigonen »verwandte« Sternbilder (z. B. Krebs, Fische, Skorpion), im Quadrat »gegensätzliche« gegenüberstehen (z. B. Löwe und Stier, Wassermann und Skorpion). Wo Ptolemäus auf die Lehre von den Häusern und noch speziellere Interpretationsmethoden eingeht, gibt er Inkonsequenzen und Widersprüche in der Überlieferung zu, versucht sie zu glätten. Sein Ratschlag ist typisch wissenschaftlicher Art: Man möge einen Vergleich der Schriften anstellen.