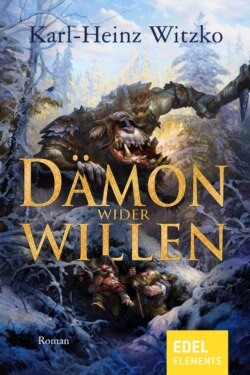Читать книгу Dämon wider Willen - Karl-Heinz Witzko - Страница 5
1.
ОглавлениеOmstrand unterschied sich in nichts von anderen Fischerdörfern an der Alten Küste. Die Hälfte der Häuser war seit Jahren unbewohnt und verfiel, während in den restlichen auffällig viele alte Leute wohnten und eine Stimmung verbreiteten, als hätten sie die wichtigste Entscheidung ihres Lebens verpasst und warteten nur mehr darauf, dass wieder einer ihrer Enkel oder Urenkel alt genug war, um nach Westen aufzubrechen und das Meer zu suchen. Über hundert Jahre hatten nichts an diesem Zustand geändert. Irgendwo in der Nähe des Dorfes lagen sicher noch nutzlos gewordene Boote, die zusammen mit uralten Netzen verrotteten.
Der Dieb war von kleiner Statur, weniger als mittelgroß, und hatte bemerkenswert schmale Schultern. Als triebe ihn ausschließlich das Verlangen, seinen Durst zu stillen, betrat er die Dorfschenke, die auf den wenig einfallsreichen Namen Der Krug getauft worden war. Sicherlich die Hälfte aller Dorfschenken an der Alten Küste hieß so.
Der Krug bot auch im Inneren wenige Überraschungen. Es gab beinahe nichts, was der Dieb nicht schon Dutzende Male anderswo gesehen hatte. Die wenigen Einheimischen drängten sich wie üblich um einen einzigen Tisch in der einen Hälfte der Gaststube und bildeten eine Phalanx aus Rücken, während die Fremden, so unterschiedlich sie auch waren – die Händler, die Handwerker, die Neusiedler und abenteuerlustigen Naturen –, sich in der anderen Hälfte ausgebreitet hatten. Beide Gruppen trennte ein unsichtbarer Graben. Keine Seite wollte mit der anderen mehr als unbedingt nötig zu tun haben.
Dabei waren die Bewohner der Alten Küste eigentlich gar kein unfreundlicher Menschenschlag, wie der Dieb wusste. Doch die Fremden, die durch ihre Dörfer zogen, machten ihnen Angst. Sie empfanden sie offensichtlich als etwas Ähnliches wie Sand in einer Sanduhr, die gewendet worden war, als ihre Urgroßeltern noch Kinder gewesen waren. Seit damals rieselte der Sand von einem Kolben in den anderen, und wenn das letzte Körnchen in nicht mehr allzu ferner Zeit durch die enge Öffnung fiel, so wäre das Ende ihrer jahrhundertealten Lebensart gekommen.
Der Dieb kannte zwar die Schwächen seines Gleichnisses, war aber überzeugt, dass es das innerste Wesen der Einheimischen einigermaßen gut beschrieb. Auch er hatte heute mit einer Art Sanduhr zu tun. In seinem Fall hatte sie die Gestalt eines Geschichtenerzählers angenommen, der die Aufmerksamkeit sämtlicher Reisender auf sich gezogen hatte. Keine Bedrohung ging von dieser Sanduhr aus, im Gegenteil, die Ablenkung würde seine Arbeit erleichtern und ihn überdies auf dem Laufenden halten, wie viel Zeit ihm noch für die halbwegs ungestörte Erledigung seines Tagewerks blieb. Denn der Dieb kannte die Geschichte, die der Erzähler vortrug. Auch die Reisenden kannten sie genauestens. Wahrscheinlich gab es im gesamten Aldermannland keine lebende Seele, die sie noch niemals gehört hatte. Aber es war eben etwas ganz anderes, ob man sie weit entfernt erzählt bekam oder in Sichtweite dieser einzigartigen Steilklippe, die sich Hunderte von Meilen nahezu ununterbrochen mitten durch das Land zog und wie die Stufe einer Treppe für Riesen wirkte.
Der Dieb bemerkte das Unheil, das ihm auflauerte, beinahe umgehend, als er ein Kitzeln in der Nase spürte und die ersten Tränen in seine Augen traten. Irgendwo musste entweder eine Katze herumstreichen, oder einer der Gäste trug ein Katzenfell. Vielleicht dampfte auch auf einem Tisch eine Tasse mit Kamillentee, oder jemand hatte sich die Haare mit einem Aufguss der Pflanze gewaschen! Kamille und Katzen – das waren zwei alte Erzfeinde des Diebes, unter denen er seit seiner Kindheit litt. Sie trieben ihm das Wasser in die Augen und zwangen ihn zu niesen, als litte er an der schlimmsten Erkältung. Alles in dem Dieb strebte danach, die Schenke umgehend wieder zu verlassen. Doch sogleich meldete sich die Stimme der Vernunft: Seit zwei Tagen folgte er dieser Gruppe von Reisenden. Heute war seine letzte Gelegenheit, die Ernte einzufahren, denn morgen wären sie bereits im Hellenland, und dorthin wollte er ihnen lieber nicht folgen, wenn es sich vermeiden ließ.
Aus Rücksicht auf seinen Zustand beschloss der Dieb, sein ursprünglich auserkorenes Opfer gegen ein leichteres auszuwechseln. Mit verschwommenem Blick sah er sich um, traf seine Wahl und trat zu einer der Sitzbänke. »Setz dich, Junge«, sagte das neue Opfer freundlich und rutschte ein Stück zur Seite.
Gimpel, wohlverdient!, dachte der Dieb geringschätzig und wartete gerade so lange, bis sein Opfer – ein Bäcker oder Zimmermann, so weit er mitbekommen hatte – wieder in den Bann der Geschichte gezogen worden war. Dann griff er behutsam nach den Riemchen, die dessen Börse am Gürtel festhielten, und zückte ein Messer mit schmaler, scharfer Klinge. Ans Werk!
Unterdessen trug der Erzähler seine Geschichte vor. Er war zwar kein Meister seines Faches, entschied der Dieb, doch hinreichend begabt; wahrscheinlich stammte er aus einem der Dörfer in der Umgebung.
Nachdem der Erzähler schon einen kleinen Sturzbach von Blut in wohlgesetzten Worten vergossen hatte, kam er nun zur dramatischen Wende seiner Geschichte:
»Riesig erhob sich das Höllentor, und viele, die es erblickten, überkam Furcht und Zweifel. ›Was sollen wir tun?‹, fragte sich mancher. ›Wie sollen wir in seinem verderbten Schatten leben?‹, klagten viele.
Doch schon trat furchtlos aus ihren Reihen der strahlende Held Wyrmelar. Geschwind nahm er seinen Bogen Hornissenschwarm und legte auf die Sehne Pfeile. Nicht einen, wie es ein gewöhnlicher Sterblicher täte, nicht zwei, wie es die Gewohnheit der ausgelöschten Waldgeister gewesen sein soll, bevor sie den Neid der Götter zu schmecken bekamen, sondern gleich dreie. Dreie! Die schickte er mit bösem Brummen gegen das Höllentor, doch ihre Spitzen prallten fruchtlos ab und ihre Schäfte zerbrachen. Daher griff der Held zu seinem gefürchteten Speer Wolkenpfähler, mit dem er einst sechs Feinde gleichzeitig aufgespießt hatte, als sie gerade wenig weise hintereinander standen. Doch auch der bewirkte nichts. Wohl blieb der Speer in dem Tor stecken, doch das war alles. Nun erwachte Wyrmelars Groll. Mit finsterem Blick zückte er sein Schwert Torsospalter. Sieben mal sieben mal sieben mal sieben Streiche führte er gegen das schändliche Tor, dann brach auch diese edle Klinge. Noch immer war keine Schramme zu entdecken. Nun war guter Rat teuer. Was gab es noch zu tun? Gefeit schien das Tor gegen Pfeil, Speer und Schwert. Erneut machte sich Mutlosigkeit breit, doch noch immer gab sich Wyrmelar nicht geschlagen.
›Nicht weichen werde ich, das schwöre ich bei meinem Leben!‹, rief er. ›Bringt mir sogleich meinen Hammer Halgirta!‹
Stille legte sich bei diesem Schwur über den ganzen Heerbann, und noch viel stiller wurde es, als endlich der heilige Kriegshammer Halgirta durch die Reihen getragen wurde.«
Einer der Zuhörer unterbrach den heiser flüsternden Erzähler: »Warum hat der Hammer einen Frauennamen?«
»Frauenname?«, wiederholte der Erzähler abgelenkt.
Gute Frage!, dachte der Dieb, der soeben sein Werk zu Ende gebracht hatte, sich nun vorsichtig erhob und von der Bank entfernte. Noch nie hatte er gehört, wie der Name des Hammers erwähnt wurde. Zwar wurde die Geschichte des Höllentors von keinen zwei Erzählern gleich geschildert – bewahre, schließlich ging es ihnen vor allem darum, die Zuhörer großzügig zu stimmen! –, doch der Hammer hieß sonst immer nur Hammer. Selbst das eine Mal, als ein offensichtlicher Waffenfreund Wyrmelar gleich fünfzehn Klingen und Spieße ausgefallenster Form und Herkunft hatte zertrümmern lassen, bis ihm endlich der vergleichsweise langweilige Hammer eingefallen war, hatte es sich nicht anders verhalten.
Während der Dieb sich in einen etwas verschwiegeneren Teil der Schenke zurückzog, um ungestört seine Beute zu sichten, nahm der Erzähler den verlorenen Faden wieder auf. Wie sich zeigte, hatte er eine ganz eigene Art, mit störenden Fragen umzugehen.
»Stille herrschte, und kein Ton war zu hören, als Wyrmelar nach dem heiligen Hammer ... Halgert... rief: Halgert, herbei! Bringt mir den heiligen Hammer Halgert! Und schon bald darauf hielt er ihn in den Händen und schlug machtvoll gegen das Tor. Plötzlich erklang ein Geräusch, wie es noch nie gehört worden war, und ein erstaunter Laut kam über seine Lippen: ›Was ist das denn?‹«
Was ist das denn?, dachte auch der Dieb, als er in dem Beutelchen nichts weiter als zwei Stücke Senkblei und ein paar kleine Münzen vorfand. Verärgert blickte er zu dem Handwerker. Was dachte sich der Kerl eigentlich dabei, mit so kümmerlicher Barschaft zu reisen? Bildete er sich etwa ein, im Hellenland alles umsonst zu bekommen? Vorstellungen hatten manche Leute! Diese kärgliche Beute war ja kaum der Mühe wert. Er kam wohl nicht umhin, noch jemand anderem seine Aufwartung zu machen!
Ein schier unwiderstehlicher Drang zu niesen befiel den Dieb. Hechelnd kämpfte er gegen den Reiz an, und nur noch wie aus weiter Feme hörte er den Fortgang der Geschichte: wie Wyrmelar das Höllentor zerschlagen hatte und dahinter eine kaum erkennbare, wenig einladende und großes Unheil versprechende Landschaft sichtbar geworden war. Als blicke man in eine finstere Höhle! Doch dann war die Öffnung des zerschlagenen Höllentors seitwärts und nach oben gewachsen, und unter dem Einfluss des warmen und hellen Sonnenlichts hatten sich die Hügel und Täler der scheinbar aus dem Nichts quellenden Landschaft mit saftigem Grün überzogen. Schließlich hatte Wyrmelar seine folgenschwere Rede gehalten:
»›Vor 587 Tagen eroberten die Höllenkrieger die erste Mannlänge unseres Landes. Seitdem fochten wir in einem großen Krieg, um zu erproben, ob das Land unserer Vater bestehen kann. Heute haben wir uns auf dem letzten Schlachtfeld dieses Krieges versammelt, doch ein Gespenst geht um im Aldermannland – das Gespenst der Sorge um die Zukunft! Ich stehe auf dem Gipfel dieser Klippe, doch ich mache mir keine Sorgen. Denn ich habe einen Traum! Ich habe einen Traum, dass eines Tages auf den grünen Hügeln dieses darbenden und noch von den Schattenhöllen versklavten Landes die Söhne und Töchter des Aldermannlandes am Tisch der Brüderlichkeit sitzen können. Ich habe diesen Traum heute! Krieger des Aldermannlandes, wollt ihr ewig leben? Folgt mir in diese Finsternis, damit wir unserem Feind das nehmen, was er uns zu nehmen trachtete. Mancher mag glauben, wir seien zu wenige. Doch ich will keinen einzigen Mann mehr, denn ich bin gierig nach Ruhm. Je kleiner unsere Zahl, desto größer das Ehrenteil. Und wer diesen Kampf überlebt und heimgelangt, soll sich erheben, wenn sich der heutige Tag jährt. Er soll die Ärmel hochstreifen, stolz seine Narben zeigen und sagen: Ich zog sie mir zu, als ich Wyrmelar in die Schattenhöllen folgte. Wir können es schaffen! Ja, wir können es! Ja, wir können es! Ja, wir können es!‹«
Der Dieb hatte mittlerweile einen Entschluss gefasst. Er wollte nicht noch einmal jemand Beliebiges auf gut Glück bestehlen, sondern sich an sein ursprüngliches Opfer halten, einen Bernsteinhändler, wie er es gleich hätte tun sollen. Bei dem wusste er wenigstens, woran er war.
Er wischte sich die Tränen aus den Augen und wurde abermals von einem Niesreiz geplagt, und da er ihn nicht nochmals unterdrücken konnte, wurde er von ihm regelrecht durchgeschüttelt. Als der Anfall ausgestanden war, begab sich der Dieb so beiläufig wie möglich zu seinem neuen Opfer. Enttäuscht nahm er zur Kenntnis, dass es eingeklemmt zwischen zwei anderen Gästen saß. Wie sollte er bloß an den Mann und seine Börse gelangen?
Nicht mehr ganz so feurig wie zuvor, schilderte der Geschichtenerzähler, wie das Heer Wyrmelars weiter vorgedrungen war. Seine mangelnde Begeisterung war kein Wunder, denn größere Schlachten hatten augenscheinlich nicht mehr stattgefunden, nachdem die Höllenkrieger keinen Widerstand mehr geleistet und nur noch an Flucht gedacht hatten. Das Erwähnen immer neuer verlassener Täler, in denen neuerdings Gras und Blüten sprossen, war kein vollwertiger Ersatz für spritzendes Blut, knackende Knochen und Heldenmut.
Der Dieb wurde unruhig. Viel Zeit blieb ihm nicht mehr, denn bald schon würde der Erzähler beschreiben, wie das Heer endlich das Meer erreichte, dessen Wellen noch vor Kurzem gegen die Klippe von Dönenstorz geschlagen hatten, und wie die Hexen in Wyrmelars Gefolge schließlich erkannten, dass es den Höllenkriegern gelungen sein musste, ein neues Tor zu errichten und gleich wieder zu versiegeln, sodass ihnen niemand mehr folgen konnte. Danach würden nur noch ein paar Worte über Wyrmelars Abschied kommen, und die Geschichte wäre zu Ende!
Rettung kam von unverhoffter Seite, als ein neues Niesen aus dem Dieb herausbrach. Der linke Nachbar des Bernsteinhändlers wandte sich nämlich sofort zu ihm um, betrachtete ihn angewidert, wischte sich mit der Hand den Nacken trocken, erhob sich und ging zum Wirt, mutmaßlich, um sich seinen Krug neu füllen zu lassen. Geschwind nutzte der Dieb die Gelegenheit und setzte sich. Er wartete gerade lang genug, um sicher zu sein, dass der Vertriebene nicht zurückkehrte, um seinen verlorenen Sitzplatz einzufordern, dann zückte er sein Messer. Erneut griffen seine Finger nach einer fremden Börse. Er hob sie etwas an, um beim Zerschneiden der Riemen, an denen sie hing, nicht am Gürtel des Bestohlenen zu zerren und dadurch dessen Aufmerksamkeit zu wecken.
Die Krieger in der Erzählung hatten gerade die Küste erreicht, als die scharfe Schneide den ersten Riemen teilte. Zwei weitere Riemchen hatten ihre Daseinsberechtigung eingebüßt, als die Hexen ihr Urteil bekannt gaben und die Krieger des Aldermannlandes schwankten, ob sie jubeln oder murren sollten. Das Messer berührte gerade den letzten Riemen, als die Zuhörer zu klatschen begannen!
Der Dieb war verwirrt. Die Erzählung konnte doch noch nicht zu Ende sein? Musste er etwa so kurz vor dem Ziel aufgeben? Welch ein Betrug!
»Stille, Stille!«, forderte der Erzähler. »Ihr braven Leute habt doch noch gar nicht gehört, was aus dem strahlenden Wyrmelar wurde!«
»Wurde er denn nicht König und lebte glücklich bis an sein Ende?«, fragte jemand.
»Aber nein!«, antwortete der Erzähler aufgebracht. »Nein, es war ganz anders, nämlich traurig, erschütternd und aufwühlend.« Er warf einen hoheitsvollen Blick in die Runde und sprach weiter.
Erschrocken spürte der Dieb das Nahen eines neuen Niesanfalls. Nicht jetzt!, dachte er. Doch es war schon zu spät. Abermals begann er zwanghaft zu hecheln. Sein Kopf bog sich zurück und peitschte dann heftig nach vorn, als Luft und winzige Tröpfchen geräuschvoll aus Nase und Mund schossen.
»Wyrmelar fürchtete jedoch, sich den Neid der Götter zugezogen zu haben«, berichtete gleichzeitig der Geschichtenerzähler. »Daher schlich er bei Nacht und Nebel aus dem Lager, nahm einen anderen Namen an und ging in ein fernes Land. Nie wieder ward ein Wort von ihm gehört! Doch sein Ruhm besteht weiter!«
Nun durfte geklatscht werden! Der Erzähler erhob sich und verbeugte sich mehrmals. Plötzlich spürte der Dieb eine Hand auf seiner Brust. Sie gehörte dem Bernsteinhändler! Der füllige Mann sah ihn entsetzt an. Einen Augenblick meinte der Dieb, sein Herz müsse vor Schreck im Leibe zerspringen, doch dann ließ der Bernsteinhändler kraftlos die Hand fallen und das Kinn sinken. Einen Augenblick lang verstand der Dieb nicht, wie ihm geschah, dann erkannte er den Grund dieses Verhaltens: Er hatte während des letzten Niesanfalls seinem Opfer die Messerklinge bis zum Griff in den Leib gerammt! Offenbar hatte er den Bernsteinhändler versehentlich erstochen.
Der Dieb konnte kaum noch atmen. Es war schlimm genug, als Dieb ertappt zu werden, doch die Strafe für einen Mord wäre der Tod und in dieser Gegend mit kaum vorstellbarer Grausamkeit verbunden! Er musste weg. Rasch zerriss er den letzten Riemen, der die Börse am Gürtel seines Opfers hielt, und beeilte sich, aus der Schenke zu kommen. Er stolperte über Stühle und fremde Beine und schlug sich vielmals die Knie an – nicht nur wegen der Angst, die ihn trieb, sondern auch weil seine Augen schon wieder in so vielen Tränen schwammen, dass er alles um sich herum nur undeutlich wahrnahm.
Vor der Schenke warteten ein paar Pferde. Der Dieb schwang sich auf das stattlichste, denn auf eine weitere Missetat kam es nun nicht mehr an. Das Pferd ging langsam einige Schritte und blieb dann stehen. Mit Mühe brachte der Dieb es dazu, ein paar weitere Mannlängen zurückzulegen, doch dann hatte es schon wieder alle Lust verloren. Der Dieb stieg von seinem Rücken. Angstvoll blickte er zu der Schenke, aus der er bereits die ersten Entsetzensschreie zu hören glaubte. Er rannte los. Eine große Wahl blieb ihm nun nicht mehr, sagte er sich. Das Schicksal hatte entschieden.