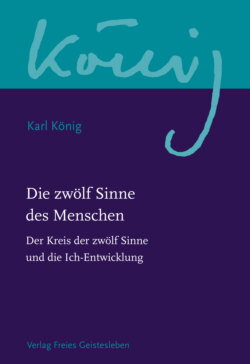Читать книгу Die zwölf Sinne des Menschen - Karl König - Страница 11
Umwelt-bezogene Sinne
ОглавлениеZu ihnen werden Geruchssinn, Geschmackssinn, Sehsinn und Wärmesinn gerechnet. Hier weist König darauf hin, dass es sich bei den in-Welt-bezogenen «unteren» Sinnen um bloße Empfindungen handelt, während die Umwelt in unterschiedlichen Modalitäten als Erfahrungen vermittelt werden. Es wird, mit den Worten Karl Königs, «ein anderer ‹Leib›, der Leib der uns umgebenden Welt» wahrgenommen, was bedeutet, «dass unser eigener Leib in einem größeren, weiteren und schöneren Leib lebt, der ihn umgibt». Worauf König ebenfalls hinweist ist, dass die Wahrnehmung dieser Umwelt-bezogenen Sinne in dem Sinne «individuelle Erfahrungen» sind, dass wir sie mit keinem anderen Menschen teilen, wir sie ganz für uns haben. Zugleich wird aber verdeutlicht, dass wir «die Wahrnehmungen, die ein jeder macht, miteinander vergleichen, sie benennen, und uns über sie austauschen […] Moderne Physiologen irren sich, wenn sie annehmen, es handele sich bei den Erfahrungen des Geruchs, des Geschmacks, der Farbe und der Wärme um Urteile. Ein Geruch oder ein Geschmack hat mehr Realität als eine chemische Formel, die in Bezug auf diesen Geruch oder Geschmack erarbeitet werden kann. Geschmack, Geruch, Gesehenes und Wärme sind Wirklichkeiten des Weltleibes, in den wir eingebettet sind. Weil das für alle Menschen so ist, können wir uns auf sie beziehen und über sie sprechen, auch wenn es sich um individuelle Erfahrungen handelt».
«Wir können nur sagen, wonach etwas riecht, denn Gerüche sind individuell, und es gibt so viele Gerüche, wie es Worte gibt, sie zu benennen und zu beschreiben», so Karl König im Hinblick auf die schier unbegrenzte Mannigfaltigkeit an Gerüchen. Abgesehen davon, dass man beim Versuch, dieser unübersehbaren Mannigfaltigkeit an Geruchsqualitäten auf die besonders dem Geruchssinn eigene Schwierigkeit stößt, dass keine spezifischen Wortbezeichnungen für Geruchsklassen oder Geruchskategorien existieren, weil Gerüche in besonderem Maße der Sphäre des Emotionalen, Affektiven und Vitalen angehören, ist die Charakterisierung der einzelnen Gerüche als «individuell» zutreffend. Das zeigt sich auch daran, dass die Versuche, das vielfältige Gesamt der Geruchsqualitäten in eine Phänomenale oder an anderen Kriterien orientierte Ordnung zu bringen, allesamt vorläufig sind, unbefriedigend erscheinen und letztendlich als gescheitert angesehen werden müssen.22
Der Geruchssinn, darauf verweist König eindrücklich, bringt uns auf sehr intime Weise in eine Vereinigung mit den Dingen, insofern diese, gleichsam «verduftend», sich der Luft mitteilen, dass wir dort, wo wir mit unserer Sprache darauf zu verweisen suchen, auf das jeweilige Substantiv Bezug nehmen: es riecht wie eine Rose, wie Lindenblüten, wie ein Kadaver. In früherer Zeit ist von den Ärzten beispielsweise eine Masernerkrankung nicht nur am Hautausschlag, sondern auch an einem spezifischen Geruch diagnostiziert worden, nämlich: Es riecht wie im Keller der Berliner Viktualienhändler (Scharlach), oder, bei Masern: Es riecht wie frisch gerupfte Gänsekiele.23 Ähnliches findet sich in der Medizin hinsichtlich spezifischer, unverwechselbarer Mundgerüche, nämlich einem Foetor hepaticus, diabeticus, psychoticus u. a. m.24 Zudem macht König darauf aufmerksam, dass Gerüche dann entstehen, wenn Verwesungsprozesse sich abspielen, Absterbeprozesse, wenn also im aristotelischen Ursachenmodell sich eine Steresis abspielt, im Rahmen von Entstehen und Vergehen der einjährigen Pflanze eine «Beraubung» (vom gestaltenden «eidos» bzw. der «causa formalis») vonstattengeht. Oder in der Begrifflichkeit der modernen Naturwissenschaften: Dass das Phänomen Geruch im Zuge eines Prozesses auftritt, der nach dem Zweiten Thermodynamischen Hauptsatz nach Entropiezunahme im Sinne maximaler molekularer Unordnung strebt. Eine aufschlussreiche phänomenologische Zuordnung bestimmter Geruchsqualitäten zu den jeweiligen Relationen zwischen Aufbau- und Abbauprozessen ist von Thomas Göbel durchgeführt worden.25 Worauf König uns des Weiteren bei der Besprechung des Riechsinns verweist, ist der Umstand, dass wir beim Riechen die Substanzen in extremen Verdünnungen noch riechen, die den Verdünnungen potenzierter Arzneimitteln entsprechen, und auch darauf, dass sich das Riechhirn im Zuge einer evolutiven Höherentwicklung in das Limbische System unseres Gehirns metamorphosiert hat, das neben dem Gedächtnis im Dienste der emotionalen Tönung unserer Sinneserfahrungen steht.
Eindrucksvoll gelingt König eine Kontrastierung zwischen Riechsinn und Geschmackssinn, hier die unbegrenzt individualisierte Erlebnismannigfaltigkeit, dort eine klare Konturierung auf die Grundqualitäten bitter, salzig, süß und sauer, die erst im Verbund mit dem Riechen eine qualitative Vervielfältigung erfahren, wobei gerade durch das Schmecken Vorlieben und Abneigungen in Erscheinung treten, die uns darauf hinweisen, wie weitreichend die Sinneserlebnisse im engeren Sinn auch auf andere Erlebnisstufen übertragbar sind, ohne dabei ihre spezifische Sinnesqualität einzubüßen.
Der Darstellung des Sehens stellt König eine Behandlung seines Organs, also des Auges voraus. Dabei streift er den Gedanken, dass das Auge als Organ nicht allein die Funktion erfüllt, dem Menschen das Sehen der Welt, also eine Bewusstwerdung des (visuellen) Weltganzen zu ermöglichen, sondern es zugleich dem Weltganzen ermöglicht, sich seiner Selbst bewusst zu werden. Insofern gehört das Sinnesorgan als Werkzeug der Wahrnehmung stets dem Menschen als Mikrokosmos und dem Weltganzen als Makrokosmos an.
Die Natur ist es, die (nach Goethe) durch uns – und zwar zuallererst durch unsere Sinne – sich offenbaren will: Das Auge hat sein Dasein dem Licht zu danken. «Aus gleichgiltigen thierischen Hilfsorganen ruft sich das Licht ein Organ hervor, das seinesgleichen werde, und so bildet sich das Auge am Lichte fürs Licht, damit das innere Licht dem äußeren entgegentrete.»26 Wenn das stimmt – der in die Breite geführte Erweis, vor allem des «Wie», steht noch aus! –, könnte man gemäß diesem Modell ganz allgemein die These aussprechen: Der Mensch bildet sich (aus dem Sinn) am Sein für das Sein; die Welt-Wirklichkeit tendiert dahin, sich ständig neue Organe im Menschen heranzuziehen, um sich mit ihrer Hilfe in immer weiteren und tieferen Bereichen erschließen zu können. Hebt man das Gegenüber von Selbst und Welt auf und betrachtet das Selbst als Moment (Movens) innerhalb der Welt, dann stellt sich nicht nur der Leib, sondern der ganze Mensch – genauer: die ganze Menschheit – als ein Organ dar, durch das die Welt ihre Evolution bewerkstelligt. Nicht nur Goethes Weltbild, sondern auch die Anthroposophie Rudolf Steiners baut in sehr weitem Umfang auf solchen Voraussetzungen auf. Immer wieder finden sich bei Steiner lapidare Sätze wie dieser: «Was in die Erkenntnis des Menschen hineinfällt, ist davon abhängig, dass der Mensch Organe dafür hat.»27 Diese Aussage enthält eine Binsenwahrheit, die so selbstverständlich ist, dass es schwer ist, ihre ungeheure Tragweite für das Verhältnis des Menschen zu sich selbst und zur Welt zu ermessen. Sie begründet eine der Einsichten, die eine vorurteilslose Beschäftigung mit dem Weg zur Erlangung von Erkenntnissen der «höheren Welten» ermöglichen. Nicht zufällig beginnt das Werk Theosophie28 mit jenem bekannten Fichte-Zitat, das auf die Möglichkeit einer Erschließung neuer Sinne hinweist. Das Buch endet damit,29 dass Steiner diejenigen Regionen aufzeigt – es sind vor allem die der Gefühle –, wo der Mensch unmittelbar aus seinem alltäglichen Dasein heraus an der Bildung neuer Organe zu arbeiten vermag. Diese Arbeit der Umwandlung der Gefühle hat ihre Bedeutung nicht nur durch die Erfolge, die ihr beschieden sind oder nicht. Unabhängig davon ist bedeutsam, was der Mensch an einer solchen Arbeit erfährt. Dafür kommt es nicht so sehr darauf an, wie weit – sondern dass überhaupt eine solche Umwandlung möglich ist. Diese Erfahrung gehört zu den wichtigsten, die der Mensch machen kann. Denn er hält damit (d. h. mit einer bewussten Mikroevolution) einen Zipfel der Weltevolution in seinen Händen. Das Bilden neuer Organe wird dadurch auf eine ganz neue Stufe gehoben, ja im eigentlichen Sinne des Wortes potenziert, dass der Mensch nicht nur durch seine (ihm mitgegebenen) Sinne «belehrt» wird, sondern diese seinerseits zu belehren vermag.30 Diese Spontaneität bereitet eine neue Form der Rezeptivität vor. Für die Anthroposophie bedeutet der «organologische» Ansatz aber nicht nur den Angelhaken, mit dem der Mensch geistig in die Ausgangsposition «gelupft» wird, von der aus er sich auf den Weg machen kann. Konsequent verfolgt, führte dieser Ansatz zugleich zu tiefen Einsichten in den konkreten Aufbau der menschlichen Wesenheit. Rudolf Steiner selbst hat diesen Weg am weitesten in seinem Fragment gebliebenen Buch Anthroposophie. Ein Fragment (GA 45) ausgeführt.
Karl König weist zudem auf den Umstand, dass das Auge während der Embryonalzeit vom Zwischenhirn aus entsteht und zusammen mit dem Ektoderm, der Hautanlage, das Auge bildet, wobei der bildentwerfende Apparat des Auges aus der ektodermalen Anlage, der bildempfangende Teil aus dem vom Zwischenhirn ausgegangenen Augenbecher entsteht. Verfolgt man Augen- und Gehirnentwicklung im Detail und vergleicht man im voll ausgebildeten Zustand Gehirn und Auge, so erweist sich das Auge als eine Metamorphose des Gehirns. Das Auge als kleines Gehirn, was es zugleich ermöglicht, das Gehirn als Sinnesorgan aufzufassen, als ein großes Auge also. Dieser Gesichtspunkt ist erstmals von Rudolf Steiner entwickelt31 und von Gisbert Husemann im Detail ausgearbeitet worden.32 Entsprechend erweisen sich Sehen und Denken als Abwandlung einer Tätigkeit, eines Typus. «Das Organ des Denkens erweist sich als ein solches, dem das Sehen, unser Organ des Sehens erweist sich als ein solches, dem auch das Denken, in irgendeiner Form zugrunde liegt» (Husemann). Oder in den Worten Rudolf Steiners: «Das Denken hat den Ideen gegenüber dieselbe Bedeutung, wie das Auge dem Licht, das Ohr dem Ton gegenüber. Es ist Organ der Auffassung».33 Ohne dies hier im Einzelnen kommentieren zu wollen, bezieht sich Karl König auf Hinweise Rudolf Steiners und leitet daraus ab, dass dem Menschen durch die luziferische Versuchung durch den Sündenfall die Augen geöffnet wurden und ihm dadurch «die Welt in ihrer Herrlichkeit» erschien. «Das Auge ist», so König seine Auseinandersetzung mit dem Sehsinn beschließend, «das Ergebnis des Sündenfalls, und es ist das Organ, durch das wir die Schönheit und Herrlichkeit der Welt um uns erblicken».
In bewusstem Kontrast zum Sehsinn findet sich bei König der Wärmesinn behandelt. Bei der Verfolgung der Frage, warum Rudolf Steiner der Wahrnehmung der Wärme im Kreis der zwölf Sinne einen so hohen Rang einräumt und sie zwischen dem Sehsinn und dem Hörsinn einordnet, während der Wärmesinn in der konventionellen Physiologie gemeinhin den Erfahrungen der Hautsinne, also Berührung, Schmerz und Vibration zugerechnet wird, führt König aus: «In der Tat ist der Wärmesinn das Tor von den hohen, zu den höchsten Sinnen. Aber warum?» In Bezugnahme des Phänomens, dass wir bei drei Wasserbecken, von denen das eine mit heißem, das andere mit kaltem und ein drittes mit lauwarmem Wasser gefüllt ist, wir die rechte Hand in heißes Wasser, die linke in kaltes Wasser legen und dann die Hände in das Becken mit lauwarmem Wasser halten, so erhalten wir ungleiche Wärmeempfindungen der Hände. Hierzu König: «Wenn wir dieselbe Außentemperatur wegen der Verfassung unserer Hände verschieden wahrnehmen, müssen wir annehmen, dass wir uns nicht auf die Information verlassen können, die uns der Wärmesinn gibt. […] Dies sind Phänomene, die alle höheren Sinne gemeinsam haben. […] es ist der Gleichgewichtssinn, der uns die oben beschriebene, differenzierte Wärmeerfahrung gibt, […] denn der Gleichgewichtssinn arbeitet kontinuierlich daran, eine Balance zwischen der Wärme außerhalb und innerhalb des Leibes zu schaffen.» Im Weiteren führt König aus, dass der Gleichgewichtssinn «viel tiefer in unserem physischen Organismus» arbeitet, indem er «das Verhältnis kleinster Substanzen im Blut so zueinander» reguliert, «dass z. B. die Menge der verschiedenen mineralischen Substanzen im Blut konstant bleibt. Dadurch wird das menschliche Bewusstsein, die persönliche Identität aufrechterhalten».
In diesem Zusammenhang betont König, dass es «die Substanz der Wärme» sei, die für die physikalische Wissenschaft nicht existiere, die gleichwohl «urzeitliche Grundlage aller Schöpfung» sei, die aus der «ersten Verkörperung der Erde als alter Saturn» entstanden sei. «Überall war Wärme, und es ist dieselbe Wärme, die uns in uns die Beständigkeit unseres inneren Milieus aufrechterhält, um unserem Ich die Möglichkeit zu geben, in unserem physischen Leib zu leben […] Wärme ist der Ursprung der Bewegung in der Flüssigkeit.» Und hier ist es das Blut in seiner eigenen Wärme, an das König den Wärme- wie den Gleichgewichtssinn ankoppelt. Dabei wird zudem darauf verwiesen, dass nach Rudolf Steiner im Gegensatz zur traditionellen Auffassung der (damaligen) konventionellen Medizin – nicht das Herz das Blut bewegt, sondern das Herz durch die Eigenbewegung des Blutes in Bewegung versetzt wird, wofür König den Sachverhalt ins Spiel bringt, dass im Verlauf der Embryonalentwicklung eine Blutzirkulation zu beobachten ist, lange bevor diese mit den Anlagen von Herz- und Blutgefäßen verbunden ist. Im Übrigen zeigen neuere kardiologische Forschungsergebnisse, dass sich hier inzwischen stillschweigend ein Paradigmenwechsel vollzogen hat. Denn die Kompensationsbreite der Kreislaufperipherie und deren wirkungsvolle Manipulation durch β-Blocker und ACE-Hemmer bei systolischer Herzinsuffizienz stellt eine mechanisch gedachte Funktion des Herzens als eine Pumpenvorrichtung infrage. Hinzu kommt das systematische Versagen positiv inotroper (die Herzschlagkraft erhöhender) pharmakologischer Ansätze der Herzinsuffizienztherapie, was indirekt auf die Bedeutung der Mikrozirkulation auf Organebene hinweist und die postulierte Bedeutung des Herzens als alleinige Ursache der Blutbewegung infrage stellt. Diese und weitere Detailerkenntnisse haben dazu geführt, dass inzwischen bei der Behandlung der chronischen Herzinsuffizienz die ehemals angewendeten, positiv inotrop wirkenden Pharmaka kontraindiziert sind und die zuvor ausdrücklich kontraindizieren Arzneimittel wie β-Blocker, ACE-Hemmer und Sartane zu den Mitteln der Wahl wurden. Erst die Verabschiedung des Paradigmas vom Herzen als einer Pumpe und deren Versagen bei der Herzinsuffizienz hat es ermöglicht, dass sich die β-Blocker als negativ inotrope Substanz durchgesetzt haben. Bei der diastolischen Herzinsuffizienz ist nicht primär die systolische Kontraktion betroffen, sondern die Relaxation, das «Lösen» des Herzens eingeschränkt. Hier zeigen neuere Forschungsergebnisse, dass selbst die vorgenannte Arzneitherapie zu keiner Verbesserung führt, also unwirksam ist. Was anthroposophisch orientierte Kardiologen an Erfahrungen berichten, ist, dass gerade die chronische Herzinsuffizienz eine Herausforderung an die Therapieprinzipien der anthroposophischen Kardiologie ist und sich die Heileurythmie sowie die anthroposophisch ausgerichtete Psychokardiologie als wichtige und wirksame Pfeiler der Therapie erweisen. Jedenfalls scheint es, als ob die paradigmatische Ausrichtung der Herzfunktion im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte eine Richtungsänderung erfahren hat, nämlich weg von der tradierten Vorstellung der Pumpenfunktion des Herzorgans in eine Richtung, die sich zunehmend derjenigen des Herzens als eines Wahrnehmungsorgans auf unterschiedlichen Ebenen annähert.34
Angeregt durch geisteswissenschaftliche Forschungsergebnisse Rudolf Steiners stellt Karl König eine Verbindung zwischen Wärmesinn, Gleichgewichtssinn und dem Ich des Menschen her. «Innerhalb des zirkulierenden Blutes lebt der Wärmesinn, und innerhalb des Wärmesinns lebt das Ich des Menschen, welches Gleichgewicht und Wärme durchdringt.» Und weiter: «Das Herz ist nicht nur ein Wahrnehmungsorgan für den Wärmesinn, sondern auch für den Mut – oder auch die Feigheit. Eine der wichtigsten menschlichen Emotionen, der Zorn, lebt im Wärmesinn.» König verweist hier auf Ausführungen Rudolf Steiners, wonach «der Zorn der Erzieher des Ich» ist. Und König führt weiter aus: «Der Zorn kann nur wirken, weil der Wärmesinn sein Milieu ist, und so können wir verstehen, warum wir uns erhitzen, wenn wir zornig werden – oder kalt werden, wenn wir einen Wutanfall bekommen. Zorn ist immer mit Wärme, Wut mit Kälte verbunden. Das Ich entwickelt sich im Verlauf der menschlichen Evolution und wächst in der Kraft seiner Liebe. Für einen Menschen, der nie zornig war, wird es äußerst schwer werden, wirkliche Liebe zu entwickeln. Dies ist eng verbunden mit dem Wärmesinn und auch dem Gleichgewichtssinn. […] Das ist die Bedeutung des Wärmesinns. Mut und Feigheit sind ein Teil von ihm, und innerhalb der Gleichgewichtsverhältnisse unserer Wärme entsteht allmählich der Zorn, verwandelt sich in die Kraft der Liebe und gibt unserem Ich die Möglichkeit, sich mit dem Geist-Wesen zu verbinden, das durch den Wärmesinn diese höchste Verbindung vorbereitet.»
Mit diesem Bild des Wärmesinns können wir das Tor zu den vier höchsten Sinnen öffnen, denn dieses Bild entfaltet bestimmte Qualitäten innerhalb des niederen Ich des Menschen und hilft diesem Ich, durch die Liebe, zu seinem eigenen höheren Wesen aufzuschauen. Von diesem aus strömen Hörsinn, Wortsinn, Gedankensinn und Ichsinn in uns. Aber dass dies so sein kann, verdanken wir ganz dem Wärmesinn.