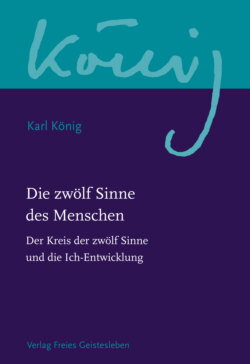Читать книгу Die zwölf Sinne des Menschen - Karl König - Страница 6
Das Sinneswesen als Ich-Leib
ОглавлениеZur Sinneslehre von Karl König
Prof. Dr. Peter F. Matthiessen
Rudolf Steiner hat in seinem erkenntniswissenschaftlichen Hauptwerk Die Philosophie der Freiheit1 die (Sinnes-)Wahrnehmung und das Denken als die beiden letzt-begründenden Quellen aller Wirklichkeitserkenntnis aufgezeigt. Damit ist zugleich der Boden dafür bereitet worden, neben dem Denken auch die Sinnes-Wahrnehmung als unabdingbare Erkenntnisquelle anzuerkennen.
Im Gegensatz zum Denken, das wir tätig hervorbringen müssen, kennzeichnet sich die Wahrnehmung dadurch, dass sie uns ohne unser Zutun «gegeben» ist. So gehört das Phänomen der Letzt Gegebenheit zu den essenziellen Eigenschaften der Sinneswahrnehmung.
Meist sprechen wir von der Sinneswahrnehmung im Singular, obwohl sich die Sinneswahrnehmung in ganz unterschiedliche Sinnesbereiche bzw. Modalbezirke untergliedern lässt. Hier unterscheiden wir die fünf klassischen Sinne, nämlich Tastsinn, Geruch, Geschmack, Sehsinn und Hörsinn. Der Grund dafür, traditionellerweise fünf Sinne aufzuzählen, dürfte darin bestehen, dass bei diesen Sinnen die dazugehörigen Sinnesorgane unschwer aufzufinden sind. Es trägt die Kenntnis der organologischen Grundlage der Sinnesorgane jedoch nichts zu deren phänomenal inhaltlicher Erhellung bei: Als Alltagsmenschen und in den empirischen Wissenschaften gebrauchen wir unsere Sinne unhinterfragt.
Weiterführend für die Grenzziehung zwischen unterschiedlichen Sinnesmodalitäten und für die Verfolgung der Frage, wie viele Sinne des Menschen sich berechtigterweise darstellen lassen, hat sich ein phänomenologischer Ansatz erwiesen. «Dieser Begriff wird in sehr unterschiedlicher Weise gebraucht, vor allem auch im Sinne einer naiven Beschreibung der gewöhnlichen Lebenswelt. Was dagegen im Folgenden als Phänomenologie bezeichnet wird, ist eine erst durch Übung schrittweise zu erlangende Fähigkeit, von der Selbstverborgenheit der Sinneswahrnehmung und ihrer naiv-objektivistischen Handhabung zu einer Thematisierung des Sinnlichen selbst zu gelangen.»2 «Beim phänomenologischen Ansatz haben wir es nicht mit einer natürlichen, sondern mit einer durch eine mit freiem Willensentschluss herbeigeführten künstlichen Einstellung zu tun. Ihr Leitmotiv ist das Postulat der theoretischen Voraussetzungslosigkeit oder der konsequenten Urteilsenthaltung, der methodischen Ausklammerung aller Setzungen, Deutungen und Wertungen, insbesondere der Frage nach Wahrheit oder Falschheit, Wirklichkeit oder Unwirklichkeit, Objektivität oder Subjektivität. Was sich dieser Einstellung darbietet, ist das unmittelbar Gegebene.
Die Wahrnehmung selbst aber tritt originär auf. Sie bedarf keiner anderen Inhalte oder Erkenntnisse, auch keines physiologischen oder physikalischen Wissens, um gegeben zu sein.»3
Den Weg einer methodisch stringenten Selbstbeobachtung und einer konsequenten Erlebnisanalyse hat Rudolf Steiner als Erster aufgezeigt, indem er spätestens im Zusammenhang mit seiner erstmaligen Darstellung der Sinne des Menschen 1909 in dem Vortragszyklus «Anthroposophie» auf diese Vorgehensweise hingewiesen hat.4 Unsere begrifflich geleitete Intention löst dabei die Objekte der Außenwelt in ihre qualitativen «Eigenschaften» auf, die beim gewöhnlichen Wahrnehmen den Dingen gewissermaßen fest anhaften und richtet sich auf die Qualitäten als solche. Die sogenannte analytische Reduktion ist somit nur hinsichtlich der Auflösung der Dinglichkeit analytisch, während sie bei der Herausarbeitung des Qualitativen synthetisch vorgeht: Im Erfassen der Sinnesqualitäten als selbstständiger, auch durch eigene Begriffe repräsentierter Wesenheiten lösen wir uns aus der Verhaftung an die konkreten Gegenständlichkeiten der naiven Lebenswelt und vollziehen eine freie Synthese dessen, was über die Sinneswelt in Einzelerscheinungen verstreut ist. Die Grundsätze, nach denen in der modernen Sinneslehre die analytische Reduktion der Sinnesmannigfaltigkeit erfolgt, sind die Ähnlichkeit (Unähnlichkeit) und die Abhängigkeit (Unabhängigkeit) der verschiedenen Qualitätsbereiche.
«Führt man die analytische Reduktion der Sinnesmannigfaltigkeit konsequent weiter, so gelangt man schließlich zu Elementen, die begrifflich nicht weiter analysierbar sind, also rein phänomenalen Charakter besitzen. Es sind dies die sogenannten einstelligen Elemente der Sinneserlebnisse, z. B. das Erlebnis Rot. Die Sinnesphysiologie als experimentelle Wissenschaft unterscheidet sich nun von der Phänomenologie vor allem dadurch, dass sie diese phänomenalen Grundgegenstände nicht nur begrifflich aus der Sinnesmannigfaltigkeit extrahiert, sondern sie mittels entsprechender Versuchsanordnungen auch experimentell möglichst rein darstellt und die Bedingungen ihres Auftretens untersucht. In den ‹künstlich› erzeugten, rein phänomenalen Objekten der allgemeinen Sinnesphysiologie haben wir also einen Fall vor uns, in welchem der erkenntnistheoretische Grenzbegriff der reinen Wahrnehmung praktisch realisiert wird.»5
Ein Ergebnis dieser phänomenologischen Vorgehensweise ist die Auflösung, das Verschwinden der gegenständlichen Welt, und das Erstehen neuer Welten: einer Welt der Tasterlebnisse – und nur der Tasterlebnisse; einer Welt der Gerüche – und nur der Gerüche; einer Welt der Geschmackserlebnisse – und nur der Geschmackserlebnisse; einer Welt der Farben sowie von Licht und Dunkelheit – und nur der Farben sowie des Lichts und der Dunkelheit; und einer Welt der Töne – und nur der Töne.
Ein Vorgehen, bei dem methodisch dasjenige thematisiert wird, was die einzelnen Sinnesbereiche an spezifisch qualitativem Erlebniswert zeigen, ist von Erwin Straus als «Ästhesiologie» bezeichnet worden.6 Auf ihrem Boden ergibt sich für die moderne, erkenntniskritisch ausgerichtete Sinnesphysiologie (u.a. Hensel, Reenpää, Husserl, Steiner, König u. a. m.) die Möglichkeit, die einzelnen Sinne als Modalbezirke zu begreifen: «Die Modalität ist eine mehrstellige Eigenschaft, die eine ganze Gruppe von Sinneserlebnissen zu einem Modalbezirk verbindet. Dabei können wir aufgrund von Ähnlichkeits- und Unähnlichkeitsbeziehungen verschiedene Modalbezirke abgrenzen: die Sehmodalität, die Hörmodalität, die Bewegungsmodalität, die Tastmodalität, die Geruchsmodalität, die Geschmacksmodalität – um nur eine Auswahl zu nennen. […] Was die Modalbezirke voneinander sondert, ist ihre phänomenale Verschiedenheit. Wir sind uns ohne Weiteres darüber klar, ob ein Sinneserlebnis zum Bereich des Gesichts gehört oder zum Bereich des Gehörs. Ferner ist es evident, dass die verschiedenen Elemente eines Modalbezirks eine gewisse Ähnlichkeit besitzen, welche sie zu einer Teilmannigfaltigkeit – eben der betreffenden Modalität – verbindet. Eine gesehene Farbe und eine gesehene Räumlichkeit sind sich darin ähnlich, dass beide zum Modalbezirk des Gesichts gehören und nicht zu einem anderen Sinnesbereich. […] Man kann daher sagen, dass es in erster Linie die Qualitäten sind, welche die verschiedenen Modalbezirke konstituieren und ihnen das spezifische Gepräge geben.»7
Die Sinneserlebnisse haben unverwechselbare und spezifische Qualitäten, die in ihrer Gesamtheit die Sinnesmannigfaltigkeit darstellen. Diese phänomenale Struktur lässt sich aufgrund ihrer qualitativen Wesensinhalte beschreiben, in ihren gegenseitigen Verhältnissen untersuchen und begrifflich darstellen, ohne den Bereich des sinnlich Gegebenen zu überschreiten. Dies sei am Beispiel der Farben verdeutlicht: die Farbqualitäten lassen sich rein phänomenal nach ihren Wesenseigenschaften beschreiben und nach ihren unmittelbar erlebten Verwandtschafts- und Komplementaritätsverhältnissen in eine bestimmte Ordnung bringen, z. B. den Goethe’schen Farbenkreis, die Runge’sche Farbenkugel oder neuere Systeme des Farbendreiecks und Farbenkörpers. Gegenüber der Objektivität oder Subjektivität der Farben ist diese Farbenordnung völlig invariant; sie gilt unabhängig davon, ob es sich um Körperfarben, Lichtfarben oder Nachbilder handelt. Es liegt in unserer freien Entscheidung, dass wir die Wahrnehmungsdimension nicht nur – wie im natürlichen Alltag zumeist – auf die Dinge und die an ihnen als Eigenschaften auftretenden Sinnesqualitäten richten können, sondern, unter Abstraktion von den Dingen, auf die Qualitäten selbst.
«Wir können darüber hinaus im sinnesphysiologischen Experiment diese Qualitäten in reiner Form zum Erlebnis bringen. Hier zeigt sich eine spezifisch menschliche Fähigkeit des Wahrnehmens, die über die naturgegebenen Lebenszusammenhänge hinausreicht. Auf diesem Wege gelangen wir schließlich zu elementaren, nicht weiter analysierbaren Erlebnissen. Es sind dies die sogenannten einstelligen Elemente der Sinnesmannigfaltigkeit, z. B. das Erlebnis der Farbe Rot. Was Rot ist, kann man nicht definieren und deshalb auch nicht mit Worten sagen; man kann es nur erleben, und wer diese Erlebnisfähigkeit nicht besitzt, etwa weil er farbenblind ist, dem ist auch mit Definitionen nicht zu helfen.»8