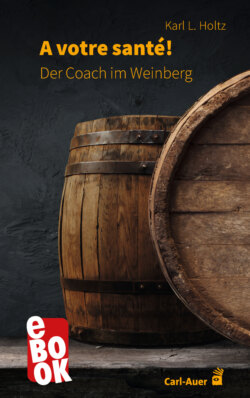Читать книгу A votre santé - Karl L. Holtz - Страница 8
Was lässt sich über Wein und Coaching sagen? Was ist denn Wein und was ist eigentlich ein Coach?
ОглавлениеEine überflüssige Frage? Der Weinliebhaber wird sagen: »Sicher nicht, denn ich möchte beim Kauf einer Flasche Wein Hinweise darauf haben, auf was ich mich einlasse.« Und in der Regel weiß er, welche Informationen für ihn wichtig sind. Er möchte sicher sein, dass in der Flasche, deren Etikett ihm Wein verspricht, auch tatsächlich Wein enthalten ist. Und wenn das Produkt einmal nicht den Vorschriften und den damit verbundenen Erwartungen entspricht, wird er sich zu Recht getäuscht fühlen und erwarten, dass ein bewusstes Abweichen von den wohldefinierten Kriterien auch entsprechend sanktioniert wird.
Es kommt weniger darauf an, wie kreativ das Etikett gestaltet ist, sondern eher darauf, wie der Wein ausgebaut wurde. Für die Geschmackserwartungen kommt es weniger darauf an, wie vollmundig oder blumig der Wein genannt wird, sondern darauf, welche Rebsorten oder auch welcher Alkoholgehalt enthalten sind. Es gibt viele Kriterien, nach denen sich ein Weinkenner richten kann, einige Informationen dazu sind auf der Flasche enthalten, andere kann man online erfragen, wieder andere kann er mit dem Weinhändler seines Vertrauens diskutieren.
Natürlich wird es Abweichungen geben: Weine müssen nicht immer sortentypisch sein, ein hoher Alkoholgehalt kann durch die anderen Inhaltsstoffe des Weines eingebunden sein. Ein kreativer Ausbau kann zu überraschend interessanten, wenn auch nicht erwartungskonformen Ausprägungen führen. Aber: Im Allgemeinen kann man sich auf die Auszeichnungen verlassen, wenn man sich ein wenig mit der Materie vertraut gemacht hat.
Das bedeutet nun nicht, dass eindeutig benannte Weine auch allen Kennern gleich schmecken müssten. Es gibt Vorlieben, Vorerfahrungen und Kontexte, welche die Beurteilung des Weins sehr stark beeinflussen. Und es gibt natürlich subjektive Voraussetzungen, die auch bei Weinkennern, etwa bei Blindverkostungen von Experten, zu sehr unterschiedlichen Aussagen hinsichtlich der Qualität führen. Dazu später mehr.
Die Frage danach, was denn eigentlich ein Coach ist, lässt sich demgegenüber viel schwerer beantworten. Wenn wir sagen, ein Coach ist jemand, der coacht, dann stimmt das zunächst, ist aber eine Tautologie. Und selbst, wenn wir jetzt wüssten, was Coaching ist, müssten wir uns darauf einigen, ob jeder, der coacht, ein Coach ist, oder ob wir unter dieser Bezeichnung für unsere Zwecke den professionellen Coach meinen, also jemanden, der zu dieser Tätigkeit eine spezielle – möglichst wissenschaftlich fundierte – Qualifikation mitbringt und diese auch in einem professionellen Rahmen umsetzt. Ein Coach wäre also jemand, der unter bestimmten Voraussetzungen in einem näher zu definierenden Kontext coacht.
Ansonsten könnten wir in freier Abwandlung der Aussage »Intelligenz ist das, was ein Intelligenztest misst« zunächst einmal festhalten: Coaching ist das, was ein Coach tut. Und so, wie die Aussage zur Intelligenz darauf verweist, dass es unzählige Theorien und Definitionen von Intelligenz gibt, die jeweils in dem zugehörigen Intelligenztest erfasst werden, so könnten wir uns damit zufriedengeben, dass es eine Vielzahl von Coachinganlässen und -strategien gibt, die durch den jeweiligen Coach und seine Theorie von Coaching vorgegeben werden.
Aber ebenso, wie die obige Aussage zur Intelligenz hinterfragt werden muss, ist natürlich auch die Tätigkeitsbeschreibung eines Coachs nicht willkürlich. In der Intelligenzforschung hat man sich auf eine Reihe übereinstimmender Kernthesen einigen können, zur wissenschaftlichen Standortbestimmung des Berufsbildes Coach ist eine Zusammenschau wesentlicher Merkmale dringend erforderlich.
Die gegenwärtige Situation ist dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens so viele Coachingkontexte wie Weinlagen zu geben scheint: Frisurencoachs, Tanzcoachs, Lerncoachs, natürlich den Sportcoach, den Gesundheitscoach, den Mentalcoach usw.
Jede Definition über das, was Coaching ist, ist ja nicht nur ein Streit über Worte, jede Definition ist als Aussage darüber zu verstehen, was zu dem Begriff gehört und was nicht, welche Merkmale unabdingbar und welche marginal sind. Definitionen sind also als Versuch zu verstehen, eine Theorie darüber zu formulieren, was denn eigentlich der Fall ist. Diese Definitionen sind per se nicht richtig oder falsch, sie sind als Einladungen von Definierern oder Theoretikern zu verstehen, empirische Sachverhalte mal unter einer bestimmten Fragestellung und in dieser Zusammenschau zu sehen. Manchmal – ja: häufiger, als man annehmen sollte – sind solche Einladungen auch werbewirksame Angebote, gewissermaßen zu einer (theoriegeleiteten, erkenntnisleitenden?) Tupperware-Veranstaltung. Die Wissenschaftstheoretiker nennen so etwas dann interessenbezogene, persuasive Definitionen (Gabriel 2004). Diese sind im Übrigen in der Definition von Weinen seit einiger Zeit untersagt (»Gesundheitswein«, »für Diabetiker geeignet« etc.).
Gesundheitsbezogene Angaben müssen bei alkoholischen Getränken mit Inkrafttreten der sog. Health-Claims-Verordnung (HCVO) entfallen. Für Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent dürfen nach Art. 4 Abs. 3 der HCVO überhaupt keine gesundheitsbezogenen Hinweise angegeben werden.
Bei all der Vielfalt unterschiedlicher Sorten und Ausbaumethoden gibt es für Wein ein zentrales Definitionsmerkmal:
Wein ist ein Getränk, das von Früchten der Weinrebe stammt und laut EU-Gesetzgebung mindestens 8,5 Volumenprozent Alkohol enthält. Hierzu zählen auch Variationen wie Likörwein, Schaumwein und noch nicht ausgegorene Neue Weine (Federweißer), nicht aber per definitionem Obstweine (weinähnliche Getränke) oder weinhaltige Getränke (Weinschorle, Sangria). Getränke, die aus stärkehaltigen Grundstoffen vergoren werden (z. B. Reiswein), dürfen noch nicht einmal als weinähnlich bezeichnet werden.
Wenn man also von Wein spricht, weiß man auch, worüber man spricht. Und das Wissen um einen Sachverhalt soll förderlich für den tagtäglichen Diskurs sein.
Gibt es nun auch solche zentralen, unabdingbaren, für eine Definition des Coachings notwendigen Merkmale – möglichst solche, die auch von anderen Formen unterstützenden Handelns verschieden sind? Wie unterscheidet sich Coaching von Supervision, Beratung, Therapie oder Begleitung? Ist Coaching dasselbe wie Beratung und Supervision (als Beratung im beruflichen Kontext), nur teurer, weil u. a. Führungskräfte und Experten am Werk sind? Und wenn der Vater seinen Sohn als Lerncoach coacht, kann er das eigentlich nur tun, wenn er in seinem Zögling eine künftige Führungskraft sieht? Denkt das Bildungsministerium Baden-Württemberg daran, im Ländle eine künftige Führungselite und Experten zu bilden, wenn sie Lehrern die Funktion von Lerncoachs zuweist?
Gibt es dann, wenn man sich auf eine trennscharfe Definition des Coachings geeinigt hat, in Analogie zur Weinsystematisierung auch so etwas wie
▸ Coaching im weiteren Sinne
▸ coachinghaltige Strategien
▸ coachingähnliche Strategien und dann noch
▸ Kriterien, wann Interventionen nicht mehr als Coaching bezeichnet werden sollten?
Und vor allem ist die Frage interessant: Warum gibt es diese klaren Kriterien beim Wein, aber noch nicht beim Coaching?
Man kann vermuten, dass es mit der längeren Tradition des professionellen Weinbaus zusammenhängt. Wird ein Metier professionell betrieben, hat der Erzeuger auch ein Interesse daran, auf dem Markt zu bestehen. Und das schafft man dadurch, dass man sich qualitativ abgrenzt, also die Unterschiede zu anderen betont. Diese Betonung der Unterschiede hat im Weinbau sicherlich dazu geführt, dass Qualitätskriterien diskutiert, Unterschiede analysiert wurden und mit dieser Diskussion auch eine wissenschaftliche Erforschung relevanter Merkmale einsetzte. Das Ergebnis dieser langen Tradition kann sich sehen lassen: Aus dem unspezifischen Getränk Wein wurden qualitativ unterschiedliche Weine, Tafelwein, Landwein, Qualitätswein einerseits, aber auch eine selbstbewusste Darstellung unterschiedlicher Qualitäten in den verschiedenen Anbauzonen, die nebeneinander bestehen konnten und Angebote für individuelle Vorlieben und Anlässe machten. Aus dem Entweder-oder wurde so nach und nach ein Je-nachdem. Natürlich spielten hier auch geschicktes Marketing und ein Bestreben nach Manipulation des Publikumsgeschmacks mit. Mosel- und Bordeaux-Weine sind unvergleichbar und können unvergleichlich gut sein, beide beziehen sich auf notwendige Merkmale, was einen guten Wein ausmacht. Die wissenschaftliche Begleitung der Weinwirtschaft hat entscheidend zu dieser kontrollierten Vielfalt beigetragen, aber man muss sich dessen bewusst sein, dass es auch in der Wissenschaft keine »unbefleckte Erkenntnis« (Nietzsche) gibt.
Jede Definition will ja nicht die wirkliche Wirklichkeit beschreiben, sie ist vielmehr als eine Einladung eines Wissenschaftlers zu verstehen, ihm bei seiner Zusammenschau empirischer Sachverhalte, seiner Theorie, zu folgen. Diese Definition und die damit verbundene Theorie ist ein möglicher Ordnungsversuch, bei dem sie sich nun daran beweisen muss, ob sie die gemeinten Phänomene auch praktikabler erklären und vorhersagen kann. Definitionen sind also nicht richtig oder falsch, sie sind mehr oder weniger nützlich oder viabel. In der Anfangszeit der Unterschiedsbildung sind die Reaktionen der Fachwelt zunächst heftiger und pointierter – ich erinnere mich an die frühen Auseinandersetzungen zwischen Psychoanalyse und Verhaltenstherapie. Nach und nach geht man aber bereitwilliger auf die Unterschiede ein und versucht, diese für die Präzisierung eigener Denkmodelle zu nutzen. Bei aller Konzilianz anderen Modellen gegenüber darf aber nicht vergessen werden, dass die Theorienbildung – auch die eigene – stets von mehr oder weniger impliziten Interessen geleitet wird. Manche Akzentuierungen von Qualitätsunterschieden bei Weinen stellen sich bei genauerer Betrachtung als übertrieben dar. Im Laufe der Zeit und mit zunehmender Kennerschaft weiß der Konsument aber, solche Übertreibungen zu relativieren.
Eine ähnliche Entwicklung wie in den Anfangsjahren der Qualitätsdiskussion im Weinbau kann man auch auf dem relativ jungen Feld der Coachingbranche beobachten. Die Definitionen einzelner Coachingverbände lassen dieses interessengeleitete Handeln erkennen. Der Kuchen – um mal ein anderes Genussmittel heranzuziehen – muss ja erst noch verteilt werden.
Beginnen wir mit der Definition des Round Table, eines Zusammenschlusses verschiedener führender Coachingverbände.
Coaching als bestimmtes Beratungsformat wird zunächst von der Expertenberatung abgegrenzt (im angloamerikanischen Raum wird eine Unterscheidung zwischen Counseling und Consulting getroffen, zwischen Experten und Prozessberatung; in unserem Sprachraum wird auf Anregung der DGfB1 u. a. zwischen informativer und reflexiver Beratung unterschieden):
» Im Unterschied zur reinen Fachberatung versteht sich Coaching als eine Form der reflexiven Beratung, in der die Ressourcen des Klienten erschlossen werden und der Klient zur selbständigen Aufgabenbewältigung befähigt wird. Coaching setzt daher die Bereitschaft zur aktiven Beteiligung des Klienten voraus – auch dann, wenn die Beratungsleistung durch Dritte (insbesondere durch den Arbeitgeber) finanziert wird« (Roundtable Coaching 2014, S. 2).
Ein Unterschied zur (reflexiven) Beratung wird also nicht gemacht. Unterschieden und somit als nicht dazugehörig definiert wird lediglich Expertenberatung, Weiterbildung und Psychotherapie genannt. Das ist ein großes Stück aus dem Kuchen sozialer Unterstützungssysteme. Wenn wir eine imaginierte Getränkekarte bemühen, ist nahezu alles Wein, drei weinähnliche Getränke werden in Abgrenzung genannt. Eine solche Aufteilung durch den Round Table ist nachvollziehbar, wird doch im Folgenden auch auf die Notwendigkeit verwiesen, eine qualifizierte Ausbildung anzustreben:
» Dem Roundtable der Coachingverbände ist es ein besonderes Anliegen, die Qualifizierung zur Ausübung des Coachings im Kontext vergleichbarer Qualifizierungen für andere gesellschaftlich anerkannte Angebote reflexiver Unterstützungsdienstleistungen (wie etwa Erziehungsberatung, Psychotherapie, Berufs- und Laufbahnberatung, Supervision, Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Organisationsberatung) zu verorten. Auch die Differenz zu Qualifizierungsangeboten im Bereich vorrangig verfahrensbasierter Angebote (wie etwa Mediation oder Moderation) ist zu markieren« (ebd., S. 3 f.).
Hier tauchen nun wieder weitere Unterstützungssysteme auf, die verwirren mögen, weil sie nun doch zu den »reflexiven« gehören, aber diese Unterschiede, die einen Unterschied machen sollten, müssen wohl bei der Konzeption der Ausbildungsgänge thematisiert werden. Hier sehe ich noch einige Schwierigkeiten, gehört doch zu den ethischen Imperativen des Round Table, dass der »einem humanistischen Menschenbild verpflichtete« Coach »ein demokratisch-pluralistisches Gesellschaftsverständnis« haben und »die gesellschaftlichen und religiösen Deutungskonzepte des Klienten« achten soll. Gleichzeitig distanziert er »sich öffentlich von allen Lehren oder ideologisch gefärbten, sektenhaft ausgerichteten oder manipulativen und dogmatischen Bildungsangeboten« (ebd.). Es ist löblich, hier noch einmal an die Neutralitätspflicht des Beraters zu erinnern, insofern sie den aktuellen Coachingprozess betrifft. Ob eine solche unbefleckte Erkenntnis allerdings auch für eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung (»Lehren«) und für öffentliches (zumeist ideologisch beeinflusstes) Handeln gilt, ist fraglich – einmal abgesehen von den ständigen, und dann noch öffentlichen, Auseinandersetzungen mit Auftraggebern im Profit- und Non-Profit-Bereich.
Der DBVC2, Mitglied des Round Table und nach eigenem Selbstverständnis der führende Verband im deutschsprachigen Raum, der sich auf Business Coaching und Leadership fokussiert (dies wird im amerikanischen Urverständnis vom Private Coaching unterschieden), grenzt das Coaching naheliegenderweise auf sein Klientel ein. Er versteht darunter
»die professionelle Beratung, Begleitung und Unterstützung von Personen mit Führungs-/Steuerungsfunktionen und von Experten in Unternehmen/Organisationen. Zielsetzung von Coaching ist die Weiterentwicklung von individuellen oder kollektiven Lern- und Leistungsprozessen bzgl. primär beruflicher Anliegen.
Als ergebnis- und lösungsorientierte Beratungsform dient Coaching der Steigerung und dem Erhalt der Leistungsfähigkeit. Als ein auf individuelle Bedürfnisse abgestimmter Beratungsprozess unterstützt ein Coaching die Verbesserung der beruflichen Situation und das Gestalten von Rollen unter anspruchsvollen Bedingungen.
Durch die Optimierung der menschlichen Potenziale soll die wertschöpfende und zukunftsgerichtete Entwicklung des Unternehmens/ der Organisation gefördert werden« (DBVC 2019, S. 17).
Hier ist Coaching also Beratung, Begleitung und Unterstützung. Aha, denkt der Weinkenner: Beratung ist gewissermaßen der Wein und Coaching ist ein weinhaltiges Getränk. Und er fühlt sich durch die nachfolgenden Ausführungen in seiner Ansicht bestärkt: Zum einen können Expertenberatung und Training bei bestimmten Fragestellungen noch dem »weinhaltigen Getränk Coaching« zugefügt werden, zum anderen lässt sich Coaching auch noch dem Mentoring zuschütten, zum Wohle des Klientels.
Ein weiterer Partner des Round Table, die Deutsche Gesellschaft für Supervision (DGSv), hat sich naturgemäß zunächst schwergetan, Coaching als gleichwertige Beratungsform zur Supervision anzuerkennen, was vor allem
» dadurch außerordentlich erschwert wird, dass der Begriff coaching durch seine unkontrollierte Nutzung weitgehend entgrenzt ist und jeder Abgrenzungsversuch immer auch die Gefahr der Abwertung seriöser und professioneller Beratungsangebote nach sich ziehen kann – sowohl im Coaching wie in der Supervision« (DGSv o. J.).
Und erst, als sich der Verband nach langen, auch inhaltlichen Diskussionen entschlossen hat, sich in Deutsche Gesellschaft für Supervision und Coaching umzubenennen, wird eine Weiterbildung in Supervision und Coaching vorgeschlagen. Weiterhin fällt es jedoch schwer, eine Unterscheidung festzumachen, da Coaching nur den bisherigen Definitionsversuchen angehängt wird:
» Supervision ist ein wissenschaftlich fundiertes, praxisorientiertes und ethisch gebundenes Konzept für personen- und organisationsbezogene Beratung in der Arbeitswelt. Sie ist eine wirksame Beratungsform in Situationen hoher Komplexität, Differenziertheit und dynamischer Veränderungen. Die Beratungsinhalte von Supervision und Coaching sind definiert im Bezugsdreieck von Person, Rolle, Institution/Organisation. Im supervisorischen Prozess geht es besonders um die Reflexion von Erfahrungen, Prozessen und Bedingungen, die Systematisierung komplexer Zusammenhänge, das Verstehen von Strukturen und Prozessen, die Analyse und Klärung/Lösung von Konflikten. Bildungs- und Qualifizierungsprozesse Ziele von Supervision und Coaching sind die Erweiterung der Wahrnehmungs- und Deutungsmöglichkeiten, ein vertieftes Verstehen von Erfahrungen, Ereignissen und Handlungen in ihren vielfältigen Bezügen und Wechselwirkungen, die Erhöhung der persönlichen, sozialen und professionellen Kompetenz insbesondere zur Problemlösung in kritischen Situationen und selbst-bewusstes, kompetentes Handeln« (Positionspapier der DGSv 2019).