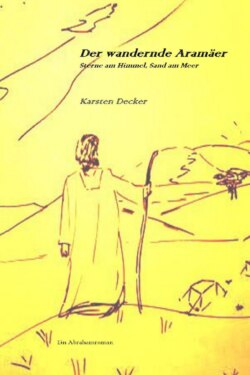Читать книгу Der wandernde Aramäer - Karsten Decker - Страница 3
Kapitel 1: Eine Ur-Geschichte
ОглавлениеNahor war 29 Jahre alt und zeugte Terach und lebte danach 119 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Terach war 70 Jahre alt und zeugte Abram, Nahor und Haran. Dies ist das Geschlecht Terachs: Terach zeugte Abram, Nahor und Haran; und Haran zeugte Lot. Haran aber starb vor seinem Vater Terach in seinem Vaterland zu Ur in Chaldäa. Da nahmen sich Abram und Nahor Frauen. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau Milka, Harans Tochter, der der Vater war der Milka und der Jiska.
Genesis 11, 24 -29
Es war einer jener heißen, ja schwülen Frühlingstage im Nissan am Anfang des sakralen Jahres, an denen man die unerbittliche Hitze des kommenden Sommers schon ahnt, gerade so, wie Gliederschmerzen von kommendem Fieber zeugen. Kentaja schlenderte, mehr die Füße schiebend als gehend, die verwinkelten Gassen der Altstadt entlang. Sie musste immer wieder stehen bleiben und tief Luft holen. War es wegen der stickigen, schwülen Hitze, die in diesem Jahr früher als sonst ihren Einzug in Ur gehalten hatte, durchtränkt von den süßlichen Aromen der Gewürze, Tees und Kräuter des Basars, oder war es, weil sich das Kind in ihrem Leib zu heftig und unablässig bewegte? Ja, es war bald an der Zeit. Sie hatte bisher dank ihrer beachtlichen Leibesfülle vor allen verheimlichen können, in welchen Umständen sie war. Doch bald, zu bald, würde sie eine Entscheidung treffen müssen. Sie wusste, wie es den Kindern in der Sklaverei erging. Schemkahiri würde es ihr entreißen, sobald es stark genug zum Arbeiten war oder den richtigen ›Marktwert‹ hatte. Hatte sie nicht am eigenen Leibe erfahren, und trug sie den fleischlichen Beweis dafür nicht nun unter dem Herzen, wie ruchlos und ohne Mitleid er war? Unter ihm würde ihr Kind nie spielen können, keine Zeit zum Lernen, schon gar nicht die ägyptische Sprache und Schrift, keine Freundschaften, und nie, ja nie die Freiheit atmen.
Diese Gedanken gingen ihr noch durch den geschorenen Kopf, als sich vor ihr eine Menschentraube bildete. Was sie zwischen den sich reckenden Köpfen und Schultern hindurch erblickte, ließ sie innerlich erbeben. Sicher, schon oft hatte sie mit angesehen, wie die strengen Sklavenaufseher die Peitsche zur Hand nahmen, doch die Brutalität der Schläge, noch dazu auf den Rücken dieses Jungen - er mochte kaum 14 ägyptische Jahre alt sein - waren dennoch auch für sie ein Schock. Ja, so sieht sie aus, die Kindheit eines versklavten Menschen. Der Junge, der dort so misshandelt wurde, war allerdings kein Ägypter wie sie, das sah sie gleich, eher aus Kleinasien, die gewölbte, hoch aufsteigende Stirn, der hellere sandfarbene Ton seiner Haut, die langen, geraden Arme und Beine. Doch war das von Bedeutung? War man erst einmal versklavt, spielte die Herkunft, die Sprache, die Religion, die Rassen, der Stamm, all die Dinge, die uns sonst unterscheiden und Identität verleihen, keine Rolle mehr. Wie sie diese Demütigungen der Sklaventreiber hasste. Dieser Junge war sicher vom Feldzug vor 8 Jahren gegen die Hethiter oder gegen Gomer und Meschech mitgeschleppt worden. Immerhin, dann hatte er seine frühe Kindheit unbesorgt erlebt, ja hatte er in Freiheit gelebt, richtig gelebt. Doch das ist Vergangenheit. Es hat keinen Sinn, dem Einst hinterher zu weinen. Die fest verschlossenen Bronzeringe an Ihren Füßen wurden noch schwerer. Ja, obgleich sie es sich doch gerade verboten hatte, erinnerte sie sich nun ihrer eigenen Kindheit, einer Kindheit in Freiheit, spielend an den Ufern des Nils, badend, mit anderen Kindern die selbst gebauten Spielzeuge benutzend. War denn niemand hier, der helfen konnte? Dieses barbarische Volk der Chaldäer. Ist der Sieger denn immer im Recht, auch wenn er das Recht mit Füßen tritt? Und heißt denn im Recht sein etwa, dass ich tun und lassen kann, was ich will? Wo sind Werte und Erziehung, der Stolz eines Volkes, wenn es wegsieht, die Augen verschließt? Nicht, wie wir unsere Freunde umwerben, sondern wie wir unsere Feinde behandeln, zeigt, ob unsere Werte es wirklich wert sind, sie anderen Völkern zu bringen. Wie hatte man die Kultur der Chaldäer in Ägypten gelobt, ja verglichen mit denen des fernen Asien, oder auch mit Nubien und Ägypten selbst. Ist denn das ein großes Volk, das Schlachten gewinnt, Völker unterwirft, Prachtbauten errichtet, immer für ein höheres Ziel, eine bessere Zukunft? Befreiung von Tyrannei und Diktatur, nur um unter anderem Namen ausgebeutet und geschunden zu werden. Und die »befreiten« Völker werden tatsächlich von allem befreit, mitsamt den Schätzen, die sich nur irgendwie requirieren lassen: Und immer werden diese sich bereichernden Reiche für sich in Anspruch nehmen, die Welt voran gebracht zu haben.
Noch während sie diese Schelte in ihrem Innern austeilte, musste sie eingestehen, dass in der Rückschau Ägypten nicht anders gewesen war, ja schon vor Jahrhunderten hatten sie die ersten der berühmten Pyramiden auch mit Fremdvölkern für längst vergangene Dynastien gebaut, die sich damals für ewig hielten. Noch ganz in Gedanken, als sie sich gerade angewidert umdrehen wollte, stockte ihr der Atem. Sollten die Götter sie gehört haben, oder war es Zufall?
»Halte ein!« schallte es über die Marktgasse. Ein Mann griff ein, nein, nicht irgendein Mann, kein Sklave, kein Knecht, kein Gefreiter, sondern ein freier Bürger der Stadt, das sah sie sofort, und ein wohlhabender dazu. Die guten Gewänder, teurer Stoff aus den nördlichen Provinzen, Goldketten und Ringe. Mit sicherem und hartem Griff hatte er das Handgelenk des Aufsehers ergriffen, so dass die Peitsche mitten im Schlag erstarb.
»Mein Freund«, sagte er nun mit dieser tiefen, ruhigen Stimme, die tatsächlich um Freundschaft, oder wenigstens gutwilliges Hören warb, »er ist ein Mensch! Es ist ein Kind! So halt’ doch ein! Es ist genug!«
»Wer bist Du, dass du mich maßregelst? Dieser Lump, Abschaum, Sohn eine Natter, hat es gewagt, den Stand am Basar zu verlassen. Alles könnte weg sein, gestohlen, er hat den Hausstand in Gefahr gebracht, die Hand, die auch ihn ernährt, ein dreckiger, kleiner Sklave. Und was geht es dich an? Mach, dass du weiterkommst! Ja, ihr reichen Herren, Viehzüchter, Viehhändler, oder sollte ich sagen Viehdiebe‹ vergesst, wer den Wohlstand erarbeitet.« Kaum hatte er dies gesagt, versuchte er mit der Faust der anderen Hand wieder auf den Knaben loszugehen, wohl in der Hoffnung, seine Worte hätten Eindruck gemacht.
»Du schlägst diesen Menschen nicht! So wahr ein Gott im Himmel und auf Erden waltet, ich lass das nicht zu!«
»Willst du sagen, ich sei gottlos? Ich warne Dich! Du schadest Dir! Es gibt Gesetze! Und, und«, während er nach Worten rang, hellte sein Gesicht plötzlich auf, nur um sich zur zynischen Grimasse zu verziehen: »ja, nun kenne ich dich, du bist Terach Ben Nahor! Glaub’ bloß nicht, dein Name kann dich schützen. Ich werde dich verklagen, heute Abend noch, im Tor, alles werde ich berichten, wenn die Abendkühle kommt. Du wirst sehen! Schiltst mich gottlos? Ich werde es dir zeigen. So jemand wie du sollte rausgeschmissen werden aus Ur. Geh doch nach Gomer, wenn du dieses Pack so magst, oder besser noch, bleib auf dem Weg liegen. Dann kann dein Gott im Himmel und auf Erden‹ sich deiner und deines Sohnes annehmen. Geh den Euphrat hinauf, oder nach Kanaan, wenn du regieren willst. Der König bracht so tüchtige Leute wie dich in der Provinz; als Puffer, versteht sich, egal wer gerade vormarschiert: Ägypter, Sumerer, Assyrer, Hethiter.«
Erst nun wurde Kentaja gewahr, dass hinter jenem Bürger mit Namen Terach Ben Nahor ein etwa fünfjähriger Junge stand. Der Junge hatte alles mitangesehen, und nun, da sich der Sklaventreiber in das Wortgefecht einließ, hielt er dem geschlagenen Jungen eine kleine braune Tonflasche hin. Hastig sog der Sklave daran.
»Ich bin Abram Ben Terach. Wie heißt Du?« fragte er den am Boden liegenden Knaben.
»Meschek, aber Ischkatar, mein Besitzer, nennt mich Prentaj. Danke.«
»Warum hast du den Stand deines Herrn verlassen?«
»Ich bin einem Dieb hinterhergeeilt, der einen Topf gestohlen hat. Aber danach hat Ischkatar mich gar nicht gefragt. Auch hatte ich meinen Freund vom Nachbarstand gebeten, ein Auge auf unsere Ware zu werfen. Ischkatar ist so jähzornig. Er ist gefährlich.«
Mittlerweile hatte sich die Menschtraube um die Vier weiter vergrößert wie eine gemeine Geschwulst. Kentaja wurde zurückgedrängt. In solchen Momenten standen die Bürger vorne, und nie im Leben hätte sie es gewagt, nicht zurück zu weichen und Platz zu machen. Sklaverei macht weise und lehrt Demut.
Sie hatte auch genug gesehen. Sie hatte den Namen Terach Ben Nahor schon vorher gehört, abends an den Sklavenfeuern, wenn man ihnen die kurze Nacht als Ruhe gönnte. Alle sprachen von seinem Haus. Er musste einer der einzigen sein, der seine Sklaven ohne Ketten und Halsringe laufen ließ, ja ihnen sogar ein wenig Eigentum gewährte wie den Hörigen, den Knechten und Mägden. Die Glücklichen aus seinem Hause kamen oft abends und brachten extra Portionen Fleisch, Brot, Bier und andere Dinge. Im Hause Terachs gewährte man selbst Sklaven Rechte, Familien wurden nicht auseinandergerissen, und daher war sein Gesinde ihm treu ergeben. Ja, er hatte einen gewaltigen Hausstand, über 200 Sklaven, Knechte und Mägde, alle treu ergeben, und sogar in Waffentechnik geschult. Kein Wunder, dass dieser Ischkatar Angst hat, allein der Name Terachs würde ihm Recht geben.
Könnte sie doch in diesem Hause leben! Aber ihr Herr würde sie nie gehen lassen. Sie kochte einfach zu gut. Doch, vielleicht, vielleicht war da eine Hoffnung, die weit über sie hinausreichte, vielleicht gab es ja diesen »Gott des Himmels und der Erden« wie Terach ihn nannte, und würde auch sie hören, die unbedeutende Kentaja aus dem Hause Rehoteps, aus Ägypten geraubt, dachte sie. Wenn nur alles gut geht!
»Stimmt das«, fragte Abram seinen Vater etwas später, als sie auf dem Heimweg durch die belebten Gassen waren, »wird er dich verklagen? Wirst du bestraft werden?«
»Nun, er hat es in der Öffentlichkeit gesagt, das heißt, ich muss zumindest heute Abend im Tor erscheinen. Falls er dort die Klage erhebt, werde ich mich verteidigen, und dann werden wir sehen. Mach dir keine Sorgen. Zwischen angeklagt werden und verurteilt werden besteht ein großer Unterschied. Ich glaube nicht, dass ich irgendetwas zu befürchten habe.«
Den Rest des Weges gingen sie wortlos nebeneinander her. Mehr als einmal wollte Abram etwas sagen, doch er verbiss es sich. Erst kurz vor dem Haus sagte Terach plötzlich: »Ich bin stolz auf dich!«
»Warum?« fragte Abram.
»Nun, du hast viel Mut gezeigt. Du hast dem Jungen deine Flasche gegeben. Du bist ganz ruhig geblieben, und hast das gemacht, was dein Herz dir gesagt hat, unabhängig von den vielen Leuten. Das war mutig. Darum bin ich stolz auf dich.« Er legte seinen Arm um Abrams Schulter und zog ihn liebevoll an sich heran.
»Ich bin auch stolz auf dich!« sagte Abram nun, und lächelte. Er selber war sich nicht so mutig vorgekommen. Sein Herz hatte ihm bis in den Hals hineingeschlagen. Wäre der Vater nicht genau neben ihm gewesen, er wäre sicher davongelaufen.
Das Haus lag am westlichen Stadtrand, ein wenig auf einer Anhöhe, sicher vor den Überschwemmungen, die im Frühjahr mitunter die Altstadt heimsuchten. Es war eigentlich mehr eine gewaltige Wohnanlage als ein Haus, mit 6 Ellen hohen Mauern, einem großzügig angelegtem doppelstöckigem Haupthaus mit Zisterne und eigenem kleinen, mit glasierten Kacheln bedeckten Innenhof mit einer aus Balken gezimmerten Galerie, hinter der die Schlafgemächer der Familie und Gästezimmer lagen. Gleich am Eingang war ein kleiner Raum mit ständig gefüllten Waschbecken, um sich den Staub der Straße von Füßen, Händen und Haupt zu waschen. Eine gewaltige Steintreppe führte hinauf auf die Galerie, darunter waren die Latrinen untergebracht. Im großen, mit schönem Pflaster ausgelegtem Hof gab es zwei weitere Brunnen, einen für die Küche und das Haus, den anderen für die Viehtränke. Zusätzliche Unterkünfte für Mägde und Knechte zogen sich entlang der Mauer zum Innenhof hin. Leitern standen im Hof an die Hauswände gelehnt, die es ermöglichten, wenn nötig, die flachen Dächer zu erklimmen, um von dort die Mauer als Wehranlage zu nutzen. Alles war aus gebrannten und glasierten Ziegeln erbaut, nicht nur die sonnengetrockneten Ziegel, wie bei den ärmeren Häusern. Das Haupttor, das sich öffnete, bevor Terach und Abram klopfen mussten, war aus starken Holzplanken gezimmert, in drei Lagen für zusätzliche Stabilität, und konnte ohne Frage jeder Räuberbande und eventuell sogar einer kleineren Armee standhalten. Und so rutschte es aus Abrams Mund, als sie eintraten: »Hier sind wir sicher!«
Doch Terach schüttelte den Kopf: »Mauern und Riegel, Waffen und Gewalt geben dir nie wirkliche Sicherheit, allenfalls eine Illusion von Sicherheit. Nichts ist für die Ewigkeit gebaut. Reichtum kommt und vergeht, Reiche entstehen und fallen, Häuser werden gebaut und brechen ein. Wenn du Sicherheit suchst, dann vertraue nicht auf das von Menschen Geschaffene noch auf Menschen, sondern auf den, der alles in Händen hält.«
»Ist das dieser Gott des Himmels und der Erde?« fragte Abram, »und welcher ist das? Gibt es nicht viele Götter. Meinst du Maduk und seine 49 Dämonen? Meinst du vielleicht Sin den Mondgott, Schamasch, den Sonnengott, Ischtar Anunitu den Venus Gott oder die Schöpfungsmutter? Wir haben darüber im Unterricht gehört. Sie ist wie ein böser Drache, der Dämonen ausspeit, um uns im Chaos zu versenken. Wie soll ich da Sicherheit finden?«
»Du bist so klug für dein Alter, Abram. Nein, von diesen Göttern erwarte keine Hilfe. Ich weiß es nicht genau, aber umso mehr ich darüber nachdenke, kann es mit den Göttern nicht wie mit den Menschen sein. Nein, nur ein Gott, der wirklich unangefochten ist, kann ein Gott heißen. Dann kann es aber nur einen Gott geben, da alle anderen Götter doch irgendwie seine Macht begrenzen würden, oder etwa nicht? Und solch ein Gott ist dann sicher nicht abhängig von Menschen, die sein Abbild schaffen, die Tempel errichten und mit Opfergaben versuchen, ihn zu bestechen. Das Leben ist kein großer Basar, Gott ist kein Krämer, der seinen Preis hat. Wenn du älter wirst, wirst du verstehen, was ich meine.«
Sie waren eingetreten, und einer der Knechte hatte ihnen eine Schüssel Wasser gebracht, in der sie nun die von den Sandalen befreiten Füße wuschen, um den trockenen Staub der Straße loszuwerden. Unter einem luftigen Baldachin war ein Lager gerichtet, und frisches Obst, Feigen, Äpfel, Datteln und Trauben lagen auf großen, aus Silber getriebenen und reichlich verzierten Tabletts. Abrams älteren Brüder Nahor und Haran lagen schon auf den Kissen und sprangen auf ihre Füße, als der Vater kam.
»Ach, bleibt doch sitzen!« sagte Terach, doch gleichzeitig verriet sein Gesicht, dass er stolz auf die gute Erziehung seiner Söhne war. Milka, Nahors Frau, brachte einen Krug mit erfrischendem, kaltem Tee und einige Becher. Lot, gerade sechs chaldäische Jahre alt geworden, folgte ihr. Er war Harans Sohn. Seine Mutter war, wie das leider viel zu häufig war, bei der Geburt gestorben. Er freute sich, Abram zu sehen.
»Abram, komm spielen!« rief er, und Abram sprang auf und die beiden waren verschwunden. Terach ließ sich nieder und während sie sich erfrischten, erzählte er seinen erwachsenen Söhnen vom Nachmittag. Und nun konnte er die Sorge äußern, die er vor Abram zu verbergen versucht hatte. Ja, es konnte schwierig werden heute Abend. Der Sklaventreiber war so voller Gift und Galle gewesen, nein, er würde die Sache sicher vorbringen, und die Gesetze Hammurabis bezüglich der Sklaven konnten tatsächlich ein Problem darstellen. Es würde wohl viel davon abhängen, wer gerade heute im Tor den Vorsitz haben würde, und ob Haran, der Tuchhändler, sein alter Freund und Nahors Schwiegervater, da war. Milka schickte sofort eine kleine Botschaft mit ihrer Magd zu ihres Vaters Haus. Terach würde im Rat alle Unterstützung brauchen. Seit einiger Zeit gab es Unruhen in der Stadt. Seit die Söldner vom letzten Feldzug zurückgekommen waren, hatte es Unzufriedenheit gegeben. Nach den Gesetzen des Hammurabis waren ihre Felder und die Geschäfte der Soldaten, so keine männlichen Verwandten da waren, von anderen verwaltet worden. Nach drei Jahren hätten die Eigentümer alles verloren, und manch ein eingesetzter Verwalter sah sich schon als neuer Besitzer, doch dann kamen die meisten nach über zwei Jahren zurück und die Übergaben waren nicht so reibungslos verlaufen, wie sich Hammurabi das wohl gemäß seinem Gesetz vorgestellt hatte. Das lag auch daran, dass in Ur noch viele der alten Familien die alte Jahreszählung bevorzugten, wonach das, was die Assyrer in Babylon ein Jahr nannten, zwei Jahre, ein sakrales und ein säkulares Jahr bildeten, jeweils sechs Monate lang und mit den Tag-Nacht-Gleichen als Neujahrsfesten. Die nach Ur rückkehrenden Soldaten gingen aber ganz selbstverständlich von assyrischen Jahren mit 12 Monaten aus, was ja auch dem Gesetz viel näherkam, da es ein babylonisches Gesetz, also assyrisch war. Sie bestanden darauf, dass sie somit lediglich 2 Jahre fort gewesen waren, während einige gewiefte Verwalter einfach chaldäische Jahre angesetzt hatten und mithin nach 3 Neujahrsfesten die verwalteten Grundstücke in Besitz genommen hatten. Es gab viele Gerichtsverfahren damals und in der Regel bekamen die Soldaten ihren Besitz zurück, aber erst nach Schwierigkeiten und manchmal in desolatem Zustand. Am Ende fühlten sich viele vom Gesetz betrogen, und darum wurde nun bei jeder Kleinigkeit genau darauf geachtet, dass Stand und Ansehen nicht das Recht beugten.
»Bereust du, dass du eingegriffen hast?« fragte Haran seinen Vater. Er hatte seinen Namen nach eben jenem besten Freund Terachs, dem Tuchhändler, bekommen, eine Ehre, die ihm jener wohl gerne erwidert hätte, hätte er neben seinen beiden Töchtern auch einen Sohn gehabt. Nahor hatte seinen Namen vom Großvater väterlicherseits, und Abram vom Großvater mütterlicherseits. Allein, seine Mutter war schon vor Jahren gestorben.
»Bereuen? Nein! Mitunter muss man seinem Gewissen gehorchen, auch wenn es klüger wäre zu schweigen. Es gibt genug Menschen, die andere im Unrecht gewähren lassen, weil sie Angst vor der eigenen Courage haben. Mitläufer, die das Unrecht vorantreiben, weil sie das Gesetz nur nach dem Buchstaben kennen, nicht aber nach dem Sinn. Und ich werde mich verteidigen, denn es war legitim. Natürlich, der Sklave gilt als Besitz, aber der Mensch, der in jenem Sklaven gefangen ist, ist ein Mensch. Und dieser Mensch ist geschützt, nicht nur durch das Gesetz des Hammurabi, sondern durch seine Geschöpflichkeit. Legal und legitim, illegal und illegitim, das sind zwei Welten. Wir müssen uns dem Gesetz beugen, aber gleichzeitig gerade stehen vor unserem Gewissen, und wenn diese zwei Haltungen, gebeugt werden und geradestehen, in Konflikt geraten, dann werde ich stets versuchen, den schweren, den geraden Weg zu wählen. Und, wenn erzwungen, auch die Konsequenzen meines Handelns tragen. Denn das macht den Unterschied zwischen einem freien Menschen und jenem aus, der in Angst sich windet wie ein Schakal, der anderen nach dem Munde redet, und hinter dem Rücken den Dolch doch schon hält.« Terach hatte sich in Rage geredet. Ja, dies war das beste Training für die Verhandlung am Abend. Wenn nur der Tuchhändler die Mitteilung rechtzeitig bekam. Er war ein gewandter Redner, und würde ohne Frage in jedem Fall einen Weg finden, der für alle Beteiligten erträglich wäre, nur ob jener Ischkatar sich besänftigen ließ? Er war so aufgebracht, verdrehte die Worte im Munde.
Der Abend kam rasch herbei. Erfrischt von Obst und Tee machte Terach sich auf den Weg, diesmal begleitet von seinen drei Söhnen und einem Dutzend von Knechten, dazu einige Mägde und jugendliche Knechte, die als Nachrichtenläufer mitkamen. Das gewaltige, mit glasierten Ziegeln wie ein Mosaik ausgestaltete Tor, bot den ganzen Tag kühlen Schatten und vom Strom kam des Abends ein milder Windhauch, der durch das Tor strich. Kein Wunder, dass dieser Ort seit alters her der Gerichtshof war. Am Anfang, als vor vielen Jahrhunderten die Stadt gegründet wurde - und die mächtigen, befestigten Städte in Mesopotamien war die ältesten in der Welt westlich des fernen Chinas -, traf man sich ganz natürlich hier und Streitigkeiten wurden im Tor geregelt. Damals gab es kein geschriebenes Gesetz, aber ein gesundes Rechtsempfinden und Gebräuche, nach denen man sich richtete. Nun hatte vor ein paar Jahren Hammurabi über 3000 Gesetze verfasst und auf Tontafeln aufschreiben lassen, zum Teil aus Präzedenzfällen entwickelt, zum Teil rein hypothetisch für den Fall der Fälle entwickelt. In allen Städten des erstarkenden Reiches gab es Kopien der Tafeln, und so wurden sie nun zur Grundlage der Entscheidungen, obgleich sie nie offiziell als wirkliches Gesetz in Kraft getreten waren. Es war einfach so überzeugend und entsprach der Sehnsucht nach mehr Sicherheit, auch Sicherheit vor den Herrschenden und Reichen. Nun gab es gewählte Bürgerrichter, Älteste, angesehene Bürger, die sich gegen 5 Uhr nachmittags bis Sonnenuntergang im Tor trafen, um Streit zu schlichten und Recht zu sprechen. Es gab annähernd 300 solcher Bürgerrichter in Ur allein, und der Zufall, oder auch die vielen Botenläufer, bestimmte, wer an jenem Abend gerade Lust verspürte, ins Tor zu gehen. Mal traf man nur wenige Richter an, mal versuchten 20 oder 30 von ihnen, gemeinsam Recht zu sprechen. Jeder in der Stadt versuchte, zu wenigstens einem dieser Bürgerrichter eine freundschaftliche Beziehung zu unterhalten, denn man konnte ja nie wissen, wann man ihn brauchen würde. Und so gab es unter diesen Bürgerrichtern jede Menge an Bestechung, oder »freundliche Geschenke«, wie man sie zu nennen pflegte.
Terach selber war auch einer jener Richter, doch verbot es sich natürlich, über einen eigenen Fall zu Gericht zu sitzen. Terach war zudem unbestechlich, was ihn bei manchen beliebt, bei anderen umso verhasster sein ließ.
Der Streit des Nachmittags war rasch zum Stadtgespräch geworden, dafür hatte Ischkatar schon selber gesorgt. Nun strömten die Menschen zum Tor. Dieser Prozess versprach gute Unterhaltung, wenn es gelang, einen Platz in den vorderen Reihen zu bekommen. Zudem strömten nun hunderte Feldarbeiter von den Äckern zurück in die Stadt. Eselskarren, Ochsen, Schafe und Ziegen und Händler waren auf dem Weg in die Stadt, und wohl ebenso viele Bewohner der kleineren Orte im Umland waren auf ihrem Weg heim. Obwohl das Tor breit genug für drei Wagen und fast 60 Ellen hoch war, entstand bald eine beklemmende Enge durch die Schaulustigen. Als die beiden Parteien eintrafen, Ischkatar hatte ebenfalls Freunde und Verwandte mitgebracht, erhob sich eine Unruhe. Die Richter, 14 waren nun erschienen, saßen etwas erhöht auf den steinernen Richterbänken entlang der Innenwände des Tors. Da sich abzeichnete, dass eine größere Verhandlung anstand, wurde nun der Verkehr von der Tempelpolizei endlich zum nächsten Nebentor umgeleitet. Dadurch wurde es zusehends leiser, und schließlich ergriff einer der Richter das Wort, womit er heute zum vorsitzenden Richter wurde.
»Gibt es einen Kläger in der Stadt Ur, ist hier ein freier Mann aus Chaldäa der Schlichtung sucht im Streit? So nenne er seinen Namen, bringe er die Sache vor, und nenne er die Beschuldigung!«
Ischkatar streckte seine Hand in die Luft und rief, mit sich leicht überschlagender Stimme: »Ich, Ischkatar, freier Mann, Handwerker und Händler nach den Registern der Stadt Ur, erhebe Klage gegen jenen, Terach Ben Nahor, der mich gewaltsam gehalten hat in der Stadt, der mich fluchend ›gottlos‹ schalte, der versucht hat, meinen Sklaven, mein Eigentum, von mir zu reißen, sicherlich verdient er, gebunden ins Wasser geworfen zu werden, und all sein Besitz soll mir gehören, seine Familie und Gesinde sollen mir als Sklaven gebracht werden, und sein Haus niedergerissen werden, wie es geschrieben steht in den Gesetzen des Hammurabi. So habe ich gesprochen, Ischkatar, Freier Bürger der Stadt Ur.«
Ein zweiter Richter griff nun ein: »Bist du gewahr, dass dies eine Anklage wegen eines Kapitalverbrechens ist, wenn du sie so darstellst; und ist dir klar, dass du des Todes bist, sollte dieses Gericht befinden, dass deine Klage keinen Grund hat, nach eben jenen Gesetzen des Hammurabi, die du zitierst?« Die Menge lachte auf. Und Ischkatar Gesicht verzog sich. Daran hatte er in seinem Zorn nicht gedacht. Und ihm war klar, dass seine Anklage so kaum durchkam, zu viele Zeugen und womöglich Richter unter ihnen, hatten ja den Streit mitangesehen. Er wandte sich zu einem großen Mann zu seiner Linken. Die beiden tuschelten, und tauschten anscheinend juristische Ratschläge aus, und nach etwa 2 Minuten, erhob Ischkatar wieder das Wort: »Nun, da Terach ein hoch angesehener Mann ist und viel zu verlieren hat, wie ich gerade angedeutet habe, so will ich ihm die Hand reichen und barmherzig sein, und ihn nur verklagen auf Schadenersatz. Hat er mich doch daran gehindert, meinen Besitz, einen jungen Sklaven, zu formen und zu lehren, wie man Geschäfte führt. Ihr müsst verstehen, er ist nicht sehr tüchtig, mein Prentaj. Ein Nichtsnutz aus Kleinasien. Ich habe ihn damals vom Feldzug mitgebracht, was Besseres konnte ich damals nicht finden. Ist es einem ehrlichen Mann verboten, seine Sklaven zu lehren und zu unterrichten? Nein, und somit hat Terach mir Schaden zugefügt. Soll er mir doch Ersatz geben. Was ist schon ein Schekel Silber zwischen ihm und mir? Er ist ein reicher Mann, und soll es auch dank meiner Barmherzigkeit bleiben, in der ich meine Klage zurückziehe.«
Wieder erhob sich ein Gelächter. Und der Vorsitzende Richter klopfte mit seinem Stab auf den Boden, um Ruhe erreichen.
»Kannst du dich entscheiden, Ischkatar, was du willst? Wir haben hier ein Dutzend Namen in der Zeugenliste, die in der Menge herumging. Ist es das, was dich angst sein lässt? So sei beruhigt, wenn du im Recht bist, hast du nichts zu fürchten. Dieses Gericht kennt keine Person. Doch bevor wir Terach hören, müssen wir genau wissen, worin du Recht suchst. Denn entweder dein Fall ist dir klar, und dann kannst du immer noch Barmherzigkeit zeigen, oder aber dein Fall ist nur ein Hauch der Wahrheit und ein Sturm der Lüge, dann kannst du nicht das Wort führen als Barmherziger, sondern allein um Gnade winseln, denn dann ist es an Terach dich zu verklagen für deine üble Nachrede und falsche Anklage. Denn wenn er deine Klage annimmt und sich verteidigt, dann ist es an dir die Schuld zu beweisen, nicht an ihm, die Unschuld zu zeigen.«
Ischkatar tuschelte erneut, wieder mit dem Großen, und dazu mit einem anderen, und schließlich sprach er: »Vielleicht habe ich den ehrbaren Terach ja nur falsch verstanden, Kann er vielleicht seine Worte wiederholen?«
Nun brach ein Sturm von Gelächter aus, der kaum mehr zur Ruhe kam, einer wandte sich zum andern, wiederholte, ergänzte, lachte und juckste. In all dem erhob sich der Tuchhändler, ja, er war gekommen, und als er endlich Gehör hatte, sprach er mit gewaltiger Stimme: »verehrte Mitrichter, gute Bürger der Stadt Ur, Ischkatar und Terach hört mich an. Mir scheint, dies gerät zur Posse. Ein Kläger der selber nicht weiß, warum er Klage führt? Du verschwendest die Zeit des Gerichtes mit deinem Geplapper. Du warst erregt und erzürnt über einen Sklaven, der nicht viel taugt, ist das wahr?«
»Ja, ja, so ist es, erzürnt« antwortete Ischkatar, der endlich eine Hoffnung sah, ungeschoren aus der Sache herauszukommen, und »ungeschoren« hat hier seine Bewandtnis, denn er begriff, dass er in Gefahr stand, selber nun in Sklaverei zu geraten, so dass man ihm die Haare würde scheren lassen als Zeichen, dass er seine Freiheit eingebüßt hatte.
»Und du, Terach, hast du vielleicht dein Herz wieder weich sein lassen? Wir wissen, wie du denkst. Du bist bekannt. Du bist gottesfürchtig, und von großer Barmherzigkeit bist du, um deine Mitbürger besorgt, und um ihr Eigentum. Kann es sein, dass du fälschlich und fahrlässig nicht begriffen hast, dass jener versuchte den Wert seines Sklaven durch Erziehung zu erhöhen, und hast daher versucht, jenem nur zu helfen, sein Eigentum vor Zerstörung zu schützen? So dass du nicht, wie jener meint, versucht hast, dem Sklaven zu helfen, sondern ihm selber zu helfen, dass er keinen Verlust erleide, wenn er in seinem Zorn den Sklaven eben nicht im Wert erhöht, sondern seinen Wert gänzlich zerstört?«
Terach musste schmunzeln, er erkannte, wie sein Freund ihm und jenem eine Brücke baute. Nur einige der Umstehenden, schienen dem Gedanken folgen zu können. Und ein Raunen ging durch die Menge, als Terach antwortet: »Ich hätte es besser nicht sagen können, hoher Herr.«
»So lasst uns denn schlichten und nicht richten. Keiner soll in Gefahr stehen, zu verlieren, sondern beide sollen gewinnen. Da jener, Ischkatar, den Sklaven für wenig wertachtet, aber dieser, Terach, durch sein Eingreifen den Wert des Sklaven erhalten hat, so soll jener, Ischkatar, so es ihm genehm ist, den Sklaven zum Preis von 10 Silberstücken jenem geben. Ist es ihm nicht genehm, so soll dieser, Terach, 5 Silberstücke von jenem, Ischkatar, erhalten für seinen Versuch, sein Eigentum vor Zerstörung zu schützen. Können mir die übrigen Richter in diesem Schlichtungsspruch zustimmen, so bitte ich den vorsitzenden Richter dies zu verkündigen.«
»Aber, das heißt ja, dass ich verliere, egal was ich wähle, denn der Sklave ist noch jung und wird sicher kräftig sein als Mann, und dann wird er ein Vielfaches wert sein. Ist das denn gerecht?« warf Ischkatar ein. »Was, wenn ich diesen Schlichterspruch nicht akzeptiere? Gibt es denn keinen unter den hoch angesehenen Herren Richtern, der einen besseren Spruch zustande bringt?«
»Es ist nicht deine Zeit zu sprechen. Du hast gesprochen, viel zu viel hast du geredet, Ischkatar, erst bringst du die schlimmsten aller Klagen vor, dann nimmst du zurück, du hast eine Deutung des Vorfalls vor allen hier anwesenden akzeptiert, nun nimm die Schlichtung hin. Allein eines wollen wir dir gönnen, du sollst entscheiden, ob Terach den Sklaven übernimmt und dir 10 Silberstücke gibt, oder ob er von dir jene 5 Silberstücke bekommt. Dazu darfst du jetzt sprechen.« war ihm der vorsitzende Richter ins Wort gefallen.
Und so blieb ihm nur, kleinlaut beizugeben, seinen Zorn nicht verhehlend: »soll er ihn haben. Ich werde mir einen neuen Sklaven kaufen, einen besseren, vielleicht eine Sklavin, eine, die etwas vom Hausstand versteht. Doch sieh dich vor Terach Ben Nahor, nimm meine Worte als Prophezeiung, du wirst sehen, wohin dich dein Gott führen wird. Denn in dieser Stadt wird es eng für dich werden. Es mag hier im Tor anders scheinen, wo deine Freunde das Wort führen, aber die kleinen Leute werden sich von dir und deines Gleichen nicht alles zerstören lassen. Ohne die Sklaven wird die Wirtschaft zusammenbrechen. Du magst es dir leisten können, doch die Mehrheit der freien Bürger weiß, was gut für sie ist. Und sie werden dich aus der Stadt ekeln, dich und deine Söhne, Enkel, und alles was dein ist. Soll dein Gott dich doch in ein Land führen, das er dir zeigen wird.«
Terach hatte alles wortlos mit angehört, und während einer der Botenläufer nach Hause eilte und das Geld holte, wurde bereits der nächste Fall angehört. Eine Frau verlangte die Scheidung von ihrem Mann und die Mitgift zurück, da ihr Gatte vom letzten Feldzug eine Sklavin mitgebracht hatte, die ihm mehr und ganz andere Freude bereitet haben soll, als sie es je konnte oder wollte.
Weit ab von all der Öffentlichkeit, am anderen Ende der großen Stadt, in einem der Vorratsräume des Hauses Schemkahiris war Kentaja ganz allein. Keiner konnte sie hier hören, und das war wichtig. Sie biss immer wieder auf das Stück Holz, um allzu lautes Schreien zu verhindern, und um die Schmerzen besser ertragen zu können. Sie kannte den Ort sehr gut, ja zu gut. Es mochte 9 bis10 Monate her gewesen sein, dass Schemkahiri sie hier überrascht hatte. Sie jaulte vor Schmerz, sei es wegen der Geburtswehen, oder der seelischen Narbe, die wieder aufbrach. Nie würde sie ihm verzeihen, diesem geilen, alten Bock. Und er würde nie Hand an dieses Kind legen, das schwor sie sich. Nur gut, dass seine Frau nichts von Konkubinen hielt, so konnte er sich nur heimlich an ihr und den anderen Sklavinnen vergehen, obwohl er nach dem Gesetz alles mit ihnen tun durfte, aber eben nur, wenn seine Frau keine Einwände hat. Nun war Kentaja wieder an diesem Ort, denn sie wusste, dass von hier kaum Schreie zu hören waren. Sie hatte ein paar saubere Leinentücher ausgebreitet, und war froh, dass sie selber bei anderen Geburten geholfen hatte. Tränen standen in ihren Augen und rollten über ihr von der Anstrengung rot angelaufenes Gesicht. Sie dachte an Prekären, den einzigen Jungen, den sie je geliebt hatte, wo mochte er sein? Ob er eine Frau, eine Familie hatte? Würde sie ihn je wiedersehen? Als sie diese Gedanken noch wälzte, war die kurze Pause zwischen den Wehen auch schon wieder vorbei. Nun kam eine so heftige Wehe, dass sie die Luft anhalten musste und ganz unwillkürlich zu pressen anfing. Und mit der ganzen Kraft Ihres Leibes drückte sie dieses neue, winzige, und ach so verletzliche Wesen hinein in diese feindliche, ach so grausame Welt: ein neues Leben, ein neues Wesen, eine neue Geschichte begann. Sie hob das kleine Mädchen vorsichtig auf, und obwohl der Schmerz schier unerträglich schien, strömte eine Woge des Glücks durch ihren massigen, bebenden Körper, als sie sie auf ihren entblößten Busen legte.
»Iris! So will ich dich nennen, du Lichtschein in dieser Finsternis. Egal, wie du einmal heißen wirst, für mich bist du die Sonne selbst, Hoffnung, die in die Finsternis scheint und sie erhellt. Durch dich soll neue Hoffnung in die Welt kommen. Und ich werde dafür sorgen, dass dich niemand missbraucht und versklavt, dass du zumindest eine Chance hast zu leben. Es bricht mir das Herz, dass ich es nicht selber sehen und erleben werde, aber wir werden verbunden sein, auch wenn ich diese Schnur durchtrenne.« Und während sie dies sprach, zog sie die Klinge in ihrer Rechten mit einem Ruck. Sie wunderte sich, dass sie den Schnitt nicht gespürt hatte, noch schien Iris etwas davon gemerkt zu haben. Aber Blut schoss aus der Schnur, so dass sie nun schnell das Messer zur Seite legte und einen Knoten knüpfte, zuerst an dem kurzen Ende, dass aus Iris’ Bauchdecke trat. Dann wandte sie sich nach unten zu ihrem Unterleib. Aber als sie die Schnur auch dort verknoten wollte, brach die Nachgeburt auch schon aus ihr heraus. Ein Knoten war nicht mehr notwendig, und die Geburt war vorbei. Kentaja war müde, unbeschreiblich müde, doch sie konnte nun nicht einschlafen. Auf keinen Fall einschlafen! Das Kind sog an ihren Brüsten, als wisse es, was zu tun war. Kentaja selber ging in Gedanken die Liste durch, die sie vorbereitet und immer wieder ergänzt hatte. Nichts durfte schiefgehen. Sobald Iris schlafen würde, wäre es Zeit, die Spuren zu beseitigen. Sie hatte in einer Ecke drei große Krüge mit Wasser bereitgestellt, um das Blut fort zu spülen, so dass es im gestampften Boden versickern konnte. Die Nachgeburt würde sie vergraben. Sie hatte im Garten bereits ein Loch dafür ausgehoben. Es war Pflanzzeit, und sie würde eines der Olivenbäumchen darüber pflanzen. Der Baum würde ihr kleiner Schrein sein, hatte sie sich überlegt. Das Kind, das nun vom Trinken und der Anstrengung der Geburt eingeschlafen war, wickelte sie in die Tücher. Sie selber wusch sich mit Kamillentee, den sie bereitet hatte. So hatten es die Frauen in Ägypten getan, um die Wunden zu heilen. Sie hielt nichts von Öl, das man hier benutzte. Sie hatte zu viele Frauen gekannt, die sich für Wochen in Schmerzen gewunden hatten, und viele waren gestorben. Obwohl sie müde und erschöpft war, verlor sie keine Zeit. Als alles zu ihrer Zufriedenheit sauber war, nahm die das Bündel mit Iris und machte sich auf den Weg. Mittlerweile war gnädig Dunkelheit auf die sich zu Bett begebende Stadt gefallen. Die lustig flackernden Ölfeuer brannten rußig an den Straßenecken und gaben genügend Licht, um den Weg durch die verwinkelten Gassen zu finden. Kentaja musste vorsichtig sein. Obwohl Sklaven nachts oft durch die Straßen strichen, war es unüblich, dass sie dabei irgendetwas trugen. Daher hatte sie Iris in einem langen Leinentuch wie in einer Hängematte umgehängt. Doch wenn man sie kontrollieren würde, wäre es sicher nicht leicht, das Neugeborene zu verbergen. Einige Hunde liefen ihr nach und schnupperten an ihren Beinen. Kein Zweifel, sie konnten riechen, dass sie gerade ein Kind geboren hatte, doch sie waren ihr nicht gefährlich. Es sind die Menschen, vor denen sie sich in Acht nehmen musste. Etwas später sah man im fahlen Licht des ersten Frühlingsvollmondes ihren Schatten vom Tor des Hauses Terachs fliehen. Doch es war nicht der einzige Schatten in dieser Nacht bei Terachs Haus.
Während Terach mit seinen Söhnen und Freunden unter den gespannten Zeltplanen auf den Kissenlagern saßen und beim jungen, spritzigen Wein der letzten Lese die Ereignisse des Tages wieder und wieder erzählten, mal mit ernsten Mienen, dann wieder verzerrt vom schallenden Lachen, erklomm jemand die Mauer von außen, und ein unsichtbarer Schatten beobachtete von einem dunklen Eck auf dem Dach aus die Familie mit den Freunden bei ihrer Feier. Die Knechte brachten immer neue Krüge mit Wein, Platten mit Obst, Käse und geräuchertem oder gepökeltem Fisch und Fleisch. Auch der neu erworbene Prentaj brachte Platten zur Feier. Er lächelte Abram zu, als er die Platte mit Obst vor Terach, seinem neuen Herrn, ablegte.
›Da ist ja auch dieser nichtsnutzige, dreckige Prentaj‹ ging es Ischkatar durch den Kopf. ›Nein, Terach soll keine Freude an seinem neuen Sklaven haben.‹ Durch die vielen Lampen war die Sicht gut. Ischkatar, unsichtbar auf einem der Dächer im Schatten verschanzt, zog einen Pfeil aus dem Köcher und zielte. Als Kind hatte er Bogenschießen gelernt, und beim letzten Feldzug, als er eingezogen war, hatte man seine Begabung entdeckt und ihm die ganze Kunst der Scharfschützen beigebracht. Dennoch zitterte seine Hand etwas vor Aufregung, und sofort ließ er die Spannung etwas nach, wie er es gelernt hatte. »Wenn du Zeit hast, nimm sie dir«, hatte sein Ausbilder immer wieder betont: »Lieber ein später Schuss ins Ziel, als ein früher Schuss ins Leere.« Er ließ den Atem aus den Lungen, um dann beim erneuten Anspannen die Luft langsam wieder einzuziehen. Als seine Lungen die volle Kapazität erlangt hatten, war der Bogen bis zum äußersten gespannt, und seine Hände so ruhig, dass er genau zielen konnte. Der Pfeil surrte fast lautlos durch die klare Luft auf sein Ziel, auf Prentaj, zu. Doch gerade in diesem Moment erhob sich Haran, der sich vom Wein erleichtern wollte, und geriet so in die Schusslinie. Der Pfeil drang in seinen Nacken ein und trat an der Kehle wieder hervor. Das Blut spritzte, Krüge zerschmetterten, die Platten wurden umgestoßen, und alle waren sofort nüchtern und sprangen auf. Nahor und einige der Knechte jagten in die Richtung, aus der der Pfeil gekommen sein musste. Und nun sahen sie den Schatten Ischkatars, der sich über die Mauer schwang. Zur gleichen Zeit war Terach mit einem kleinen Trupp zum Tor geeilt und hatte es entriegelt. Abram war mitgelaufen, und als das Tor geöffnet war, sah man auf der Schwelle etwas Fremdes liegen, ein kleines Bündel aus Tüchern, und vom Lärm geweckt, schrie Iris aus den Tüchern. Terach hob es auf, und reichte es Abram: »Halt das!« rief er, »und bleib hier!«
Bereits nach wenigen Minuten war die Jagd vorbei. Ischkatar, oder was von ihm geblieben war, wurde hinterher gezogen. Terach stand über seinem Leichnam. Nachbarn waren erwacht und kamen aus ihren Häusern.
»Du dummer Tor! Du dummer Tor! Nun bist du tot! Mein Sohn ist tot! Und wem ist damit geholfen? Deine Familie wird mir als Sklaven gegeben, dein Besitz wird der meine sein. Doch wem ist damit geholfen? Mein Sohn ist tot. Der Vater meines Enkels ermordet. Wer bist Du, dass du über Tod und Leben entscheiden wolltest. Dein Stolz war dein Verhängnis. Habe ich dir nicht 10 Silberlinge gegeben? Du wolltest nicht gottlos genannt werden, und hast dich selber gottlos gemacht.«
Abram war zu ihm getreten, sein Gesicht von Tränen, Blut und Staub verschmiert. Im Hof standen die Frauen um Harans leblosen Körper, heulten und jaulten in einem polyphonen Chor, die Hände immer wieder zum Himmel werfend. Terach achtete kaum auf Abram und machte seinen Weg Richtung der Frauen, als Abram ihn am Gewand fasste und zurückzog. Erst jetzt wurde Terach gewahr, dass Abram noch immer das Bündel in den Armen hielt. Was war das eigentlich? Iris schaute ihn mit großen Augen an. Abram hatte sie längst beruhigt, und Terach nahm sie auf den Arm. Ihre kleinen Äuglein blickten ihn erwartungsvoll an.
Mit lauter Stimme rief Terach: »Mein Sohn ist mir genommen, aber Gott hat mir eine Tochter geschenkt! Ihr Name sei Sarai, das heißt: Streitsüchtig. Denn diese Welt ist streitsüchtig. Und im Streit ist sie mir eine Tochter geworden. Ich adoptiere dieses Findelkind vor aller Augen und Gott sei mein Zeuge. Sie soll mir eine Tochter sein, und Nahor und Abram haben eine Schwester. Sie soll mir ein Trost sein in meinem Schmerz und meiner Trauer, sie soll mich besänftigen, wenn die Welt streitsüchtig ist. Gott tue mir dies und das, wenn ich nicht dem Streit wo immer möglich ausweiche, denn wir Menschen haben immer nur eine beschränkte Sicht der Dinge, und verkennen unsere Einsicht als Wahrheit, und ist doch nicht die ganze Wahrheit. Dieser Tor, der hier tot vor uns liegt, hat mich verflucht im Markt, und hat nur seine Wahrheit gesehen, die ihn geblendet hat. Doch er hat zugleich eine Prophezeiung gesprochen, mir einen Weg gewiesen. Wir werden diese ruchlose Stadt verlassen und in die Provinzen ziehen. Wir werden dort lehren, was hier keiner hören will, Worte des Friedens und nicht des Krieges. Worte der Liebe, statt Worte des Hasses, Worte von einem wahren Gott, und nicht von Götzen, die nur stumm schauen. Wenn sich ein neuer Weg auftut, so lasst uns ihn gehen, im Vertrauen, dass wir dem Gott folgen, der mehr von der Wahrheit sieht, als wir in unserer beschränkten Sicht.«