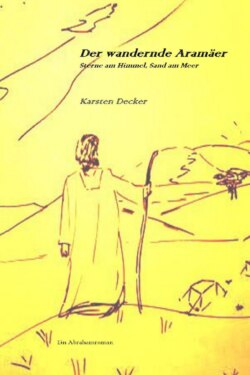Читать книгу Der wandernde Aramäer - Karsten Decker - Страница 4
Kapitel 2: Anfang und Ende, Himmel und Erde
ОглавлениеUnd das Fest, das wir endlos wähnen, hat doch wie alles seinen Schluss, nun keine Worte, und keine Tränen, alles kommt, wie’s wohl kommen muss.
Reinhardt Mey
Nach dieser ungewöhnlichen Nacht kam am Morgen alles nur langsam in Gang. Wilde Träume, die das Trauma immer wieder neu hatten aufsteigen lassen, hatten Terach sich von einer Seite auf die andere wälzen lassen.
Was war eigentlich geschehen? Nur langsam konnte er seine Gedanken und die Ereignisse der Nacht ordnen.
›Ja, es hatte alles mit diesem Disput um den Sklaven begonnen. Hätte ich einfach zusehen sollen? War denn mein Eingreifen so schlimm, dass daraus gleich ein Gerichtsstreit und schließlich ein Mord werden musste? Ischkatar, ja, so hieß der Sklavenschänder, war wohl überempfindlich gewesen. Ob er selber wusste, was er eigentlich wollte? Wer weiß, wie viel Unrecht er selber in den letzten Jahren hatte ertragen müssen. Was bringt einen Menschen dazu, so zu reagieren, ja überreagieren zu müssen? War er für die Feldzüge eingezogen worden, oder hatte er vielleicht Besitz an Verwalter verloren?‹ Wenn man seine Familie bringt, würde Terach mehr wissen. ›Und wieso kam er in der Nacht? Hatte er auf Haran gezielt? Wohl kaum, dann schon eher auf mich, oder den Sklaven, den er mir verkauft hat. Natürlich, er wollte den Sklaven treffen. Haran ist in die Schusslinie geraten. Ja, der Tod Harans war ganz gewiss ein Unfall gewesen, denn der Pfeil galt eindeutig dem Knaben. Ja, dann wäre es kein Mord gewesen, sondern nur Eindringen und Sachbeschädigung. Er hätte mir die 10 Silberlinge zurückgeben müssen und eventuell eine Strafe. Zwar wäre Ischkatar sicher zu Schadenersatz verurteilt worden, hätte man ihn erwischt, aber eben nicht wegen Mordes. Sklaven kann man nicht ermorden, sondern nur zerstören. Und warum war Haran nur aufgestanden? Warum nur? Und dann, was wäre anders gewesen, wenn der Knabe tot wäre? Ist ein Leben nicht so viel wie ein anderes, aber darf ein Vater etwa nicht wünschen, dass es hätte lieber einen anderen treffen sollen als seinen eigenen Sohn. Haran, Haran, warum nur du?‹ Tränen schossen Terach über die sonnengebräunten Wangen.
›Wenn doch nur alles ein böser Traum gewesen wäre‹, dachte er weiter, doch es war zu real, zu wirklich. Warum aber dieses sinnlose Morden überhaupt. Verletzte Ehre, Neid, Gier, Überheblichkeit führt so oft zu neuem Unrecht. Gewalt kann doch nur Gewalt erzeugen. Und wer war er, Terach, hier zu richten, war er nicht selber in der Nacht dem Instinkt der Blutrache gefolgt?
›Das Blut Ischkatars klebt an meinen Händen‹, ging es ihm durch den Kopf. ›Hätte Ischkatar seinen Plan umsetzen können und den Sklaven getötet, hätte er wahrscheinlich in der Dunkelheit verschwinden können. Bis wir verstanden hätten, was los war, wäre er in irgendeiner Seitengasse verschwunden gewesen, und man hätte ihm wohl kaum später etwas nachweisen können. Doch der Schock, dass er den Falschen getroffen hatte, muss ihn verwirrt haben. Er hat gezögert, war erst mit Verspätung geflohen, und hatte so den Vorsprung versäumt. Wollte er vielleicht trotz allem noch einen zweiten Pfeil auf den Knaben, sein ursprüngliches Ziel, schießen? Hatte er deshalb gezögert? Er war kaum zwei Straßen weit gekommen, als wir ihn erwischt hatten. Doch machte das Haran wieder lebendig? Und brachte das Lot den Vater zurück? Was mache ich nur? Ich werde Lot als meinen Sohn aufziehen müssen, nun da er Vollwaise ist. Und, warte, da war doch noch etwas in der Nacht. Dieses Findelkind. Sarai habe ich es genannt. Wo kam dieses Kind her? Nun habe ich zwei kleine Kinder statt eines Erwachsenen. Wir werden sehen, wir werden sehen!‹
Als Terach aus dem Haus trat, stand die Sonne im Osten bereits deutlich über dem Horizont. Er hatte lang in den Morgen hineingeschlagen und im Innenhof war schon reges Treiben. Das Frühstück, frische Brotfladen, Käse und Obst waren bereitet, Tee war aufgegossen. In der Mitte des Innenhofes war ein Gestell aus Stangen errichtet, auf dem man den Leichnam Harans aufgebahrt hatte, mit Blumen und Zweigen geschmückt, und bis auf den Kopf in Tücher gewickelt. Klageweiber waren in ihre rituelle Klage versunken, unter Tränen jaulend, immer wieder klagend die Hände gen Himmel aufschwingend, mit schwarzen Tüchern an den Handgelenken, die sie wie gewaltige Raben aussehen ließen. Eine kleine Gruppe Leute drängte nun durchs Haustor begleitet von einem Dutzend Knechte. Das musste der Hausstand Ischkatars sein. Sie sahen ängstlich drein, ungewiss, welches Schicksal sie nun ereilen würde. Wenn der neue Herr es wollte, konnte er beinah alles mit ihnen machen, und wenn sein Zorn noch dampfte, dann würde er, ohne Zweifel, sie alle köpfen lassen und die Kadaver in den Euphrat schmeißen, zusammen mit den Überresten Ischkatars. »Ich werde mich später um sie kümmern«, beschloss Terach.
Nahor, der schon beim Frühstück war, schaute ausdruckslos auf die Silberplatten vor sich. Er hatte bisher kaum einen Bissen herunterbekommen. Abram saß auf einem Kissen und hielt, ja, er hielt das kleine Mädchen in seinem Arm. Da sie ruhig schlief, musste wohl eine der Mägde bereits das Stillen übernommen haben. Das war gut!
»Was wird denn nun?« brach es aus Nahor heraus, als er seinen Vater kommen sah.
»Lass uns erst einmal frühstücken. Und lass uns überlegt handeln. Die Trauer benebelt mich, das ist gefährlich« sagte Terach. »Gott hat uns schwer geschlagen, er hat uns eine schwere Prüfung auferlegt. Und da heißt es, nicht überstürzt zu handeln. Ich kann ohnehin noch nicht fassen, was geschehen ist. Lasst uns in aller Ruhe durch die nächsten Tage gehen. Zunächst werden wir die Bestattung planen. Haran hat es verdient, dass wir ihm alle Ehre erweisen. Oh, ich, ich kann es nicht fassen. Wo ist überhaupt Lot? Weiß er schon, was geschehen ist? Natürlich! Aber, wo ist er?«
»Er ist bei Harans Leiche. Du kannst ihn nicht sehen, er sitzt auf der anderen Seite und weint. Er lässt niemanden an sich heran. Ich war schon da, aber er hat nur wild um sich geschlagen«, antwortet Nahor. Terach erhob sich, noch bevor er den ersten Bissen getan hatte, und ging hinüber zu der Aufbahrung. Er breitet die Arme weit aus, ging in die Knie, so dass er gerade so groß war wie Lot, und als eine Träne über seine Backe lief, sprang Lot auch schon auf und fiel in seine Arme.
»Großvater, Großvater, was ist mit Papa?« und dann brach er in Terachs Armen in lautes Weinen aus. Terach streichelte seinen Kopf und Rücken und drückte ihn immer wieder an sich heran.
»Hab keine Angst, Lot, ich bin ja da. Dein Papa war ein großer Mann. Und er hat dich so liebgehabt. Weißt du noch, wie er dir deinen ersten Flitzebogen geschenkt hat? Das war doch gar nicht so lange her, und er hat dir gezeigt, wie man damit schießt. Und er hat dir gesagt, wie gefährlich der Bogen ist. Nun siehst du es selber. Und die Tiere, die er dir geschnitzt hat, damit kannst du spielen und an ihn dabei denken. Du bist ein großer Junge. Ich weiß, du kannst stark sein. Und ich bin ja da, ich bin ja da.«
Wieder begann Lot zu weinen, und Terach weinte mit ihm für eine Weile, dann sagte er: »Komm, lass uns etwas essen, damit wir stark sind für diesen Tag!« Terach erhob sich langsam und trug Lot zu den anderen. Terach nahm einen Fladen Brot und riss ihn in der Mitte entzwei.
»Nimm und iss« sagte er, und Lot begann zu knabbern. Dann trank er einen Becher frische Ziegenmilch und wischte sich den Mund mit dem Handrücken ab. »Abram«, rief Lot plötzlich, »was hast du da?« und er huschte rüber zu seinem Onkel, der mehr wie ein großer Bruder und Freund für ihn war, und schaute ganz verdutzt auf Sarai.
»Hast du den gefunden?« fragte er.
»Das ist ein Mädchen, Sarai,« sagte Abram, »und ja, wir haben sie gefunden. Sie lag vor dem Tor. In der Nacht haben wir sie gefunden. Guck mal, sie ist noch ganz klein und winzig. Kaum eine Elle lang, und sieh mal, die kleinen Finger!«
»Darf ich sie mal halten?« fragte Lot und hatte sie schon halb aus Abrams Armen gezerrt.
»Vorsichtig«, sagte Abram, »ganz vorsichtig. Sieh, du musst eine Hand unter das Köpfchen legen, so, und nun lass sie nicht fallen. Siehst du ihre hübschen Augen? Sie heißt Sarai. Sie ist jetzt meine kleine Schwester. Mein Vater hat sie adoptoviert oder so. Sie ist jetzt meine Schwester.«
»Ich glaube, sie hat mich lieb? Kann sie auch meine kleine Schwester sein, Großvater? Bitte!« sagte Lot. Und dann wandte er sich auch schon wieder zu Abram: »Guck mal, sie hält meinen Zeigefinger ganz fest. Sie will ihn in ihren Mund stecken. Vielleicht ist sie hungrig. Gib mir schnell etwas Brot, dann kann ich sie füttern!«
»Nein, nein«, sagte Abram, »kein Brot. Guck, sie hat noch gar keine Zähne. Das geht doch nicht. Wenn sie Hunger hat, müssen wir Telna rufen. Die hat auch gerade ein Kind bekommen, die kleine Hagar, und Telna kann ihr Milch geben.«
»Du bist ein guter, großer Bruder«, sagte Terach zu Abram, »du kümmerst dich um sie ganz prima. Und Lot, du sollst auch ihr Bruder sein. Jetzt haben wir eine richtig große Kinderschar im Haus. Das wird sicher lustig: Ihr beide, Lot und Abram, dazu Sarai, Hagar, und der neue Knecht Prentaj.«
»Meschek« verbesserte Abram ihn. »Sein Name ist eigentlich Meschek. Wir sollten ihn bei seinem richtigen Namen nennen, dann müssen wir nicht mehr an diesen Ischkatar denken. Ich, ich…«
Nun war Abram der, der zu heulen anfing. Als Nahor ihn stoppen wollte, sprach Terach: »Lass ihn nur, Nahor. Die Gefühle müssen doch irgendwie rauskommen. Das war ein schwerer Schlag für uns alle.«
»Ich werde nie wieder Wein trinken und feiern. Wenn wir nüchtern gewesen wären, hätte dieser Schakal sich nie hier einschleichen können. Wir hätten die normale Wache gehabt, ich hätte selber aufpassen müssen. Ich habe den ganzen Abend in diese Richtung geschaut. Vielleicht hätte ich ihn gesehen, diesen Hund, wenn ich nüchtern gewesen wäre. Ich werde mir das nie verzeihen.«
»Beruhige Dich, Nahor. Du hast nichts Falsches getan. Es ist nicht deine Schuld. Und unsere kleine Feier hat auch nichts damit zu tun. Ischkatar war krank, krank von seiner eigenen Galle und seinem Zorn. Und das hat Unglück nicht nur über uns gebracht, sondern noch viel mehr über sein ganzes Haus. Hast du seine Familie gesehen. Sie sterben fast vor Angst. O, ich würde gerne Rache an ihnen allen nehmen, aber lass uns milde mit ihnen sein. Ich habe die ganze Nacht hin und her überlegt. Sie sind Opfer wie wir. Alles nur wegen dieses dummen Ischkatars. Hätte ich denn ahnen können, dass er so irrsinnig ist? Er hat 10 Silberlinge bekommen. Das war ein fairer Preis. Es ist doch nicht so, dass ich noch einen Sklaven gebraucht hätte, aber es war ein fairer Preis. Und wenn er so scharf darauf war, Meschek zu behalten oder zu töten, er hätte mir ja auch die 5 Silberlinge anbieten können. Glaube mir, ich hätte sie ohnehin nicht von ihm genommen. Nein, Nahor, du hättest nichts tun können, und am Ende ist geschehen, was Gott bereits wusste. Er ist es, der jedem Leben seine Spanne gibt. Ischkatar wollte da hineingreifen, er wollte Mescheks Leben beenden, aber Gott scheint für Meschek noch Pläne zu haben, Haran war seit dem Tod seiner Frau unglücklich. Wir alle haben ihm nicht helfen können. Nein, Gott weiß, ich wollte ihn nicht verlieren, nicht so! Und ich werde es nicht begreifen, aber eins weiß ich, weder Du, noch irgendjemand sonst hier, muss sein Gewissen quälen. Haran ist uns genommen, aber nicht ohne unser Leben vorher zu bereichern. Und wir haben seinen Sohn! In Lot lebt ein Stück von Haran weiter, und wir haben ein neues Kind, Sarai, das Leben geht weiter, es muss weitergehen.«
Ischkatars Frau musste um die 50 volle Jahre sein, er hatte einen Sohn von etwa 25 mit Frau und zwei Kindern, etwa 3 und 5, außerdem hatte Ischkatar eine Tochter, die noch nicht verheiratet war, und drei weitere Sklaven, einen älteren, der wohl seit vielen Jahren bei ihm war, und von dunkler Haut war, dazu eine Ägypterin um die 18 Jahre, etwas klein und pummelig, und einen weiteren Jungen etwa vom Alter Mescheks, aber kein Gomerer, sondern eher ein Kanaaniter, oder ein Perisiter. Nun erfuhr Terach, dass Ischkatar eine Töpferei betrieben hatte und dazu eine kleine Landwirtschaft mit drei Feldern am Euphrat. Außerdem besaß er eine Herde von etwa 20 Ziegen und Schafen. Sein Haus war nicht sehr groß, dazu die Werkstatt und ein kleiner Stall mit Scheune. Damit hatte Ischkatar der Mittelschicht in Ur angehört. Terach besaß ein Vielfaches davon. War es vielleicht Neid, der den Zorn Ischkatars gegen ihn gelenkt hatte? Dem Gesetz zufolge, gehörte all das nun auch Terach. Doch was wollte er damit. Nach dem Frühstück, von dem kaum einer wirklich gegessen hatten, überlegte Terach, was das klügste war, und schließlich kam er zu dem Schluss, dass er das Unheil nicht noch weiter steigern wollte.
»Hört«, sprach er, » Gott tue mir dies und das, wenn ich die Familie dieses Mannes nehme, der mir meinen Sohn geraubt hat. Sie sollen frei sein und ihr Haus und ihre Felder behalten. Allein die Sklaven sollen mein sein, und alle einjährigen weiblichen Ziegen und Schafe! Die einjährigen männlichen Tiere von Ischkatar sollen als Sühneopfer auf dem Altar dargebracht werden. Wir werden sie den Priestern übergeben. Die älteren Tiere sollen seinem Sohn als dem Hausvorstand gehören. Löst alle Fesseln und lasst sie gehen. Die Sklaven bringt in die Unterkünfte. Ich werde mich später um sie kümmern.«
Mehr und mehr Menschen trafen nun im Hause ein, um Haran die letzte Ehre zu erweisen und Terach ihren Respekt zu zollen. Terachs Freund, der Tuchhändler, der am Vortag den Schlichterspruch gefunden hatte, war auch gekommen. Er hatte diese letzten Worte mit angehört, während er von Milka, seiner Tochter, bedient wurde.
»Du bist großmütig, Terach. Was hat dich dazu bewogen, die Familie gehen zu lassen?« sprach er.
»Nun, mir wurde mein Sohn genommen, und nun sieh diese Familie an. Ihnen ist der Vater genommen. Doch sie können kaum trauern, so verängstigt sind sie. Da sind die gleichen Gefühle für den Vater. Soll ich das zerstören. Und wer weiß. Am Ende kommt irgendein Vetter von dieser verrückten Familie und klettert über meine Mauer. Nein, diese wären ohnehin nie gute Sklaven in meinem Hause geworden. Ich hätte mir die Revolte selber ins Haus geholt. Sie haben den Hausvater durch meine Hand verloren. Das macht nicht zum loyalen Diener. Selbst wenn ich sie als Sklaven verkaufte, müsste ich ihre Rache fürchten. Nein, weder habe ich in meinem Haus Platz für sie, noch kann oder will ich sie auseinanderreißen und verkaufen. Wenn ich sie aber freilasse, so werden Sie mich segnen. Auch kann ich ihnen nicht alles nehmen, was sie zum Leben brauchen. Außerdem, ich werde die Stadt bald verlassen. Dann müsste ich ihr Haus und die Felder verkaufen. Nein, sie sollen wohnen und leben. Ich nehme an, dass ihre Sklaven schlecht behandelt wurden, das habe ich an Meschek ja selber gesehen. Bei mir werden sie es besser haben. Du weißt, dass ich meine Sklaven wie Knechte und Mägde behandle. Sie werden mir mehr von ihrer Arbeit und Loyalität geben als ihm. Und wenn ich nach Westen ziehe, wer weiß, vielleicht werden sie mir nützlich sein. Du kannst sehen, dass sie ganz unterschiedlicher Herkunft sind. Ich werde von ihnen lernen, was sie an Wissen mitgebracht haben aus ihrer Heimat. So habe ich es immer getan. Du glaubst gar nicht, wie viel Weisheit in einem Sklaven verborgen sein kann. Und diese Weisheit kann man sich nur zunutze machen, wenn man den Menschen im Sklaven sieht und respektiert. Wenn ich erkenne, dass ein Knecht oder Magd gebildet ist, dann lass ich sie ihr Wissen verbreiten, ja, sie lernen voneinander. Ich glaube, Gott hat große Pläne für mein Haus. Ich habe Vertreter der größten Kulturen zusammengebracht, das Wissen der Generationen von Ägypten, Mesopotamien, der Nordvölker. Ja, und selbst aus dem fernen Orient habe ich Menschen im Hause, die mehr wissen, als ich und du uns träumen lassen. Ich habe gelernt, Wunden mit Wein oder Tee zu behandeln, statt mit Öl. Salz und Rauch machen Fleisch und Fisch länger haltbar. Wusstest Du, dass es von Vorteil ist, seine Hände zu waschen? Und die Sprachen. Ich selber merke, dass mein Geist etwas langsam ist, aber Abram saugt die Sprachen einfach in sich auf. Er spricht mit den einen Ägyptisch, mit den anderen die Dialekte des Nordens, und mit wieder anderen die Sprache Phöniziens und der Seevölker. Wusstest Du, dass man aus gekeimter Gerste besseres Bier brauen kann als aus vergorenem Brot allein? Der Kusch, den sie so zubereiten, hält sich länger. Ich selber bevorzuge allerdings den Wein.«
»Wer braucht so viel wissen?« fragte der Tuchhändler, »und warum willst du fort? Du hast einen guten Ruf hier, deine Vorfahren sind wahrscheinlich in Ur gewesen, seit die Stadt gegründet wurde. Dir gehören die besten Felder, die größten Herden, ein befestigtes Haus. Allein die Könige leben besser als Du. Du hast alle Sicherheit hier, warum das aufs Spiel setzen. Wer weiß, was dir zustoßen könnte. Allein die Reise, die Strapazen! Lass erst einmal etwas Zeit verstreichen. Du bist noch in Schock.«
»Ich weiß, ich weiß, und doch, es drängt mich. Vielleicht war die Nacht der Auslöser für eine tiefere Sehnsucht. Ja, fast wie ein Deut, dass mein Schicksal nicht in Ur liegen kann, dass Gott Pläne hat. Erinnerst du dich an die Geschichten, die wir als Kinder von unseren Eltern und Großeltern gehört haben, vom Garten Eden, von der großen Flut, vom Turmbau in Babel? Und ich meine nicht die vermengten Mythen, die man hier erzählt, von Gilgamesch, Maduck und so. Weißt du, wie jede dieser Geschichten endet? Seid fruchtbar und mehret Euch und füllet die Erde. Nun, die Menschen haben eher die Tendenz beieinander zu bleiben. Städte werden immer größer. Und mit der äußeren Ordnung der Stadt kommt die innere Unordnung. Wenn alles von außen für uns geordnet wird, dann verlieren wir die Fähigkeit, ja das Verlangen, selber zu entscheiden. Aber wir sind verantwortlich. Jeder für sich. Jeder von uns muss all seine Handlungen verantworten, vor den Menschen, aber auch vor Gott. Und glaube mir, ich versuche es, aber ich merke, dass ich trotz aller guten Vorsätze immer wieder fehle, nicht dem Ziel genüge, dass ich mir selber setze, und schon gar nicht der Bestimmung, die Gott für uns hat, und die wir im Herzen spüren. Und hier in Ur, sicher wir haben die neuen Gesetze, wir haben unsere Gerichte, aber wir handeln nicht nach dem, was unser Herz uns sagt, sondern allein, um mit dem Gesetz konform zu gehen. Für viele zählt nur, ob sie erwischt werden. Sieh Ischkatar! Er glaubte, tun zu dürfen, was er tat, wenn er nur ungesehen blieb. Das ist es, was ich meine. Ich will meine Kinder nicht so erziehen, meine Knechte nicht versklaven. Es kann nur ein Gesetz geben, das, das Gott uns ins Herz schreibt, und da werden wir nie ungesehen bleiben. Gott erschafft kein Wesen, um es dann sich selbst zu überlassen. Und Gott hat einen Plan für mich und für mein Haus. Wenn ich hierbleibe, wird dieser Plan untergehen in der Unruhe der Stadt. Schon jetzt ist mein Haus groß, wie du sagst. Und es wird größer werden, ja Völker werden aus ihm hervorgehen, so wie nun Vertreter von Völkern in ihm sind. Siehst du Abram dort drüben, durch ihn wird Segen fließen zu all den Völkern, von denen er nun lernt, denn er wird sie voranbringen. Er wird ihr Wissen und ihre Weisheit vereinen und abgleichen. Und er wird Gott finden, wenn er sich von Gott finden lässt. Er wird wie ein Stern vor den Völkern leuchten, ein Licht sein auf ihrem Weg zu ihrer Bestimmung. Und wenn nicht? Na und, alles ist besser als Ur und die Erinnerung, die nun damit verbunden ist.«
»Ich werde dich vermissen, Dich, Milka, Nahor, Abram und Lot. Hast du schon an einen Preis für dein Haus gedacht?« fragte der Tuchhändler. Ein Lächeln huschte über die Gesichter der Freunde.
»Sind wir schon beim Feilschen?« fragte Terach. Dann setzte er hinzu: »Was sind schon 150 Talente Silber zwischen dir und mir? Doch lass uns darüber nach der Bestattung reden. Nun ist nicht die Zeit für Geschäfte und Transaktionen.«
Der Tuchhändler schluckte, 150 Talente, das war eine Menge Silber, 450000 babylonische Schekel, also 900000 Silbermünzen, dachte er bei sich. Nun, das Gehöft mit all den Feldern war sicher sogar mehr wert, aber Einhundertfünfzig muss man erst mal haben. Er selber brauchte auch nicht so viel Land, würde es selber verpachten oder weiterverkaufen. Wenn er ihn runter handeln könnte. Zusammen mit den Kornverkäufen der letzten Ernte und den Tüchern, die die Karawane gebracht hat, ja, das könnte reichen. Er rieb sich mit der Hand das Kinn, dann zwang er sich das Geschäft hintanzustellen. Dies war eine Trauerfeier. Und bald würden alle aufbrechen, um den Leichnam beizusetzen. Mittlerweile hatten die Mägde und Knechte die Grabbeigaben zusammengestellt und die Gaben für die Bestattungspriester gerichtet. Es war üblich, Korn, Brot, Wein und Bier für die Priester zu bringen. Eine gewaltige Prozession setzte sich in Gang. Die Klageweiber flankierten den Leichnam, der mitsamt geschmücktem Gestell vorangetragen wurde. Wo immer der Leichenzug vorbeikam, stockte der Alltag für eine Weile. Das Ziel war ein Acker dicht am Flussufer. Hier standen gewaltige Altäre für die Opfer- und Priestergaben. Der Leichnam wurde in der Erde vergraben, wie es in Ur üblich war. Als die Menge zum Haus Terachs zurückkehrte, standen schon überall kleine Tische mit Festessen. Die Klageweiber, die am Grab geblieben waren, bis alle ihren Respekt gezollt hatten, kamen als letzte. Doch keiner rührte etwas an, bevor sie da waren. Mit der letzten lauten Klage, begann die Musik aufzuspielen. Und nun wurde aus der Trauerfeier ein Fest. Alle aßen und tranken, erzählten Anekdoten aus dem Leben des Verstorbenen, oder aber besprachen andere Geschäfte, für die die Gelegenheit gut war. Da wurde nun bald über Äcker und Sklaven gehandelt, Tipps ausgetauscht, und immer wieder getrunken. Ja, das Leben ging wieder weiter, oder war es das schlechte Gewissen derer, die noch einmal davongekommen waren, die noch eine kleine Spanne vor sich hatten. Terach betrachtete das Treiben zusammen mit Abram. Mit einem Mal sagte Abram: »Ist es nicht merkwürdig, wie der Tod das Leben beflügelt?«
»Ja«, sprach Terach, »merk-würdig.«
In den folgenden Wochen normalisierte sich das Leben zusehends für die Familie. Nur Terach schien wie unter einer großen, düsteren, ja erdrückenden Wolke zu wandeln. Er redete wenig, und lachte nicht einmal. Sein Gesicht wollte nicht aufhellen. Dabei war er voll emsiger Betriebsamkeit. Allein, es schien, als bliebe unendlich viel unerledigt und ungetan. So hatte Terach das Wort gestreut, dass all seine unbeweglichen Güter zum Verkauf stünden, doch, wenn Bürger Sklaven mit Angeboten sandten, reagierte Terach nicht darauf, ließ sie unbeantwortet und die Zeit verstreichen. Mittlerweile war der Frühling dem Sommer gewichen. Die Temperaturen waren unerträglich unter dem wolkenlosen Himmel des unteren Zweistromlandes. Die Sommerfelder, die über ein ausgetüfteltes Kanal- und Grabensystem vom Euphrat bewässert wurden, trugen gute Frucht in diesem Jahr. Die Knechte waren mit der Ernte voll ausgelastet, und die Scheunen, die bereits die große Winterernte beherbergten, füllten sich bis unter die Stiege mit dem reichen Segen.
Harans Grab war nun mit einem kleinen Tempelchen versehen, zu dem Terach täglich neue Gaben bringen ließ. Und genauso regelmäßig verschwanden diese Gaben von dem kleinen Altar. Terach wusste, dass es viele in der Stadt gab, die trotz der guten Ernte nicht genügend zu essen hatten, um ihre Familien zu ernähren. Der reiche Segen eines Landes ist oft ungerecht verteilt. Bettler gab es zu hunderten in Ur, nicht, weil sie die Arbeit scheuten, sondern weil sie keine bekamen. Durch die vielen Sklaven, die es seit dem letzten Feldzug gab, hatten viele freie Bürger, die keinen Besitz hatten, auch noch die Arbeit verloren, die sie bisher ernährt hatte. Zur gleichen Zeit waren andere unermesslich reich geworden. Es ist der Segen der Götter, meinten sie, der denen zu kam, die untadelig vor ihnen wandeln. Und die Armut sei auf der anderen Seite die Strafe für jene, die in Gedanken und Werken die Götter erzürnen. Das Schicksal ist der Spiegel unseres Tuns, Lohn und Strafe der Götter, und mit diesem Tun-Ergehens-Zusammenhang rechtfertigten sie oft nur ihre eigene Habsucht. Terach dachte anders über diesen Segen.
»Wir dürfen die Gnade und den Segen, der uns zukommt, nicht mit Belohnung verwechseln, sondern müssen sie als Aufgabe erkennen« hatte er immer wieder in der Versammlung der Bürger gesagt. Und er hatte selber danach gelebt. Er hatte alle seine Arbeiter behalten, und die von ihm erworbenen Sklaven wurden als ebenbürtige Knechte und Mägde behandelt, erhielten ihre Portionen als Lohn, und konnten sich relativ frei bewegen. Und obgleich viele meinten, dass müsse zu wirtschaftlichem Ruin führen, war Terach über die letzten Jahre reicher als alle anderen geworden. Nicht selten hatte Terach mit seinen erwachsenen Söhnen und seinen engsten Freunden darüber philosophiert. Es ist schon beachtlich, wie kleingläubig gerade die sind, die doch am meisten haben. Wie ängstlich sie ihr Hab und Gut festhalten, und gleichzeitig sich daran festhalten. Segen und Reichtum kann befreien, es kann aber auch gefangen machen, und statt Glauben und Vertrauen nur Angst und Sorge vergrößern. Nein, egal wie viele Götter sie erfanden, so wenig Glauben hatten sie. Keiner von ihnen würde den eigenen Göttern wirklich vertrauen und Schritte ins Unbekannte wagen. Terach dagegen kam aus einer Tradition, die immer wieder versuchte, der Inflation der Götter zu wehren. Und obgleich sie nur wenig über diesen Gott des Himmels und der Erde wussten, so war in der Familie doch immer hochgehalten worden, dass es eben nur einen Gott geben kann, aber dem vertraute die Familie so gut sie konnte. Und nun war es an Terach, einen Schritt ins Unbekannte zu wagen, zu vertrauen, auch wenn alle anderen anders dachten.