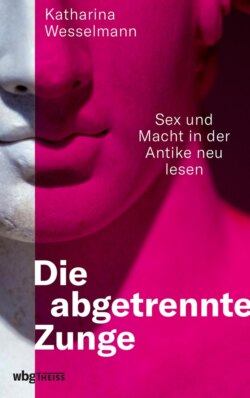Читать книгу Die abgetrennte Zunge - Katharina Wesselmann - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Gattin: Penelope
ОглавлениеEin anderes von der männlichen Perspektive gezeichnetes Frauenschicksal ist das der Penelope. Wer ist Penelope? Penelope ist die Gattin des Odysseus. Wir kennen sie zuerst aus Homers Odyssee als treue Ehefrau, die zwanzig Jahre lang auf ihren Mann wartet, die letzten Jahre davon bedrängt von einer Schar Freier, die sie heiraten und Odysseus’ Platz einnehmen wollen. Penelope ist ohne Zweifel eine starke Person, die ihren Sohn alleine großzieht und sich der Freier so gut erwehrt, wie sie das als Frau vermag. In Homers Epos wird sie immer wieder als περίφρων (períphrōn) bezeichnet, als ‚umsichtig‘, und in der Tat heißt es in der Literatur immer wieder, dass diese Frau ihrem klugen Gemahl Odysseus durchaus das Wasser reichen kann – Odysseus ist bekanntlich das intellektuelle Schwergewicht der griechisch-römischen Mythologie. So trickst Penelope die Freier mehrfach aus: Sie sagt, sie könne nicht heiraten, bevor sie nicht das Leichentuch für ihren Schwiegervater Laërtes fertig gewebt habe. Damit erkauft sie sich Jahre – bis die eifrigen Bewerber von einer verräterischen Magd erfahren, dass Penelope allnächtlich auftrennt, was sie tags zuvor gewebt hat. Auch mit der berühmten ‚Bogenprobe‘ führt sie die Freier hinters Licht: Sie verspricht, denjenigen zu heiraten, der Odysseus’ Bogen spannen und einen Pfeil durch zwölf Äxte schießen kann. Wie man sich das Experiment genau vorzustellen hat, ist archäologisch umstritten; jedenfalls hat keiner der Freier auch nur den geringsten Erfolg, dafür aber der arme Bettler, der sich seit Kurzem bei Hofe aufhält – und sich eben durch diesen seinen Erfolg mit dem Bogen als Odysseus outet. Penelope, die Umsichtige, traut dem Braten aber noch immer nicht und stellt auch ihren Ehemann auf die Probe: Sie befiehlt ihren Dienern, ihm das Bett aus dem Schlafgemach zu tragen, das er selbst gebaut habe. Odysseus erwidert, dies sei nicht möglich, da er es in den Stamm eines Baumes hineingeschnitzt habe, um den herum dann die Kammer gebaut worden sei. So werden denn zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Penelope weiß, dass nur Odysseus über diese Information verfügt, und Odysseus kann aus diesem ihrem Wissen ableiten, dass in zwanzig Jahren niemand sein Schlafzimmer betreten hat.
Penelope ist klug, ohne Zweifel. Aber sie ist wie Briseis eine Figur, die nur im Hinblick auf einen Mann existiert: Penelope wartet auf Odysseus, bleibt ihm treu, ermöglicht seine Wiederkehr. Auch sie lässt Ovid in seiner Sammlung Heroides einen Brief schreiben; er illustriert darin die Fixiertheit der Gattin auf ihren Mann durch einen amüsanten Kunstgriff: Penelope ist über alles informiert, was ihr Mann tut. Sie scheint ihn ständig zu beobachten. Schon die Eingangsverse wirken, als sei der Brief eine realistische Kontaktaufnahme: „Dies schickt dir deine Penelope, Odysseus, du Langsamer, und es ist mir nicht wichtig, dass du antwortest: Komm selbst!“8 Penelope erzählt, dass sie sich immer schrecklich gesorgt hat, wenn sie von getöteten Griechen hörte, und zählt zahlreiche Namen griechischer Helden auf, von deren Tod sie erfahren haben will. Der Eindruck ist mindestens der einer täglichen Zeitungslektüre, wenn nicht eines Live-Mitschnitts, etwa in der Passage, wo Penelope über Odysseusʼ Spähergang ins Lager der trojanischen Verbündeten berichtet, eine Heldentat, die ihm die Pferde des Thrakers Rhesos einbringt. Während dieser Episode ängstigt sich Penelope zu Tode, erst beim glücklichen Ende ist sie erleichtert: „In einem fort klopfte mir das Herz vor Furcht, bis man sagte, du rittest als Sieger auf thrakischen Pferden durch die Schar der Freunde.“9 Es wirkt tatsächlich, als habe sie Odysseus bei seinem Abenteuer zugesehen.
Penelope existiert nur im Hinblick auf Odysseus und im Warten auf ihn, wie auch Briseis nur als ‚MacGuffin‘ für die Ilias-Handlung dient. Beide Figuren wecken Empathie, sind aber keine selbstständigen und vielseitigen Charaktere wie Achilleus und Odysseus: Von den beiden Helden werden unzählige Episoden in ganz verschiedenen Kontexten erzählt. Sie sind keineswegs nur die Männer von Briseis bzw. Penelope.
Briseis mag erfunden worden sein, um Achilleus und Agamemnon einen Grund für ihren Streit zu geben. Bei Penelope verhält sich das aber anders. Diese mythische Figur hätte mehr zu bieten gehabt, wie man aus einigen Erwähnungen in verschiedenen weniger bekannten antiken Texten erfährt.10 Schon ihr Name wurde in der Antike auf zwei ganz verschiedene Arten erklärt: als ‚Weberin‘, was perfekt zu ihrer Rolle in der Odyssee passt, und als ‚Entenfrau‘, was zunächst überhaupt keinen Sinn zu ergeben scheint, in den Quellen aber damit erklärt wird, dass Penelope einst von Enten vor dem Ertrinken gerettet worden sei. Ihr Vater sei der König von Arkadien gewesen, ihre Mutter eine Nymphe. Nach manchen Quellen ist Penelope die Mutter des bocksfüßigen Gottes Pan, nach anderen heiratet sie nach Odysseusʼ Tod ihren Stiefsohn Telegonos, den Odysseus in seiner Abwesenheit mit der Zauberin Kirke gezeugt hat.
Man könnte Penelopes Geschichte also auch ganz anders erzählen. Die Figur hat Facetten, die durch die Dominanz von Homers Erzählung vollkommen untergegangen sind: Hinter der Halbnymphe, die von Enten davongetragen wird und später ihren Stiefsohn heiratet, würde niemand die treusorgende Gattin des Odysseus erkennen.
Eine gegenwärtige Neuinterpretation der Figur verfolgt den Ansatz, diese verlorenen Facetten ans Tageslicht zu holen. In ihrem Roman The Penelopiad (Die Penelopiade), der 2005 veröffentlicht wurde, zeigt die kanadische Autorin Margaret Atwood eine Penelope, die nicht nur über ihre Verbindung zu Odysseus definiert ist. Im Hades, und zwar interessanterweise im 21. Jahrhundert, rekapituliert Penelope ihr Leben, beginnend mit ihrer Kindheit in Sparta. Unter anderem versucht sie zu erklären, warum sie ins Wasser geworfen wurde, in Atwoods Version als Kind von den eigenen Eltern: Penelope spekuliert, dass ihr Vater wohl ein Orakel erhalten haben müsse, nach dem sie sein Leichentuch weben werde. Wenn er dies verhindere, werde er ewig leben, so habe er wohl gedacht. Atwood verknüpft hier Elemente aus verschiedenen Mythen: Die Entengeschichte aus der Etymologie des Namens, das Webemotiv und eine typisch männliche Heldenbiografie: Paris, Ödipus, Perseus, Romulus und Remus – sie alle sind Figuren mit einem Vater, Großvater oder Onkel, der um jeden Preis ihre Geburt verhindern oder sie als Kleinkind töten will, um selber am Leben oder an der Herrschaft zu bleiben. Tatsächlich existieren in der antiken Mythologie keine Geschichten, in denen Töchter im Kindesalter getötet werden. Dagegen ist das Motiv des Helden, der eigentlich nicht leben soll, sich dann aber auf wundersame Weise doch durchsetzt, ziemlich verbreitet, nicht nur im griechisch-römischen Mythos: Man denke an Moses und Jesus.
Margaret Atwood wagt sich auch an eine Reaktion auf eine der wohl misogynsten Stellen der antiken Literatur, die sich ebenfalls in der Odyssee findet. Als Odysseus zurückkehrt, rächt er sich an den Freiern, die seinen Hof belagern, und an deren Verbündeten. Darunter sind auch zwölf Mägde, die sich mit den Freiern eingelassen haben – aus Gründen, die in der Odyssee nicht näher ausgeführt werden; ob freiwillig oder gezwungen, erfährt man nicht. Diese Frauen können nicht am Leben bleiben, sie sind illoyal, befleckt von ihren Beziehungen zu den Feinden. Sie werden bestraft, während ihre Herrin Penelope noch schläft: Zunächst wird ihnen befohlen, den Saal vom Blut und den Leichnamen der bereits ermordeten Freier zu reinigen. Danach sollen sie selber sterben; Odysseus trägt seinem Sohn Telemachos und zwei loyalen Dienern auf, sie mit dem Schwert zu töten.
Klagend, weinend und unter Zwang machen sich die Frauen an die entsetzliche Arbeit. Danach werden sie in eine Ecke des Hofes gedrängt, aus der es kein Entkommen gibt. Telemachos erklärt ihnen, dass der Tod durch das Schwert noch zu gut für sie sei, spannt ein Seil über den Hof und hängt sie daran auf: „Und wie Drosseln mit weit gespannten Flügeln und Tauben in ein Netz hineinschlagen, das im Gebüsch aufgespannt ist – eigentlich wollten sie nach Hause, aber ein grässliches Lager hat sie empfangen –, so hielten die ihre Köpfe in einer Reihe, und um aller Hälse lagen Schlingen, sodass sie auf jämmerlichste Art und Weise sterben sollten. Ein bisschen zappelten sie mit den Füßen, aber nicht sehr lange.“11 Auf die Szene folgt noch die Bestrafung des illoyalen Hirten Melanthios: Ihm werden Nase, Ohren und Genitalien abgeschnitten und den Hunden vorgeworfen. Auch das ist grässlich, aber die Bestrafung der Frauen wirkt noch stärker, weil sie vor ihrem Tod noch zum Arbeiten gezwungen werden – zum Beseitigen der Leichen ihrer Liebhaber, mit denen sie sich eingelassen hatten, unter welchen Umständen auch immer.
Die Mägde haben in der Rezeption der Odyssee wenig Mitgefühl erfahren. So hat Emily Wilson – sie hat das Werk als erste Frau ins Englische übersetzt – auf einige drastische Formulierungen ihrer Vorgänger aufmerksam gemacht: Während die illoyalen Dienerinnen im homerischen Text neutral als „die Frauen, die mit den Freiern geschlafen haben“, bezeichnet werden,12 haben Generationen männlicher Übersetzer sie mit einem verstörenden Arsenal moderner misogyner Begriffe wie ‚sluts‘, ‚whores‘ und ‚creatures‘ charakterisiert, womit sie gravierend vom Originaltext abwichen.13
Auch die Erzählung um die Mägde hat Margaret Atwood in ihrer Penelopiade neu gedeutet. In ihrer Version des Mythos sind die zwölf jüngsten, hübschesten Mägde für die Freier ohnehin Objekte der Begierde. Da sie zu intimen Beziehungen mit den Männern gezwungen werden, stiftet ihre Herrin Penelope sie dazu an, für sie zu spionieren. Niemand außer Penelope weiß von der Übereinkunft, und deswegen werden die vermeintlich illoyalen Mägde von Odysseus und seinen Helfern getötet. Penelope schläft gerade, als ihre überaus loyalen Spioninnen ermordet werden. Verraten hat sie die alte Dienerin Eurykleia; die Erzählerin lässt offen, ob aus Loyalität zu ihrem Herrn oder aus Eifersucht auf die Jugend und Schönheit der Mägde.
Das Beispiel der Penelope zeigt, wie stark die Figur vom männlichen Blick geprägt worden ist. In der mythischen Tradition durchaus eine facettenreiche Figur mit ganz eigenen biografischen Zügen, wurde Penelope durch die Dominanz des odysseischen Narrativs im kollektiven Gedächtnis der literarischen Tradition zur Gattin des Odysseus reduziert. Margaret Atwood erobert etwas von Penelopes Facettenreichtum zurück und eröffnet der Welt Züge der sinnbildhaften Gattin, die seit Homer keine besondere Aufmerksamkeit mehr erhalten hatte.
Atwood ist nicht die einzige moderne Autorin, die derartige Neuinterpretationen unternimmt. Mit Penelope and the Geese wurde 2019 eine Oper der Komponistin Milica Paranosic und der Librettistin Cheri Madig uraufgeführt, in der Penelope das Gegenteil einer keuschen Gattin ist: Sie webt kein Leichentuch für ihren Schwiegervater, um die Freier in Schach zu halten, sondern eine Bettdecke aus den Locken ihrer unzähligen Liebhaber.