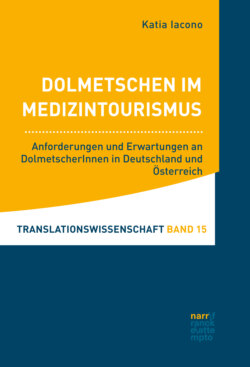Читать книгу Dolmetschen im Medizintourismus - Katia Iacono - Страница 16
1.6 PatientInnentypen
ОглавлениеJe nach Beweggrund für die medizinische Reise ist es möglich, verschiedene Klassifizierungen der PatientInnen vorzunehmen. Berg (2008: 87ff.) bietet in seinem Modell einen Überblick über unterschiedliche PatientInnentypen. Ausgangsbasis der Klassifizierung ist die für Marketinganalysen klassische Segmentierung der Nachfrage. Berg hebt dabei das unterschiedliche Potenzial der PatientInnen hinsichtlich ihrer Bereitschaft, die Kosten für Gesundheits- oder medizinische Leistungen selbst zu tragen oder auf die Krankenversicherung zurückzugreifen, hervor (siehe Tab. 2).
| PatientInnen als präventive NachfragerInnen | Proaktives Verhalten: präventive Gesundheitsmaßnahmen Zahlwillig, aber oft nicht zahlfähig |
| PatientInnen als kurative NachfragerInnen | Gesundheitsleistungen, um eine bereits aufgetretene oder eintretende Krankheit ambulant oder stationär zu behandeln Wunsch nach alternativen Heilungsmethoden |
| PatientInnen als rehabilitative NachfragerInnen | Postkurative Behandlung (normalweise von TherapeutInnen, PsychologInnen, SozialarbeiterInnen, ÄrztInnen oder in speziellen Rehabilitationseinrichtungen) Mehrheit der Leistungen im Angebot der Krankenversicherung enthalten |
| PatientInnen als NachfragerInnen nach Pflege | Menschen in dauerhaft pflegebedürftigem Zustand; ständige Betreuung (auch Körperpflege, Ernährung und Haushaltsversorgung) |
Tab. 2:
PatientInnentypen nach Berg (2008: 8)
Juszczak und Ebel (2009: 103f.) unterscheiden zwischen den Typen von PatientInnen ausgehend vom medizintouristischen Angebot und ergänzen die von Berg ermittelten Bedürfnisse und Behandlungen um neue PatientInnentypen (siehe Tab. 3).
| Medizin- touristInnen | Medizinischer Eingriff im Ausland Die gewählte Klinik kann zwar die Zielgruppe aus medizinischer Sicht optimal betreuen, deren Angehörigen kann sie aber kein Zusatzprogramm (Hotelbuchung, Freizeitgestaltung usw.) anbieten. |
| Low-Care-PatientInnen | Schnelle Behandlung im Ausland und sofortige Entlassung Die Nachversorgung kann im Hotel (oft in einem PatientInnenhotel oder in einer Hotelstation im Krankenhausverband) stattfinden. |
| GesundheitstouristInnen | Präventive Untersuchung bei ÄrztInnen im Ausland (Vorsorgeuntersuchung) |
| Medical-Wellness-TouristInnen | Wellnessangebote im Hotel Relevanz eines gesunden Lebensstils Mögliche Verbindung medizinischer Untersuchungen |
| Business-Health-PatientInnen | ArbeitgeberIn stellt einen Gesundheitscheck als incentive zur Verfügung. Hotelübernachtung und Rahmenprogramm im Paket enthalten |
| Reha-PatientInnen sowie Angehörige | Medizinische Behandlung inklusive Nutzung touristischer Angebote an den behandlungsfreien Tagen |
| Chronisch Kranke und Angehörige | Angehörige suchen nach einer Urlaubsmöglichkeit, die mit der Behandlung oder Versorgung einer kranken Person kombiniert werden kann. |
Tab. 3:
PatientInnentypen nach Juszczak und Ebel (2009: 103f.)
Cohen (2008: 25ff.) führt folgende Begriffe ein, um zwischen TouristInnen und PatientInnen zu unterscheiden: mere tourist, medicated tourist, medical tourist proper, vacationing patient, mere patient. Zur ersten Kategorie des mere tourist gehören jene Menschen, die einfach reisen wollen und keine medizinischen Dienstleistungen während des Urlaubs in Anspruch nehmen. Als medicated tourists gelten reisende Menschen, die sich während des touristischen Aufenthaltes einer ungeplanten dringenden Behandlung unterziehen müssen. Zur Gruppe des medical tourist proper zählen jene PatientInnen, die sowohl aus touristischen als auch medizinischen Gründen verreisen. Als vacationing patients gelten Personen, die eine Reise hauptsächlich aus medizinischen Gründen unternehmen und während des Auslandsaufenthaltes einige touristische Angebote in Anspruch nehmen. Die letzte Kategorie der mere patients bezieht sich schließlich auf PatientInnen, die während des Auslandsaufenthaltes nur eine medizinische Behandlung wünschen und kein touristisches Angebot nutzen.
Ein komplexeres Bild der MedizintouristInnen skizziert Mainil (2012: 48ff.).1 Um seine Typologisierung leichter nachzuvollziehen, werden in Tab. 4 die von ihm verwendeten Akronyme kurz erklärt.
| TBAs | Trans-border access seekers | PatientInnen, die lange, geplante Reisen unternehmen, zumeist über ausreichende finanzielle Mittel verfügen und sich hoch spezialisierte und qualitative Behandlung erwarten, die in ihrem Ursprungsland nicht vorhanden sind oder längere Wartezeiten erfordern |
| CBAs | Cross-Border access searchers | Menschen, die aus Grenzregionen stammen, oder Menschen, die einer Sprachgruppe angehören, die über mehrere Länder verstreut lebt und Anspruch auf Rückerstattungen oder Förderungen für die Kosten der Behandlung im Ausland haben oder hoch spezialisierte Behandlungen suchen |
| RCAs | Receiving context actors | Alle Einrichtungen und AkteurInnen, die für die medizintouristischen PatientInnen am Behandlungsort von Bedeutung sind |
| SCAs | Sending context actors | Alle Einrichtungen und AkteurInnen im Ursprungsland der medizintouristischen PatientInnen, wie zum Beispiel Versicherungsgesellschaften oder nationale Behörden |
Tab. 4:
Akronyme für die PatientInnentypen nach Mainil (2012: 57)
CBAs und TBAs unterscheiden sich voneinander wegen der Kulturnähe und -distanz. Für Erstere ist die Wahrscheinlichkeit höher, eine medizinische Behandlung in einem Land zu finden, die ihrem Ursprungsland in kultureller Hinsicht entspricht. TBAs bewegen sich hingegen zwischen Regionen mit größeren Kulturunterschieden und haben im Rahmen ihrer medizinischen Reise komplexere Herausforderungen zu meistern. Abb. 1 zeigt die möglichen Kombinationen der oben erwähnten Kategorien.
Abb. 1:
PatientInnentypen nach Mainil (2012: 57)
Die Kategorien 1A, 1B, 2A, 2B, 4A, 4B, 5A und 5B stellen eine heterogene Gruppe dar, deren VertreterInnen aus weit entfernten oder mehr oder weniger benachbarten Ländern stammen (CBAs oder TBAs) und sich in einer privaten oder öffentlichen ausländischen Einrichtung behandeln lassen. Sie können jedoch in allen Fällen auf eine öffentliche oder private Krankenversicherung zurückgreifen. Die PatientInnen der anderen Kategorien können jeweils CBAs oder TBAs sein, haben aber keinen Anspruch auf Rückerstattungen oder Förderungen für die Kosten der Behandlung, die in einer privaten oder öffentlichen ausländischen Einrichtung erfolgen kann (vgl. Mainil 2012: 57). Trotz seiner Komplexität zeigt dieses Modell ein facettenreiches Bild der PatientInnen im Rahmen des Medizintourismus und kann sehr hilfreich für ein tieferes Verständnis der an dolmetschvermittelten Interaktionen beteiligten AkteurInnen sein, denn auch die kulturelle Nähe oder Distanz zwischen Quell- und Zielland sowie die finanzielle Abwicklung der medizinischen Reise spielen eine wichtige Rolle hinsichtlich der Ermittlung ihrer Erwartungen und Anforderungen an die DolmetscherInnen.