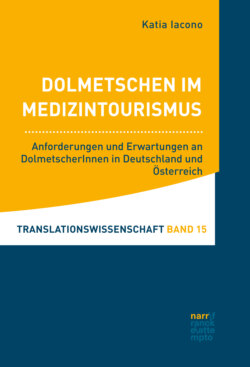Читать книгу Dolmetschen im Medizintourismus - Katia Iacono - Страница 17
1.7 Rechtliche Aspekte des Medizintourismus
ОглавлениеPatientInnen, die sich aufgrund einer medizinischen Behandlung ins Ausland begeben, benötigen Schutz: Ihre Grundrechte auf Leben und körperliche Unversehrtheit sowie ihr Selbstbestimmungsrecht sollen gewahrt bleiben (vgl. Reisewitz 2015: 23ff.). Das Recht auf körperliche Unversehrtheit ist in Art. 3 der Charta der Europäischen Union (GRCh) verankert; in Deutschland sind das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit zusätzlich in Art. 2 Abs. 2 S.1 GG festgeschrieben (vgl. Reisewitz 2015: 23ff.). Heileingriffe durch ÄrztInnen – auch eine einfache Blutabnahme, eine medikamentöse Heilbehandlung, physikalische Eingriffe oder Impfungen (vgl. Hauer 2014) – stellen Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit dar. Für all diese Heileingriffe ist eine gültige Einwilligung notwendig, damit das Selbstbestimmungsrecht der PatientInnen nicht verletzt wird: Jede/jeder PatientIn „hat das Recht, selbst zu entscheiden, ob und in welchem Umfang eine medizinische Behandlung an ihm durchgeführt werden soll“ (Reisewitz 2015: 26). Damit diese Entscheidung getroffen werden kann, ist eine genaue Aufklärung über die Chancen und Risiken der vorzunehmenden Behandlung durch die ÄrztInnen notwendig. Falls diese Aufklärungspflicht verletzt wird, liegt ein Aufklärungsfehler vor. Die Aufklärungspflicht sieht des Weiteren vor, dass PatientInnen auch über Behandlungsalternativen informiert werden, „wenn mehrere übliche Behandlungsmethoden mit unterschiedlichen Folgen, Risiken oder Erfolgschancen zur Verfügung stehen“ (Hauer 2014). Eine mangelhafte Aufklärung durch die ÄrztInnen kann zivilrechtliche Folgen haben und den medizinischen Eingriff rechtswidrig machen (vgl. Haspl 2010). Aus der Verletzung der Aufklärungspflicht können sich daher Schadenersatzansprüche für die PatientInnen ergeben: „Grundlage für den deliktischen Anspruch ist, dass durch einen Behandlungs- oder Aufklärungsfehler in absolute geschützte Rechtsgüter – nämlich Leben und Gesundheit – eingegriffen wird“ (Haspl 2010). Neben der zivilrechtlichen besteht auch eine strafrechtliche Haftung sowohl für die ÄrztInnen als auch für den Krankenanstaltsträger. Insbesondere bei Spontanbehandlungen, die während einer Reise erfolgen, kann es zu Verletzungen des Selbstbestimmungsrechts kommen, da sich die PatientInnen im Vorfeld nicht immer ausreichend über Risiken und Chancen des Eingriffs informieren können. Darüber hinaus ist das Risiko einer minderwertigen Behandlungsqualität bei einer Spontanbehandlung höher als im Rahmen einer geplanten Behandlungsreise (vgl. Reisewitz 2015: 31ff.). Um die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Aufklärungsfehlern zu reduzieren, muss gewährleistet sein, dass PatientInnen die Aufklärung zur Gänze verstehen. Dies kann in vielen Fällen nur durch die Beauftragung einer/eines DolmetscherIn erreicht werden.
Eine weitere Gefahr stellen Behandlungsfehler dar. Ein Behandlungsfehler tritt auf, wenn nicht der gesamte „Behandlungsvorgang, dem auf die konkrete Maßnahme anzuwendenden fachlichen Standard genügt“ (Reisewitz 2015: 33). Als Behandlungsfehler werden nicht nur Fehler bei operativen Eingriffen, sondern auch falsche Maßnahmen und Entscheidungen seitens der/des ÄrztIn im Laufe der gesamten Behandlung – von der Anamnese über die Therapie und Prophylaxe bis zur Nachsorge – bezeichnet; dies schließt auch Fehler in der Koordinierung oder in der Befunderstellung ein (vgl. Reisewitz 2015: 33). Bei Eingriffen im Rahmen des Medizintourismus ist eine Berufung auf den minderwertigeren Standard der Behandlung am Behandlungsort nicht ausreichend. Ein Behandlungsfehler „liegt vielmehr erst vor, wenn die tatsächlich erbrachte medizinische Leistung hinter dem nach dem anzuwendenden Recht maßgebenden Standard zurückbleibt“ (Reisewitz 2015: 33ff.). Falls die Betroffenen sich noch auf keinen Behandlungsstandard berufen können, werden die Ergebnisse der Grundlagenforschung sowie der angewandten Forschung und die ärztliche Erfahrung herangezogen (vgl. Tanczos/Tanczos 2010: 61ff.). Im österreichischen Bundesgesetz über die Ausübung des ärztlichen Berufes und die Standesvertretung der Ärzte wird Folgendes festgehalten: Eine/ein ÄrztIn „begeht einen Behandlungsfehler – der aber noch nicht zu einem Schaden des Patienten führen muss –, wenn er gegen anerkannte Regeln der medizinischen Wissenschaft (§49 Abs. 1 ÄrzteG) und der ‚ärztlichen Kunst‘ verstößt“ (Tanczos/Tanczos 2010: 61ff.). Lassen sich PatientInnen in einem Krankenhaus behandeln, ergeben sich sowohl für die Einrichtung als auch für die behandelnden ÄrztInnen Pflichten. Die PatientInnen schließen im Vorfeld mit dem Krankenhaus einen Behandlungsvertrag ab, in dem der Umfang der medizinischen Leistung festgehalten ist. Für den Behandlungsfehler haften nicht nur ÄrztInnen, sondern auch das gesamte während der Behandlung tätige medizinische Personal sowie die PatientInnen, die zur Bezahlung der Leistung und Mitarbeit im Sinne eines Behandlungserfolgs verpflichtet sind (vgl. Proissl 2014, Abs. 6). Bei Behandlungsfehlern liegt die Besonderheit des Medizintourismus darin, dass die internationale Zuständigkeit des Gerichts im Falle einer Klage der PatientInnen gegen die ÄrztInnen oder das Krankenhaus nicht immer klar ist (vgl. Reisewitz 2015: 39ff.). So wurden im Fall des von Spickhoff (2010: 60) erwähnten Distanzdelikts einem deutschen Bürger, der sich einer medizinischen Behandlung in der Schweiz unterzogen hatte, von einem Arzt Medikamente verschrieben, ohne dass dieser ausreichend über diese aufgeklärt worden war. Als es zu starken Nebenwirkungen kam, reichte der Patient eine Klage gegen den Arzt vor deutschen Gerichten ein. Das Oberlandesgericht in Karlsruhe und der Bundesgerichtshof „bejahten die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte unter dem Aspekt der Tatortzuständigkeit“ (Spickhoff 2010: 60). Der Erfolgsort in der Schweiz galt demnach als Tatort, da der Eingriff in die körperliche Unversehrtheit dort erfolgt war.
Missverständnisse, die sich in der Kommunikation mit den ausländischen PatientInnen ergeben, können rechtliche und medizinische Folgen haben. Wenn Basisdiagnose und Dokumentation der Krankengeschichte im Herkunftsland in einer anderen Sprache erstellt werden, besteht immer die Gefahr, dass diese z.B. während der Kontaktaufnahme mit dem medizinischen Personal im Ausland missverstanden werden (vgl. Reisewitz 2015: 28). Darüber hinaus nehmen PatientInnen nicht immer ihre gesamte Dokumentation auf die Reise mit, was sich aber in solch einem Fall als problematisch erweisen kann, da dem medizinischen Personal ein umfassender Überblick über die Krankengeschichte der PatientInnen fehlt (vgl. Reisewitz 2015: 28). In diesem Fall wird es schwierig, etwaige gesundheitliche Risiken der PatientInnen zu berücksichtigen und diese entsprechend in die Behandlung einzuplanen. Auch bezüglich der Nachsorge zu Hause oder im Fall eines enttäuschenden Verlaufs oder Misserfolges der Behandlung müssen medizintouristische PatientInnen und VertreterInnen der medizinischen Institution in der Lage sein, miteinander missverständnisfrei zu kommunizieren (vgl. Illing 2009: 98).