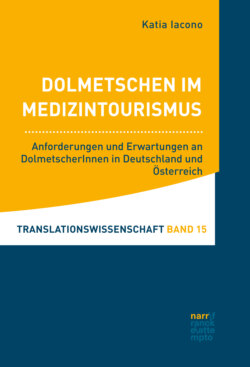Читать книгу Dolmetschen im Medizintourismus - Katia Iacono - Страница 9
1.3 Der Medizintourismus innerhalb der Europäischen Union
ОглавлениеAuch innerhalb der Europäischen Union reisen PatientInnen aus medizinischen Gründen. In diesem Kontext wird der Medizintourismus vorwiegend als PatientInnenmobilität bezeichnet. Durch die Einführung der Richtlinie 2011/24/EU – auch Patientenmobilitätsrichtlinie genannt –, die PatientInnen aus der EU, aus dem EWR-Raum sowie aus Liechtenstein, Island und Norwegen den Zugang zur sicheren und qualitativ hochwertigen grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung garantiert, wird die PatientInnenmobilität geregelt und begünstigt:
Diese Richtlinie zielt darauf ab, Regeln zu schaffen, die den Zugang zu einer sicheren und hochwertigen grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung in der Union erleichtern und die Patientenmobilität im Einklang mit den vom Gerichtshof aufgestellten Grundsätzen gewährleisten und die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der Gesundheitsversorgung fördern, wobei gleichzeitig die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für die Festlegung der gesundheitsbezogenen Sozialversicherungsleistungen und für die Organisation und Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen und medizinischer Versorgung sowie der Sozialversicherungsleistungen, insbesondere im Krankheitsfall, uneingeschränkt geachtet werden sollen. (RL 2011/24/EU)
Die Patientenmobilitätsrichtlinie schafft ein Regelwerk für die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten. Diese haben eine nationale Kontaktstelle einzurichten, die die BürgerInnen über ihre Ansprüche informieren soll, und sind für die „Festlegung der gesundheitsbezogenen Sozialversicherungsleistungen und für die Organisation und Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen und medizinischer Versorgung sowie der Sozialversicherungsleistungen […]“ zuständig (RL 2011/24/EU). Durch die Einführung der Patientenmobilitätsrichtlinie wurden PatientInnenreisen in Europa zumindest auf finanzieller Ebene erleichtert, denn die Kosten für die Behandlung in einem anderen EU-Land können bis zu der Höhe erstattet werden, die bei einer ähnlichen Behandlung im Inland angefallen wären (vgl. RL 2011/24/EU bzw. BMG 2016). Bei komplexeren Behandlungen, die ein „erhöhtes Planungsbedürfnis“ (BMG 2016, Pt. 14) aufweisen bzw. einen stationären Aufenthalt erfordern, ist meistens eine Genehmigung einzuholen. Die EU-Richtlinie schreibt vor, dass der Antrag in folgenden Fällen vor der Behandlung einzureichen ist: bei Übernachtungen im Krankenhaus, für Behandlungen mit „Einsatz einer hoch spezialisierten und kostenintensiven medizinischen Infrastruktur oder medizinischen Ausrüstung“ (RL 2011/24/EU, Art. 8 Abs. 2 Buchstabe a) und für Behandlungen mit einem Risiko für die PatientInnen (vgl. RL 2011/24/EU, Art. 8, Abs. 2, Buchstabe b). 14 EU-Länder verlangen einen solchen Antrag vor der Behandlung für die im Artikel 8 Abs. 2 Buchstabe a beschriebenen Eventualitäten; allerdings hat kein einziges dieser 14 Länder die Kriterien für die Kostendeckeng im Rahmen einer Übernachtung in einem Krankenhaus definiert (vgl. Europäische Kommission 2015b: 4ff.). Darüber hinaus haben nur neun Länder spezifiziert, welche Kriterien für die Hochspezialisierung herangezogen werden, obwohl dies laut Richtlinie verlangt wird. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit eines Antrags seitens der Krankenkasse kann je nach Herkunftsland 20 bis 150 Tage betragen (vgl. Europäische Kommission 2015b: 18). Diese Zeitspanne macht die langfristige Planbarkeit der Behandlung schwierig, da für eine Genehmigung in vielen Fällen die genaue Aufstellung der Kosten samt Datum der Behandlungen anzuführen sind. Einer der Gründe für eine positive Entscheidung seitens der Behörde im Herkunftsland sind die Kosten und die Verkürzung von Wartezeiten (vgl. Kirsch 2017: 31), während der Qualitätsfaktor nur eine untergeordnete Rolle spielt. Die Patientenmobilitätsrichtlinie sieht darüber hinaus vor, dass der Mitgliedsstaat, in dem die Behandlung erfolgt, PatientInnen aus anderen Mitgliedstaaten Informationen zur Verfügung zu stellen hat, anhand derer diese eine sachkundige Entscheidung treffen können (vgl. Spickhoff 2015: 17). GesundheitsdienstleisterInnen müssen detaillierte Informationen u.a. zu ihren Preisen und ihrem Zulassungs- oder Registrierungsstatus bereithalten. Dies bedeutet aber nicht, dass solche Informationen für PatientInnen mit einer anderen Sprache als jener des Ziellandes ausführlicher sein müssen (vgl. Spickhoff 2015: 17).
Aufgrund der dargelegten Beschränkungen stellen die Beantragung und Organisation einer Auslandsbehandlung trotz des erleichterten Zugangs zur medizinischen Versorgung innerhalb der EU für PatientInnen nach wie vor eine große Herausforderung dar. In der von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebenen Studie zur PatientInnenmobilität namens „Study on Public Service Translation in Cross-border Healthcare“ (vgl. Angelelli 2015) zeigte sich, dass PatientInnen, die der Sprache des Ziellandes nicht mächtig sind, trotz der erwähnten Richtlinie nicht den gleichen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben wie die im Zielland lebenden Menschen. Die gesetzlichen Bestimmungen der Europäischen Union enthalten keinen expliziten Hinweis auf die Zuständigkeit für die Zurverfügungstellung von Sprachdienstleistungen im Falle einer PatientInnenmobilität, was bedeutet, dass die PatientInnen selbst für die Beauftragung einer/eines DolmetscherIn oder einer/eines ÜbersetzerIn Sorge zu tragen haben (vgl. Angelelli 2015); darüber hinaus werden Übersetzungs- und Dolmetschkosten nicht zurückerstattet. Die fehlende gesetzliche Regulierung der Zuständigkeit sowie die nicht erfolgende Rückerstattung translatorischer Kosten können in manchen Fällen dazu führen, dass vonseiten der PatientInnen auf professionelle translatorische Leistungen verzichtet wird. Dies kann allerdings die Qualität und den Erfolg der medizinischen Behandlung negativ beeinflussen.