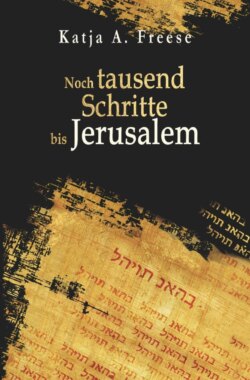Читать книгу Noch tausend Schritte bis Jerusalem - Katja A. Freese - Страница 4
Оглавление
TEIL I
Die Frage
Zum ersten Mal seit langer Zeit kam der Albtraum zurück. Obwohl er mich seit meiner Kindheit verfolgte, sich im Schatten meiner Knochen versteckt hielt, verlor er seinen Schrecken nie. Er war so wirklich, so endgültig wie eine Erinnerung.
Jerusalem. Ich zwänge mich durch die Gassen. Über mir erhebt sich der Tempel. Eine Rauchwolke entsteigt dem Opferfeuer und schwärzt das Blau des Himmels. Die Menschen drängen mich ab, sie ersticken mich mit ihrer grellen Sensationsgier, ich schwitze, ich würge, ich schreie, aber sie helfen mir nicht. Mich überkommt das verzweifelte Gefühl, laufen zu müssen, zu stoßen, zu beten, damit es nicht zu spät sein möge. Weiter! Weiter! Aber ich würde nicht rechtzeitig dort sein, um das Allerheiligste zu schützen. Ich gehe zu Boden. Ich kämpfe besessen darum, mich erheben, weiterlaufen zu können. Menschen trampeln über mich, bleiben auf meinem Körper stehen. Ich winde mich hin und her, mein Mund vor Qual aufgerissen, doch kein Laut entkommt ihm. Alles, was ich höre, ist ein dichtes Rauschen, das über dem Gekreische der Menge brennt. Ich spüre das vertraute Zittern in meinem Körper kurz vor einem meiner Anfälle. An dieser Stelle, mit diesem Zittern endete der Traum. Es war, als wäre ich vor dem Aufwachen zerbrochen.
Mit einem nach innen geatmeten Schrei fuhr ich hoch. Ich schlug um mich und sprang auf. Im Dunkeln stolperte ich gegen die Wand. Ich tastete mich vor bis zu dem kleinen Fensterloch, riss den Vorhang beiseite. Der Geruch von Regen wehte herein. Ich brauchte Kälte, Kälte gegen dieses Gefühl.
Wieso kam der Albtraum jetzt? Dass ich mich in Judäas Hauptstadt aufgehalten hatte, lag mehr als eine Woche zurück. Allerdings hatte ich dort keinen Schlaf gefunden, sondern vom Dach meiner Herberge aus das zusammengepferchte Volk beobachtet: ein großer köchelnder Eintopf fertig gegart zum Passahfest. Selbst aus der sicheren Höhe war es mir, als würde ich Teil dieses fauligen Leibes Jerusalem sein und in seiner drängenden Erregung untergehen.
Bis es dämmerte, stand ich in der Dunkelheit meiner Kammer und atmete mich still zitternd dem Morgen entgegen.
Am Mittag kam die Sonne durch die Wolken und trocknete die dunkelgeregneten Straßen Sepphoris. Den Weg entlang des Cardo Maximus betrachtete ich die Gebäude. Sie waren nach römischer Art gefertigt und durchaus prachtvoll. Doch wer einmal den glanzvollen weißen Marmor Roms erblickt hatte, sah in Sepphoris nur das, was es war: eine provinzielle Kopie aus Granit und Kalkstein.
Bald erreichte ich das Zentrum. Dumpfe Trommelschläge pulsten unter dem Gelärme der Marktbesucher, zogen mich hinein in den Alltag. Der Albtraum hatte sich vor dem Tageslicht geduckt und war gewichen; nur diesmal blieb ein Reißen in den Knochen zurück, wie eine Warnung.
Als ich in Höhe des Springbrunnens die Kunstschätze der Händler inspizierte, kam mir der Kaufmann Amos entgegen.
„Judas! Die Statue aus Byzanz ist eingetroffen! Ich sage dir, es ist eine unvergleichliche Kostbarkeit!“
„Und sicherlich hat sie auch einen unvergleichlichen Preis“, erwiderte ich und schob mich an einem Karren mit gefärbten Stoffen vorbei, um ihn zu begrüßen.
„Du weißt, wie hoch eure Familie in meiner Gunst steht, mein Freund. Habe ich euch je übervorteilt? Tatsächlich verarme ich bei unseren Geschäften regelrecht!“
„Erzähl mir mehr von der Statue und welche Angebote dir Samuel und Titus Flavius unterbreitet haben.“
Amos zwirbelte seinen Bart und schüttelte den Kopf. „Titus wird noch heute in mein Geschäft kommen. Und Samuel? Der ist ein Halsabschneider, er glaubt, die Statue für den Preis eines Brotes zu bekommen! Im Gegensatz zu dir versteht er nichts von Kunst! Du wirst die feine Arbeit der Gesichtszüge zu schätzen wissen, sie ist anbetungswürdig ...“
„Dann zeig sie mir.“
Unter weiteren Lobesworten führte Amos mich zielsicher durch die Menge in sein Geschäft hinein. Im vorderen Bereich ging es laut zu, Amos’ Neffe schien mit drei Kunden gleichzeitig um verschiedene Waren zu feilschen. Wir gingen durch einen Korridor in das dunkle Lager; nur schemenhaft konnte man einen Umriss in dessen Mitte ausmachen. In der Stille hielt ich den Atem an und beobachtete, wie Amos bedächtig das hölzerne Tor zum Innenhof aufstieß. Gleißendes Tageslicht und das Raunen der Stadt erfüllten sogleich den Raum. Amos zeigte mit gesenktem Blick – als würde er einer Göttin ansichtig – auf eine Frauenstatue, die mir bis zur Schulter reichte. Erwartungsvoll ging ich näher. Amos hatte nicht übertrieben, sie war kunstvoll gearbeitet, der rosafarbene Marmor unterstrich die Zartheit ihrer Haut. Die größte Kunst bestand für mich darin, die steinernen Gesichter sprechen zu lassen. Doch alles, was ich in diesem Antlitz lesen konnte, langweilte mich bereits nach einem Moment. Das Gesicht zeigte nichts als zarte Lieblichkeit, die Augen enthielten bloße Leere. Ich schüttelte den Kopf.
„Nein?!“, rief Amos aus. Er wirkte, als wollte er auf die Knie sinken.
„Sieh genau hin, Judas!“ Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, trat er hinter die Statue und drückte ihre glatten Schultern wie die einer heiratsfähigen Tochter, die sich nicht richtig zu präsentieren wusste.
„Ja, der Torso ist hervorragend gearbeitet, das ist wahr, jede Gewandfalte einwandfrei.“ Ich strich mit einem Finger über das kühle Rosa ihrer Hüfte und schaute dann bedauernd auf das Frauengesicht. „Vielleicht ohne Kopf ...“
Amos schlug sich die Hände vors Gesicht.
„Ich hatte bereits deinem Onkel von dieser Lieferung berichtet! Ich sagte ihm, es sei das Abbild Lavernias. Er war sehr interessiert!“
„Glaub mir, meine Tante wäre nicht geschmeichelt, und ihr Blick ist gnadenloser als meiner.“
Mein Onkel hatte keinen Sinn für wahrhaft Schönes, ebenso wenig mein Vater. Tiefer als auf die Oberfläche von Ding oder Mensch vermochten sie nicht zu sehen. Lavernia hatte es rasch verstanden, mich für die wirklich wichtigen Verhandlungen einzusetzen, so wie sie von jeher die Geschicke dieser Familie lenkte.
In diesem Moment betrat Titus Flavius Crispus – ein befreundeter Händler – das Lager. Er strich sich über sein ungewöhnlich blondes Haar und sagte: „Ich hatte gehofft, vor dir hier zu sein, Judas! Mit Samuel kann ich es leicht aufnehmen, doch wir zwei werden lang um diese Frau kämpfen müssen.“
Er rieb sich lächelnd die Hände. Amos zeigte auf mich und klagte, noch ehe ich Titus begrüßen konnte: „Er will ihr den Kopf abschlagen!“
Ich zuckte mit den Schultern, und Titus lachte. Er näherte sich der Statue und fasste ihr unters Kinn. Eine Weile studierte er das Gesicht, während Amos den Atem anhielt und so geduckt dastand, als erwartete er Schläge.
„Was missfällt dir an ihr, Judas?“, fragte er und strich ihr über die glatten Lippen. „Ihre Schönheit ist makellos und wird im Gegensatz zu der meines Eheweibes niemals welken!“
Amos atmete laut auf. Ich trat neben Titus und musterte den rosafarbenen Marmor der Statue.
„Ihr Anblick lädt zu keiner Frage ein und somit nicht zum Verweilen“, sagte ich. „Ihr Gesicht verrät dem Betrachter nur eines: dass der Bildhauer ein begnadeter Handwerker, aber kein Künstler ist.“
Ich sah, wie Amos seine Hände rang.
„Nun, Amos“, sprach Titus, „mir persönlich genügt begnadete Handwerkskunst.“
Amos seufzte erleichtert. „Wenigstens einer von euch schätzt ihre Vollkommenheit!“
Ich zwinkerte Titus zu und begann, durch das Lager zu schlendern, während er und Amos miteinander verhandelten. Als ich meine Runde beendet hatte, sahen beide höchst zufrieden aus.
Nach einer Schale Wein und der üblichen Höflichkeitszeremonie verabschiedeten wir uns von Amos und traten durch die Ladentür auf die dicht bevölkerte Straße. Titus legte kurz seine Hand auf meine Schulter, als ich mich einem weiteren Geschäft zuwenden wollte.
„Ich bin zu einem Essen geladen, bei dem du nicht fehlen solltest“, sagte er. „Die Gäste werden dich vielleicht interessieren, einer kommt geradewegs aus Athen und wird ein würdiger Redner für deine philosophischen Debatten sein. Er hofft, dich zu treffen.“
Ich überlegte einen Augenblick und nickte dann. Wein und Unterhaltung waren vermutlich die richtige Ablenkung, um die Nacht aus den Knochen zu bekommen.
„Die Griechen mögen kluge Männer, die schön sind“, scherzte Titus.
„Die Römer geben sich mit bloßer Schönheit zufrieden“, versetzte ich, und er lachte.
Während wir uns an den Marktbesuchern vorbeischlängelten, ließ ich meinen Blick über die Menschen wandern. Im Gegensatz zu der byzantinischen Statue aus Amos’ Lager trugen diese Gesichter Geschichten in sich, sie erzählten von dem Land, in dem sie lebten. Sowohl der Winter als auch die jährliche Steuer hatte den ein oder anderen Riss in die Haut gezogen und manches Haar geweißt. Zudem kam das Joch hinzu, von Römern und Sadduzäern regiert zu werden. Durch die Heirat meines Onkels mit einer Römerin lebte ich teils in der römischen, teils in der jüdischen Welt, die gegensätzlicher nicht hätten sein können. Es war, als hätte ich mein Leben lang versucht, mich im sandigen Wüstenboden und gleichsam im Wasser zu verwurzeln.
Ich folgte Titus die überdachten Säulengänge entlang bis zu einem der Häuser, die mit Fresken verziert waren und mit rotem Ziegeldach glänzten. Ein Sklave geleitete uns durch das kühle Innere in einen prächtigen Speiseraum; hier lagen bereits mehrere Männer auf gepolsterten Bänken zu Tisch und begrüßten uns begeistert.
„Freunde!“, rief Titus. „Wer ihn noch nicht kennt: Dies ist Judas Iskarioth, ein erfolgreicher Kunsthändler und äußerst kluger Mann.“
Ich schüttelte den Kopf über diese theatralische Vorstellung. Die Anwesenden nutzten die Gelegenheit und griffen zu ihren Weinschalen, um uns zuzuprosten. Nur wenige vertraute Gesichter waren unter ihnen. Titus und ich suchten uns eine Bank zwischen dem Dutzend Männer und ließen uns nieder. Mir gegenüber lagerte der Philosoph, der ein klassischeres Profil nicht hätte haben können.
„Sei mir gegrüßt“, sprach er freundlich auf Griechisch und hob noch einmal seine Schale. „Ich bin Zenon aus Athen und immer erfreut, mein Wissen gegen ein anderes zu stellen.“
Ich griff ebenfalls zum Wein und hob an.
„Ihr werdet enttäuscht sein, Zenon, denn ich habe nicht vor, gegen euch anzutreten“, sagte ich ebenso freundlich, und die meisten blickten auf. „Mir geht es nicht darum, mein Wissen zu testen, sondern es zu erweitern, und zwar um die eine bedeutende Antwort, die mir fehlt.“
Zenon setzte sich auf und sah mich mit einer Mischung aus Argwohn und Interesse an.
„Wie lautet die Frage?“
„Ich frage mich, warum das Leben so beschissen und Gott so ein quälender Mistkerl ist, der es nicht schafft, dem Menschen eine einfache Antwort zu geben“, sagte ich ernst. Verblüffte Gesichter schauten mich an, dann erfüllte brüllendes Gelächter den Speiseraum; selbst Zenon stimmte mit ein.
Ein Mann mit leicht schräg stehenden Augen grinste mir zu und sprach: „Nun, ich muss zugeben, dass du zu der einzig richtigen Frage gelangt bist!“
Ich lächelte zurück. Er stellte sich als Thomas aus Caesarea Philippi vor. Zenon sah seine ernsthafte Diskussion gefährdet und befragte den Mann, der auf der anderen Seite neben mir lag. Mit seiner makellos weißen Toga und dem großen, muskulösen Körper wirkte er wie die zum Leben erweckte Vorlage des Helden Herakles.
„Ich mache mir nichts aus Philosophie“, antwortete er in gebrochenem Griechisch und ließ seinen Blick über mich wandern.
Zenon – merklich angetan von dem makellosen Hünen – versuchte es weiter und fragte ihn nach seinem Namen. Der Hüne schaute noch immer in meine Richtung, reichte mir eine Platte mit Hummerfleisch herüber und sagte: „Ich bin Marcus Iunius Scipio aus Rom. Ich soll mich einige Zeit in diesem Land aufhalten, um es kennenzulernen.“
Ich lehnte den Hummer ab und nahm mir Brot und gewürzte Feigen.
„Und was hast du bereits gesehen?“, fragte Zenon weiter.
„Sepphoris.“
Ich konnte ein Lachen nicht unterdrücken, und Marcus sah mich erstaunt an.
„Sepphoris“, begann ich, „ist die Nachbildung einer römischen Stadt, erbaut auf den Überresten eines 1000-Seelen-Dorfes, dessen jüdische Einwohner allesamt von den Römern in die Sklaverei verkauft worden sind. Hier gibt es nichts, was du nicht schon kennen dürftest, nicht wahr?“
Marcus riss die Augen auf und sagte rasch: „König Herodes Antipas hat hier seinen Palast!“
Der Philosoph Zenon bewunderte offenkundig Marcus’ Erscheinung, aber schien nun doch froh, einem Gespräch mit ihm entgangen zu sein.
Titus warf ein: „Du bist Römer wie ich, Marcus. Was glaubst du, wer in diesem Land das Sagen hat?“
Marcus schaute verwirrt.
„Es gibt keinen König der Juden mehr, dafür hat euer Kaiser gesorgt. Herodes Antipas ist lediglich Tetrarch von Galiläa und Peräa“, half ich ihm aus der Misere. „Das Herz dieses Landes ist Jerusalem, dort wirst du eindeutig mehr über Israel erfahren.“
Ich biss von dem hellen weichen Brot ab.
„Jerusalem.“ Marcus nickte. „Davon habe ich schon mal gehört.“
„Ach.“ Ich verschluckte mich. Rasch drehte ich meinen Kopf in die andere Richtung und fing das verstehende Grinsen von Thomas auf. Ich verlor mich in einem Hustenanfall. Marcus streckte seinen Arm aus und klopfte mir erschreckend sanft auf den Rücken. Ich trank aus meiner Weinschale und wartete darauf, dass er seine Hand von mir nehmen würde. Damit hatte er es nicht eilig und schob mir stumm einen Delikatessenteller zu.
„Judas“, sprach Thomas mich an, „du musst mir unbedingt mehr von Gott erzählen. Du scheinst ihn gut zu kennen!“
„Oh ja, ich bin ein großer Bewunderer seines Könnens.“ Ich beugte mich absichtlich weit über den Tisch, um nach den Honigmandeln zu greifen, doch Marcus’ Hand rutschte lediglich meinen Rücken herab und blieb unangenehm vertraulich auf Höhe meiner Nieren liegen. Ich widerstand dem Drang, seine Hand wegzudrücken und bat ihn stattdessen, mir die schwere Platte mit den aufgestapelten Barben herüberzuziehen. Freudig, mir einen Gefallen tun zu können, ließ er mich los und langte mit beiden Händen nach der Silberplatte. Thomas nutzte die Gelegenheit, den Platz zu wechseln und drängte sich zwischen Marcus und mich. Er lächelte den enttäuschten Hünen an und nahm sich von dem Fisch.
„Ah, großartig! Gespräche über Gott machen mir immer Appetit.“ Er schlang genüsslich das weiße Fleisch herunter und fragte mich: „Ich nehme an, Johannes den Täufer hast du dir schon angehört?“
Ich nickte.
„Und?“
Ich winkte ab. „Zu weltfremd.“
„Um Himmels Willen, ja! Sollen wir uns allesamt in die Wüste schlagen und nichts mehr essen?“ Allein bei diesem Gedanken schien Thomas noch mehr Appetit zu bekommen, warf sich einige Datteln in den Mund und kaute kopfschüttelnd.
„Wenn Johannes dir zu wenig Unterhaltungswert besitzt, dann müsste dir Simon Magus mit seinen Zauberkunststücken besser gefallen“, folgerte ich augenzwinkernd. Thomas lachte laut.
„Ich muss zugeben, er hat mich nicht schlecht unterhalten. Seine Verrenkungen, als er in geistige Ekstase geriet, waren wirklich amüsant!“
„Amüsanter fand ich die Frauen, die zuhauf vor seinen Füßen in Ohnmacht fielen.“
„Ja! Ein magischer Wahnsinniger müsste man sein ... “, sprach Thomas und tippte dann an seine Schläfe. „Wo wir gerade von Weibern reden: Hast du vielleicht schon von dem Lehrer gehört, der auch Frauen unterrichtet? Mein Vetter hat mir von ihm erzählt, doch ich erinnere mich nicht mehr an seinen Namen.“
„Er unterrichtet Frauen? Von so einem habe ich noch nichts gehört.“
Thomas sah von seinem Fisch auf und nickte. Nachdenklich griff ich nach meiner Weinschale.
„Weißt du, wo er anzutreffen ist?“, fragte ich nach einem langen Schluck. „Wenn ich in der Gegend sein sollte, würde ich ihn mir anhören.“
Thomas zuckte bedauernd mit den Schultern und nickte unauffällig zu Marcus. Er beobachtete mich noch immer. Ihm gegenüber stopfte sich der Philosoph den Bauch mit Hummerfleisch voll und starrte seinerseits Marcus an. Thomas zog vielsagend die Augenbrauen hoch.
Bis zum frühen Abend tranken und redeten wir, dann ermüdete ich und verabschiedete mich von der Tafel.
„Ich breche morgen nach Caesarea Philippi auf, aber möglicherweise sehen wir uns wieder“, sagte Thomas zum Abschied.
Ich war mittlerweile angetrunken und folgte bedächtiger als üblich einem Diener zur Tür. Ich bedankte mich und trat nach draußen in die Nacht. Ich drehte mich um, als ich hinter mir Schritte vernahm, und sah mich Marcus – dem Herakles – gegenüber; im Stehen wirkte er noch sehr viel imposanter. Doch offenbar wusste er nicht, was er sagen sollte.
„Willst du auch gerade gehen?“, fragte ich in das unangenehme Schweigen.
„Äh, ja.“ Marcus folgte mir nach draußen auf die belebte Straße. Ich konnte es kaum glauben, dass er wieder seine Hand auf meinen Rücken legte. Sie war wie ein Tier, das man nicht abschütteln konnte.
„Bist du es gewohnt, immer zu bekommen, was du dir wünschst?“
Überrascht antwortete er: „Ja, meistens.“
„Und wie ist das so? Ist das Leben nicht trotzdem in seinem dunklen Innern beängstigend und zutiefst beunruhigend?“, fragte ich und starrte in seine hellen Augen. Ich dachte an all die tiefen Stunden, welche einem jeden von uns auflauerten, schwarz und einsam.
„Ja“, stammelte Marcus und ließ mich los.
Ich wandte mich ab. „Gute Nacht, Held.“
Er folgte mir nicht. Ich suchte mein Zimmer auf und ließ mich erschöpft auf das Lager fallen. Ich sank in einen Halbschlaf voll von Stimmen und Menschen, die mich bedrängten, träumte von einer Verhandlung, die ich über eine unaussprechliche Kostbarkeit führte, ein heiliges Artefakt, das ich schützen musste. Ich verhandelte, versagte. Und dann rannte ich. Ich rannte. Zerbrach.
„Guten Morgen, mein Freund.“ Im Stall der Herberge zwischen Mauleseln und Kamelen stand mein Hengst David, ein vertrauter Schatten im frühmorgendlichen Zwielicht. Ich streichelte seinen schwarzen Kopf und blieb an seiner Flanke lehnen; er roch beruhigend nach Wärme und Verlässlichkeit. Als die Stille durch das Geschrei der Maulesel so leicht zerriss wie Seide, griff ich nach seinem Zaumzeug. „Lass uns aufbrechen.“
Ich sattelte ihn und führte ihn aus der Stadt heraus Richtung Bet Schean. Ich mied die Hauptstraße, da sich die letzten Passahfestbesucher auf den Heimweg gemacht und Judäa dicht gedrängt verlassen hatten. Sie zogen zu Fuß – oder ritten wie ich – über die staubigen Wege.
Erst gegen Mittag erreichte ich mein erstes Ziel. Ich erledigte meinen Besuch bei einem der ansässigen Händler und verhandelte mit ihm erfolgreich über eine Ladung feiner ägyptischer Stoffe. Schließlich ritt ich den Weg am Jordan entlang.
Auf der Straße war ein Lärm wie auf dem Markt. Tatsächlich hatten sich an den Karawansereien kleine Marktplätze gebildet; an einem von ihnen hatte ich das Bedürfnis, Halt zu machen, obwohl weder mein Pferd noch ich müde waren. Ich versorgte David und band ihn in Sichtweite fest. Manche Händler boten ihre Waren direkt vom Karren feil. Ich erfrischte mich mit einem Schluck Wasser, kaufte bei einem Mädchen, das auf einem verschlissenen Teppich hockte, eine Handvoll Mandeln und studierte das Angebot. Ich verweilte bei einem Händler aus Persien, der interessante Spielereien mit sich führte. Süßlicher Duft entstieg einem Messinggefäß; die rauchigen Schwaden füllten für einen Augenblick meinen Kopf und ließen meine Gedanken langsamer werden. Ich wandte mein Gesicht zur Seite. Ein Goldgebilde glänzte von der Sonne getroffen und zog meinen Blick auf sich, es war rund wie ein Ball und bestand aus dünnen Bögen. Ein Astrolabium?
„Was kann man damit einfangen?“, fragte der Händler mich und lud auch die Umstehenden ein näherzutreten.
„Vielleicht einen Dämon?“, kam eine laute Stimme auf. Ein großer Kerl – rau wirkend wie ein Seemann – drängte sich zu uns und schob dabei einen Jungen mit Locken nach vorn.
„Keinen Dämon, nichts dergleichen!“, wehrte der Perser ab und reichte mir das Goldobjekt. Ich hielt es hoch und betrachtete das windige Blau des Himmels durch die Verstrebungen.
„Die Sterne“, sagte ich. Der Junge fing an zu lachen.
Der Große wandte sich nach hinten und fragte: „Was meinst du, Jeshua?“
„Ja, Rabbi“, fiel auch der Junge ein, „was meinst du?“
„Ich denke dasselbe, ich weiß nur nicht, wie man es verwendet.“
Die Stimme, die geantwortet hatte, klang angenehm warm und rief mir die Farbe rötlichen Wüstensandes vor Augen. Ich drehte mich nach diesem Rabbi namens Jeshua um. Es gelang mir aber nicht, mehr als eine Schulter von ihm zu sehen und braunes Haar, das auf sie fiel. Der Große hatte sich wieder vor mich gedrängt und zeigte auf das Astrolabium, das vergessen zwischen meinen Fingern ruhte.
„Weißt du, wie es funktioniert?“, fragte er mich. Ich hob die Kugel mit einer Hand in die Luft, mit der anderen Hand deutete ich auf ihre Verstrebungen.
„Wenn man sich einen festen Punkt aussuchen würde, wie vielleicht diesen spitzen Pfahl auf dem Zelt dort drüben, und es Nacht wäre, könnte man verfolgen, wie die Gestirne sich bewegen.“
„Ach so“, nuschelte der Große. Wie es aussah, hatte er kein Wort verstanden.
„Richtig, richtig!“, rief der Händler aus und riss mir das Gerät aus den Händen, um es für alle Augen sichtbar noch einmal in die Höhe zu halten. „Es ist ein Astrolabium! Mit ihm können die persischen Magi Berechnungen über die Himmelsbilder anstellen.“
Wind kam auf und ließ die feinen Glöckchen an einem benachbarten Wagen klingeln.
„Hörte einer unter euch von der ungewöhnlichen Sternkon-stellation, welche die Magi vor dreißig Jahren errechnet haben?“, fuhr der Händler fort.
„Ich hörte davon, denn ich bin unter dieser Konstellation geboren worden.“ Überraschenderweise war es Rabbi Jeshua, der geantwortet hatte und nun hinter dem Großen hervortrat. Ich konnte ihn nur im Profil sehen. Irritiert runzelte ich die Stirn, denn eine unerklärliche Erleichterung erfasste mich bei seinem Anblick. Kannte ich ihn von irgendwoher?
„Oh, welch glückliches oder unglückliches Omen, mein Herr“, sagte der Perser mit dunkler Stimme.
„Vielleicht beides“, antwortete Jeshua leichthin und legte den Kopf etwas schief. „Wir würden das Glück ohne das Unglück, die Ordnung ohne die Missordnung nicht erkennen!“, sprach er, und ich lauschte aufmerksam, während ich es nicht schaffte, meinen Blick länger auf seinem Gesicht verweilen zu lassen. Mir fiel wohl auf, dass er so groß war wie ich selbst, und dass er schlanke, aber kräftige Hände hatte, denen Arbeit nicht fremd war.
„Welch weise Worte“, murmelte der Perser und zog geschäftstüchtig das nächste Objekt aus einem Holzkästchen hervor.
„Darf ich ein weiteres Rätsel vorführen?“, wandte der Händler sich damit an mich. Mit einem Mal fühlte ich mich eigenartig benommen, vielleicht von dem süßlichen Rauch, der wieder in meine Richtung trieb. Ich hatte das Bedürfnis, mich zu setzen und schüttelte daher den Kopf.
„Oh, so ein feiner, gebildeter Mann interessiert sich doch gewiss für dieses rätselhafte Amulett!“
„Es ist nicht rätselhaft, es ist ein Kalender“, sagte ich kurz angebunden. Ich nickte dem Händler zu und ließ mich von der Menge verschlucken wie einen Bissen Brot.
Einige Schritte von der Straße entfernt setzte ich mich auf den steinigen Boden und schloss die Augen. Doch bereits nach kurzer Zeit packte mich eine schmerzhafte Unruhe wie plötzlicher Schüttelfrost, und ich kehrte zur Straße zurück. Der Stand des Persers war längst von anderen Menschen umringt.
Die Reisenden bewegten sich wie eine Kolonne von Ameisen die Straße hinunter. Plötzlich sah ich Rabbi Jeshua neben dem Großen wandern und presste meine Füße unwillkürlich an den Bauch des Pferdes. David wieherte. Jeshua ging unbeirrt weiter, doch der Große drehte sich um und entdeckte mich.
„Der Mann, der so viel über die Sterne weiß!“, rief er und blieb stehen. Eines der Kinder der Familie vor mir wankte gegen ihn und verfing sich kreischend in den Falten seines Gewandes. Ohne mit der Wimper zu zucken, griff er das Kind mit einem Arm und reichte es der Mutter zurück.
„Kennst du vielleicht ein Rätsel, das du mir mit auf den Weg geben kannst?“, fragte er mich und klopfte Davids Flanke. Eine Frau drehte sich zu uns, sie schien nicht älter als Anfang zwanzig zu sein.
„Als wenn du nicht genug zum Nachdenken hättest, Nathanael“, neckte sie den Großen. Ihr Haar wellte in der Farbe dunklen Abendrots unter einem Kopftuch hervor. Ich nickte grüßend, und sie hielt meinem Blick stand. Das gefiel mir. Sie erinnerte mich an ein Bildnis der Göttin der Jagd, das ich in Rom bewundert hatte; der Künstler hatte Diana mit einer frischen, kühnen Schönheit dargestellt.
„Pah. Lass mich bloß in Ruhe, Marjam“, antwortete Nathanael und hob beide Hände beschwörend in die Luft.
„Wohin seid ihr unterwegs?“, fragte ich die beiden.
„Wir wollen nach Kefar Nahum“, antwortete Marjam. Mir fiel auf, dass sie für diesen langen Marsch mit nichts weiter als einem Bündel gerüstet waren. Nicht einmal einen Gehstock hatte einer von ihnen zur Hand.
„Ich selbst will nach Tiberias.“
„Dann haben wir ein Stück gemeinsamen Weges“, sagte Nathanael erfreut und ließ gutmütig zu, dass David ihm die Schulter stupste.
Es versprach, ein warmer Nachmittag zu werden. Da ich die Wanderer und Maulesel überragte, stieg ich ab und führte David am Zügel weiter, bis die Menge sich lichten würde.
Nathanael hatte sich nach vorn drängen lassen, so dass sich nun Marjams und meine Schritte aufeinander einstimmten. Ich betrachtete sie immer wieder von der Seite.
„Wenn du müde wirst, kannst du gern mein Pferd reiten“, bot ich ihr an, aber sie winkte ab.
„Ich habe Übung im Wandern“, sprach sie und zeigte auf ihre Füße, die fast gänzlich unter ihrem Rock verborgen waren. Dann wies sie nach vorn und sagte: „Dort neben Nathanael geht Jeshua. Ich folge diesem Mann seit einem halben Jahr. Ich weiß nicht, wie viele Schritte ich schon mit ihm zurückgelegt habe.“
In diesem Moment drehte Jeshua sich um und kratzte sich leicht im Nacken. Er nickte in unsere Richtung. Ehe ich das Nicken erwidern konnte, hatte er sich bereits wieder umgewandt. Ich starrte auf seinen Hinterkopf und fragte Marjam: „Ist er dein Ehemann?“
„Nein. Er ist mein Lehrer.“
„Dein Lehrer?“ Ich blieb stehen, und David zerrte ungehalten an seinem Zügel. „Er unterrichtet Frauen? Dann habe ich schon von ihm gehört!“
Marjam hielt ebenfalls an und musterte mich. Sie zog ihr Kopftuch etwas höher.
„Ja, Jeshua ist ein außergewöhnlicher Lehrer. Er ist die Antwort auf meine Fragen.“
Überrascht sah ich sie an. „Kann ein Mensch eine Antwort sein?“
„Nicht irgendein Mensch, aber dieser kann.“ Sowohl ihre Worte als auch ihr Blick verrieten tiefe Überzeugung. Schweigend wanderten wir weiter. In Gedanken versunken betrachtete ich Jeshua und schüttelte den Kopf. Der Abstand zwischen uns schien sich auf dem gesamten Weg um keinen Fuß zu verringern.
Als die Sonne langsam über dem Erdboden flimmerte und glühend mit der spröden Umgebung verschmolz, fragte Nathanael, ob ich nicht bei ihnen lagern wollte. Auch Marjam forderte mich auf zu bleiben, und so willigte ich zögernd ein. Ich versorgte David und gesellte mich dann zu Marjam und Nathanael. Er schichtete ein paar dürre Zweige und getrockneten Kameldung auf und entzündete ein Feuer, während Marjam anfing, die Zutaten für einen Brotteig in einer flachen Tonschale zu vermengen. Jeshua hatte sich ein Stück abseits am Rande eines Felsens niedergelassen und blieb unbewegt dort sitzen. Ich betrachtete seinen geraden Rücken.
„Bitte iss mit uns“, bot Marjam an, als der erste Fladen ausgebacken war. Dankbar nahm ich Brot und Oliven von ihr entgegen. Sie entschuldigte sich bald darauf und verschwand außer Sicht. Nur Nathanael schien froh, sich unterhalten zu können. Er strich durch seinen Bart, wies mit seinem Kinn in Jeshuas Richtung und sagte: „Es soll den Geist befreien. Du weißt schon: von allem, was so stört.“
Nathanael langte nach dem nächsten Brot und aß es hungrig.
„Zu welcher Gemeinschaft zählt euer Lehrer sich?“, fragte ich und ließ meinen Blick zu Jeshua wandern, der im Rot der Felsen saß und Richtung Westen schaute. Die Sonne ging gerade unter.
„Och“, machte Nathanael und rieb sich die Krümel von den Lippen, „zu keiner, er hat seine eigenen Ideen.“
Ich runzelte nachdenklich die Stirn und spuckte einen Olivenkern aus.
Nach einiger Zeit kehrte Marjam zurück. Sie drehte sich zu Jeshua, als würde sie sich fragen, warum er nicht ans Feuer kam.
„Euer Lehrer ist nicht sonderlich gesprächig“, bemerkte ich.
Marjam schüttelte den Kopf. „Ich weiß auch nicht, was er heute hat. Normalerweise unterhält er sich viel.“
Nathanael nickte. „Kann man wohl sagen.“
„Ist es sicher, dass ich ihn nicht störe?“, fragte ich und überlegte, ob ich nicht doch zur nächsten Herberge reiten sollte.
„Natürlich störst du nicht“, antwortete Marjam. „Er hat mir vorhin gesagt, dass er sich über deine Anwesenheit freut.“
Nathanael und ich blickten Marjam erstaunt an.
„Rabbis sind eigenartig, kann ich dir sagen“, sprach Nathanael zu mir und verdrehte die Augen.
„Nathanael“, stöhnte Marjam, „rede nicht so einen Unsinn.“
Er machte eine wegwerfende Handbewegung. „Pah! Jeshua ist eigenartig. Er weiß Dinge, die nicht normal sind und ...“
„Redet ihr von mir?“, fragte Jeshuas gelassene Stimme, und Nathanael wurde rot. Jeshua setzte sich zwischen ihn und Marjam und grinste ein wenig, sagte aber nichts. Ich sah, wie Marjam ihn abwägend anschaute. Er nahm sich von dem Brot und kaute schweigend. So wandte sie sich mir zu und fragte nach meinem weiteren Weg. Ich berichtete von meinen Geschäften in Tiberias. Jeshua hörte still zu, zumeist den Blick in die niedrigen Flammen gerichtet. Ich bemühte mich, ihn nicht anzustarren, denn das war genau das, was ich tun wollte. Weil er mir eigenartig vertraut vorkam, wie ein Traumschatten, an den man sich zu erinnern sucht und der doch im Laufe des Tages in sich selbst versinkt.
Als Nathanael etwas zu erzählen begann, zog es meine Aufmerksamkeit erneut zu Jeshua. Er sah im gleichen Moment zu mir. Sein Blick war unmittelbar und hell, als brannte auch in ihm eine Frage, auf die er keine Antwort fand. Mich ergriff die gleiche Unruhe, die ich auch nach unserer ersten Begegnung am Stand des Persers verspürt hatte. Wir wandten uns beide wieder Nathanael zu, der berichtete, wie er zu viel getrunken hatte und neben einem Ziegenkadaver aufgewacht war. Irgendwann konnte ich dem Drang nicht widerstehen, noch einmal zu Jeshua zu sehen. Genau wie er. Er lächelte überrascht und senkte seinen Blick zurück zu den Flammen.
Schönheit, dachte ich und konnte mich nicht vom Anblick seines Lächelns lösen, das ist Schönheit.
Wir legten uns bald darauf zur Ruhe. Alle drei wünschten mir eine gute Nacht. Aber die hatte ich nicht. In Davids Nähe wand ich mich unruhig auf dem steinigen Boden, lauschte den Schreien ferner Schakale und dem Wind, der um die Felsen trieb. Als der Morgen dämmerte, hatte ich die ganze Nacht lang die Dunkelheit durchstarrt.
Ich erhob mich im Zwielicht und schüttelte den Sand aus meinem Umhang. Nathanaels Schnarchen durchbrach die Stille. Jeshua war nirgends zu sehen, aber Marjam begrüßte mich leise. Sie bat mich zum Frühstück zu bleiben, aber der Drang, dieser befremdlichen Situation zu entkommen, ließ mich direkt aufbrechen.
Ich führte David zurück auf den Weg, der noch wunderbar leer war. Ich schwang mich auf seinen Rücken und spornte ihn zum Laufen an. Der beste Ort, an dem ich jemals war, stellte der in Bewegung dar, der, wo ich nicht stehenbleiben musste, wo mich niemand zu fassen bekam, einfach irgendwo zwischen zwei Punkten.
Ich ritt auf den See Tiberias zu und besuchte die gleichnamige Hauptstadt Galiläas. Diese neue Stadt des Herodes Antipas bekam allmählich einen größeren Anteil jüdischer Bevölkerung, trotz der Aussicht, auf alten Gräbern wohnen zu müssen.
Ich pflegte meine Kontakte zu den vorwiegend griechischen Händlern. In den folgenden Tagen nahmen mich Verhandlungen über eine Fracht lybischen Glases in Anspruch. So blieb ich vier Nächte in Tiberias. Träume scharrten an meinem Bewusstsein wie hungrige Katzen, doch ich erinnerte mich an keinen von ihnen.
Am letzten Morgen meinte ich plötzlich, Jeshua inmitten der Menschen, die auf den Markt drängten, zu sehen. Ohne nachzudenken, stieß ich zwei Männer aus dem Weg und grub mich durch die Menge. Ich konnte Jeshua nirgends finden.
Mittags verließ ich die Stadt und ritt ziellos durch namenlose Dörfer. Misslaunig schöpfte ich in einer dieser Siedlungen Wasser aus einem Brunnen. Auf dem Marktplatz standen nur vereinzelt Händler herum, und ein wenig Fußvolk war unterwegs. David und ich wurden misstrauisch gemustert, wahrscheinlich hielten sie mich für einen Römer. Neben mir am Brunnen standen zwei Frauen mit dunklen Kopftüchern; ich grüßte sie und half ihnen, die Eimer zu füllen.
„Ist das dein Pferd?“, fragte die jüngere der beiden mich mit großen Augen, und ich nickte. „Ist dein Name Judas?“
Verwundert schaute ich sie an und nickte abermals. Sie ließ ihren Eimer fallen, und das Wasser spritzte über den Rand auf ihre Füße. „Er hat recht behalten, Mutter, er hat recht! Ein Mann namens Judas mit einem schwarzen Pferd würde kommen!“ Sie schaute zwischen ihrer Mutter und mir hin und her.
„Was?“, fragte ich zerstreut und wartete ungeduldig, bis sie sich beruhigt hatte.
Sie wiederholte ihre Worte und sagte dann: „Ich soll dir ausrichten, dass er in zwei Tagen in Chorazim sein wird.“ Sie strahlte und hatte ein hochrotes Gesicht vor Erregung.
Er? Mir wurde flau.
„Jeshua?“, fragte ich. Sie nickte wild. „Ja, so hieß er. Nicht wahr, Mutter?“
Die Mutter, eine Frau mit jungem Gesicht und weißen Haaren, nickte ebenfalls. Meine Schultern sackten nach vorn. Fassungslos schaute ich die beiden Frauen an.
„Er wusste, dass ich hierherkommen würde?“
„Nein, er sagte ... was sagte er noch genau, Mutter?“
Die Mutter antwortete: „Er hoffte, dass du kommen würdest, um nach ihm zu suchen.“
Ich ließ mich auf einen Stein sinken und schüttelte den Kopf, denn in diesem Moment machte ich mir bewusst, dass ich ihn tatsächlich gesucht hatte. Langsam stand ich auf und griff nach Davids Zügeln.
„In zwei Tagen in Chorazim?“, wiederholte ich, und die Tochter nickte noch einmal heftig. „Zwei Tage von welchem Zeitpunkt aus? War er heute hier gewesen?“
Die Frauen guckten verwirrt und schüttelten die Köpfe. „Gestern war er da.“
„Ich danke euch“, sagte ich und drückte den ungläubigen Frauen ganze zwei Denare in die Hand.
„Von Münzen hat er gar nichts gesagt, Mutter!“
Offenbar weiß er nicht alles, dachte ich erleichtert.
Ich kam bereits am Morgen auf Chorazims belebtem Marktplatz an. Es wehte ein kalter Wind, aber es schien ein sonniger Tag werden zu wollen. Ich ließ meinen Blick von Davids Rücken aus über die Menschen schweifen, aber Jeshua konnte ich nirgends ausmachen und auch keinen seiner Begleiter. Unwillkürlich fuhr ich mit einer Hand über meinen ziehenden Magen, ich hatte heute noch nichts essen können und fragte mich, welchem Spuk oder dummen Scherz ich hier aufsaß. Niemand hatte wissen können, dass ich vor zwei Tagen ausgerechnet in jenem Dorf Halt machen würde; überdies hatte ich selten Grund, mich in kleineren Gemeinden aufzuhalten.
Ich schaute immer wieder von einem Ende des Marktes zum anderen, studierte die Gesichter der beschäftigten Hausfrauen und arbeitenden Männer. Vornehmlich wurde mit Fisch gehandelt; an mehreren Ständen riefen die Fischer ihre frisch gefangenen Barben aus.
Wieso wollte Jeshua mich wiedersehen? Wir hatten nicht ein Wort miteinander gewechselt.
Der Mittag verging, und mein Verstand sagte mir, ich solle aufbrechen, meine Zeit nicht mit diesem Hirngespinst verschwenden. Zwar füllte ich bereits am Brunnen meinen Wasserbeutel für den Weiterritt, aber konnte mich einfach nicht dazu entschließen, Chorazim zu verlassen. Zwischendrin kaufte ich dieses und jenes, um nicht beständig die Blicke der Dorfbewohner auf mir zu spüren. Das Brot und die Oliven, die ich erstanden hatte, reichte ich an einen dürren Mann weiter, der zu alt für die Arbeit war und bettelnd am Rande des Marktes saß. Ihn fragte ich auch, ob er in den letzten Tagen einen Mann namens Jeshua hatte reden hören.
„Hier reden genug“, sagte er resigniert und biss dankbar in das Brot. „Und bei dem, was sie reden, wünschte man, man wäre beizeiten schon taub geworden. Sie alle versprechen Wunder, Junge. So viele, dass die Luft schon ganz bunt sein müsste von ihren gefärbten Worten.“
„Ich weiß, was du meinst“, sagte ich und setzte mich neben ihn auf meinen Umhang. „Ich habe Jeshua noch nicht reden hören, so kann ich also nicht sagen, ob er Wunder verspricht. Ein Wunder wäre es allerdings, wenn er heute hier erscheinen würde.“
Ich seufzte leise und fragte den Alten nach seinem Namen.
„Wieso erniedrigst du dich, neben mir zu sitzen? Du bist vornehm und reich, du hast es nicht nötig, bei mir im Dreck zu sitzen. Und was nutzt dir schon mein Name?“, fragte er mit Misstrauen.
„Ich habe mehr Zeit im niedersten Dreck verbracht, als du je sinken könntest“, sprach ich gleichmütig. „Verrate mir deinen Namen, wenn du noch meine Gesellschaft willst.“
Der Alte brummte wegwerfend.
„Ich habe gelernt, was ein Name wert sein kann“, fuhr ich fort und starrte von meinem Platz am Boden aus auf die Dorfbewohner, die ohne Gesicht an mir vorübergingen.
„Ich kannte mal jemanden, der konnte mir seinen Namen nicht sagen. Vielleicht hat er ihn auch selbst nicht mehr gewusst.“ Mit einem Mal zu bitter erinnert, langte ich nach meinem Wasserschlauch und trank einen Schluck.
„Jonachaan heiße ich“, kam es von der Seite und riss mich aus meinen Gedanken.
„Ich bin Judas.“
Belustigt sah ich zu, wie Jonachaan seine Wasserschale hob und auf mich trank.
„Dieser redende Mann ... wie sieht er aus?“, fragte er mich dann. „Ist es einer von diesen heuschreckenfressenden Lümmeln aus Judäa?“
„Es gibt Hoffnung: Ich habe ihn Brot essen sehen“, antwortete ich lächelnd. „Jeshua ist in meinem Alter, so groß wie ich und von schlanker Statur. Er hat braunes Haar und ein schönes Gesicht.“
„Schön?“, fragte Jonachaan verdutzt. Er legte sich bedächtig eine Olive in den Mund und kaute nachdenklich. „Schön war keiner von den letzten Quacksalbern, Junge. Sie konnten nur schön reden ... Falls er hier erscheint, will ich mir den Burschen mal anschauen.“
„Ich werde es dich wissen lassen“, sagte ich und stand auf. Wieder ließ ich meinen Blick über die Menschenmenge schweifen, und mein Puls hämmerte plötzlich wie die Hufe der Pferde auf der Jerusalemer Rennbahn.
„Er ist hier“, flüsterte ich erschüttert. Jeshua hatte den Marktplatz betreten. Der Alte griff nach meinem Arm, ich zog ihn von seiner Matte und wies auf die kleine Gruppe, in der auch Marjam wanderte.
„Schön ist übertrieben, Junge, er sieht vielleicht nicht übel aus. Aber wenn das alles ist, was er zu bieten hat ... Die Frau gefällt mir besser!“
„Und sie hat sogar großen Verstand, sag ich dir.“
„Ei, da lässt man besser die Finger von!“, warnte er ernst.
In diesem Moment erblickte Jeshua mich. Ein erstauntes Lächeln hellte sein Gesicht, ganz so, als wäre er es, der nicht damit gerechnet hatte, mich hier anzutreffen. Verlegen lächelte auch ich. Nathanael winkte mir zu, während Jeshua auf den Brunnen zuhielt. Jonachaan hatte seine Bettelschale gesichert, und wir folgten ihm. Am Brunnen angelangt, erfrischten er und seine Begleiter sich mit Wasser, und dann begann Jeshua, von Durst zu erzählen. Er sah dabei zunächst seine Begleiter an, als wäre er zu schüchtern, um das Wort an Fremde zu richten. Ich war noch nicht nahe genug, um jedes Wort zu verstehen und zog Jonachaan mit mir nach vorn. Vor Jeshuas Augen stolperte gerade ein Kind über einen Stein und fing an zu weinen und zu humpeln.
„Ein jeder von euch ist wie dieses Kind“, sprach er jetzt lauter, so dass alle, die wollten, ihn verstehen konnten. „Ihr weint über etwas, das euer Nachbar nicht versteht. Ihr fürchtet euch vor etwas, worüber der Nächste nur lacht. Wir alle tun gut daran, unseren Platz bisweilen zu verlassen, uns auf den Platz unseres Nächsten zu stellen, um ihn und seine Nöte – und auch seine Freuden – besser verstehen zu können.“
Jeshua zeigte mit seiner Hand auf das Kind, das auf dem Arm der Mutter noch leise schluchzte. „Wir belächeln dieses Kind, weil wir wissen, dass sein Schrecken nur vorübergehend ist. Gott weiß auch, dass unsere Schrecken nicht andauern und schenkt uns Verständnis. Und eben dies sollten wir jedem Menschen zuteilwerden lassen.“
Ich stutzte bei diesem Beispiel. Von welchem Gott sprach er? Jeshua schnitt dem Kind eine Grimasse, so dass es beirrt aufsah und vergaß, weiterzulamentieren. Ein, zwei alberne Gesten später und das Kind lachte schon wieder.
„Seht ihr, wie leicht sich dieses Kind von seinem Schmerz abwendet und ihn völlig vergisst? Es erinnert sich nicht ständig daran zurück, wie die Erwachsenen es tun. Wir selbst berauben dieses Kind seines göttlichen Erbes, indem wir zurückblicken und auch die allerpeinigendsten Momente nicht loslassen“, sprach er und hatte an Eindringlichkeit gewonnen. Ich hörte ihm gebannt zu. „So tut es auch das Volk Israel. Es bewahrt die Pein und die Unterdrückung, anstatt sich auf die Befreiung zu konzentrieren.“
Diese Worte ließen mich an die Freiheitskämpfer denken. Gehörte Jeshua den Zeloten an? Ihnen würden seine Worte gefallen, vielleicht auch den Sicarii, aber nur wenn blutige Taten auf die Worte folgten.
Die Dorfbewohner waren nur zögernd nähergetreten, doch Jeshua störte sich nicht daran und erzählte weiter. Jonachaan neben mir brummte, und ich beugte mich zu ihm.
„Enttäuscht, dass er dir kein Wunder aufdrängen will?“, fragte ich ihn gedämpft.
„Ich frage mich, was genau er überhaupt sagen wollte“, erwiderte er missvergnügt.
„Vielleicht das, was ich vorhin in deinen Augen getan habe: Ich habe mich auf deinen Platz gesetzt.“
Jonachaan schaute mich zweifelnd an.
„Komm, lass uns zu meinem Pferd gehen.“
Stirnrunzelnd schlurfte der Alte hinter mir her.
„Steig auf!“
„Was?“
„Na los! Viel anderes zu tun hast du ja nicht. Lass dir auf mein Pferd helfen. Von dort aus starrst du dann nicht mehr die Füße der Menschen an, sondern könntest ihnen sogar auf den Kopf spucken, zudem siehst du hervorragend, welchem Mann die Haare ausgehen. Willst du dir dieses Vergnügen entgehen lassen?“
Jonachaan murrte, ließ sich aber von mir auf Davids Rücken helfen. Ich nahm ihm seine Bettelschale ab.
„Und wie ist die Sicht da oben?“
„Nichts, woran ich mich gewöhnen sollte! Hilf mir wieder runter!“
„Vielleicht solltest du deine Ziele höherstecken“, sprach eine vertraut gewordene Stimme hinter mir. Jonachaan und ich drehten uns beide zu Jeshua um, der zu dem Alten aufschaute. Der schnaubte: „Wie sollte ich meine Ziele höherstecken? Aus mir ist nichts mehr rauszubringen als die Bettelei.“
Jeshua nickte sogleich. „Wenn du das glaubst, wird es so sein. Aber du hast doch sicherlich genügend Zeit dort unten im Staub, um dir etwas Besseres auszumalen.“
„Na, siehst du, Judas, da kommt dein schöner Mann ja endlich mit den Wundern an“, wandte sich Jonachaan an mich, und mir wurde Jeshuas überraschter Blick gewahr.
„Ich biete keine Wunder an“, sprach Jeshua zu dem Alten. „Dafür musst du schon selbst sorgen. Wunder fühlen sich nur zu demjenigen hingezogen, der willens ist, an sie zu glauben. Doch ich kann dir anbieten, deinen Glauben zu stärken.“
Jonachaan hoch zu Ross musterte Jeshua von oben bis unten. Mürrisch streckte er seine Hand nach ihm aus, damit er ihm herunterhalf. Wortlos nahm Jeshua den Alten am Arm und setzte sich etwas abseits mit ihm hin. Ich stellte mich zu David und rieb ihm den Hals, während ich immer wieder zu den beiden blickte. Jeshuas Gesichtsausdruck war schwer zu beschreiben. Er kannte Jonachaan nicht und dennoch schaute er ihn an wie einen Freund, dessen Wohlergehen ihm am Herzen lag.
Jeshua streckte seine Hände aus und nahm Jonachaans in seine. Verwundert sah ich mit an, wie der zynische Alte anfing zu weinen. Leise sprach Jeshua, und Jonachaan nickte immer wieder. Nach einer Weile standen die beiden auf und kamen zu mir herüber.
„Heute haben sich große Männer zu mir in den Staub gesetzt“, sagte Jonachaan und bückte sich zu seiner Matte, um sie zusammenzurollen. „Will mal sehen, wie der Boden woanders so beschaffen ist.“
Verblüfft sah ich zu, wie er seine Habseligkeiten zusammenpackte und sich ohne große Worte von uns verabschiedete. Jeshua blieb neben mir stehen und schaute, so wie ich, dem Alten hinterher, der Teil der Menge wurde. Ich hielt meine Fragen zurück, sie waren zu zahlreich, um mit einer zu beginnen.
„Komm doch ein Stück mit uns, wenn deine Zeit es erlaubt“, sprach Jeshua. Ich spürte seinen Blick auf mir ruhen und nickte.
Auf dem Weg zum nächsten Fischerdorf kam er an meine Seite. Es war, als müssten unsere Schritte sich erst aufeinander einstellen, und so schwiegen wir. Die Welt schien mir in seiner Gegenwart nicht länger fest genug. Was hatte er nur an sich?
Als es dunkelte, suchten wir uns einen Schlafplatz nahe Bethzaida, es bildete zusammen mit Chorazim und Kefar Nahum ein Dreieck. Zwei neue Männer stellten sich mir vor. Es waren Brüder namens Simon und Andreas aus Kefar Nahum und beide eher wortkarg. Simon erschien mir sehr kantig, warf mir immer wieder prüfende Blicke zu. Bei ihnen war der Junge mit den Locken, den ich am Stand des Persers mit Jeshua gesehen hatte; er hieß Johannes und war vielleicht sechzehn Jahre alt.
Ich hörte zu, wie sie mit Jeshua über den vergangenen Tag redeten und sich schließlich nach einer gemeinsamen Mahlzeit still zurückzogen. Nur Nathanael nutzte die Gelegenheit, den Gastgeber zu spielen und streckte sich behaglich neben den Flammen aus. Wir lagerten in den grünen Hügeln nahe des Tiberias und spürten einen kalten Wind aufkommen.
„Da bist du also wieder zu uns gestoßen“, sprach Nathanael zufrieden. „Finde ich gut.“
Ich nickte.
„Übrigens hast du recht“, begann ich, und er blickte verwundert auf. „Jeshua ist eigenartig.“
Nathanael sah sich um, ehe er tonlos kicherte.
„Er wusste, wo ich Halt machen würde, ohne dass ich es selbst vorher gewusst habe“, sagte ich leise und schüttelte den Kopf. „Wie kann das sein?“
„Ha, das kann ich dir immerhin verraten!“
„Ja?“
Nathanael schien meine Überraschung zu genießen, denn er machte eine lange Pause und rieb sich die Hände. Ich beugte mich unwillkürlich vor.
„Die letzten Tage hat Jeshua an jedem verflixten Dorf Halt gemacht, dich und dein Pferd beschrieben und gesagt, wann wir in Chorazim sein würden.“
„Was?“ Ich ließ mir Nathanaels Worte durch den Kopf gehen. Die Wahrscheinlichkeit, Jeshuas Botschaft zu bekommen, war dennoch gering gewesen. Warum hatte er sich solche Mühe gemacht?
„Als ich auf ihn getroffen bin, lungerte ich gerade unter einem Baum rum, habe auf Arbeit gewartet“, bekannte Nathanael und kratzte sich die Schulter. „Er kam zu mir und sprach von all diesen Dingen, die er nicht wissen konnte.“ Er schaute betreten. „Na ja, hatte grad nichts anderes zu tun, da habe ich beschlossen, ihm zu folgen. “
Nathanael griff nach einem Weinschlauch und berichtete mir von seinem Leben in Sepphoris; er hatte seine Frau verlassen, um Jeshua zu folgen.
„Du hast sie zurückgelassen?“, fragte ich bestürzt.
Er zuckte mit den Schultern. „Sie ist gut versorgt und lebt bei meiner Familie.“
Kopfschüttelnd hatte ich Nathanaels Erzählung gelauscht. Nach und nach kamen Jeshua und die anderen ans Feuer zurück und blieben noch etwas bei der Wärme sitzen, bevor sie sich schlafen legten.
Und als auch Nathanael müde wurde, waren Jeshua und ich zum ersten Mal miteinander allein. Eine Spannung wuchs zwischen uns – einem lodernden Feuer gleich, dessen Flammen wild schwankend nach Nahrung suchten. Ich wollte mich erheben, um dem zu entfliehen, da sagte er: „Frag mich ruhig.“
Seine Stimme löste jäh das angespannte Schweigen, und die Luft schien meinen Lungen ruckartig zu entweichen.
„Gut“, sagte ich und blickte ihn über den Feuerschein hinweg an. Er betrachtete mich aufmerksam.
„Jeshua, du bist zu der Zeit geboren, als die seltene astrologische Konstellation sich am Himmel gezeigt hat. Sag mir bitte, was du beim persischen Straßenhändler meintest, dass dies vielleicht ein glückliches und unglückliches Omen sein könnte.“
Meine Frage schien ihn zu überraschen, denn er zog erstaunt die Augenbrauen hoch und öffnete den Mund, ohne etwas zu sagen.
„Ich habe mir Gedanken über dieses Ereignis gemacht“, fuhr ich fort. „In Persien habe ich eine Schriftrolle erstanden, auf der ein Mago das Himmelzeichen festgehalten hat. Die Magi werden zu Unrecht als Zauberer oder Scharlatane geschimpft, denn sie berechnen den Himmel streng mathematisch“, sprach ich weiter. „Glaubst du, für den einen könnte es ein gutes und gleichzeitig für den nächsten ein schlechtes Omen sein?“
Jeshua nickte verstehend. Wind streifte uns kühl von der Seite, und die Flammen duckten sich unter seiner Kraft.
„Mit dieser Frage kommen wir zunächst zu Grundfragen: Was ist gut, und was ist schlecht?“, fragte er. „Ich habe auf die Frage des Händlers so zweideutig geantwortet, weil ein Ereignis erst einmal weder gut noch schlecht ist, es ist einfach, verstehst du? Erst der einzelne Mensch verleiht diesen Ereignissen eine ganz eigene Bedeutung von gut oder schlecht“, sagte er und hob beide Hände an, als wollte er etwas auffangen.
„Nehmen wir den Regen: Ein Bauer, der gerade sein Feld bestellt hat und dringend auf Regen hofft, damit seine Ernte gedeiht, wird sich über den Regen freuen. Der Regen ist für ihn in diesem Moment so etwas wie ein göttlicher Segen, er nimmt den Regen persönlich.“
Jeshuas Augen ließen mich kaum wegsehen, in ihnen flackerte es mit einer Intensität, die der des Feuers zwischen uns glich.
„Der gleiche Regen könnte wenige Schritte weiter einen Tischler ärgern, der gerade seine Handwerksstücke zum Nachbearbeiten nach draußen gestellt hat und das Holz seiner Möbel verunreinigt sieht, weil es sich durch die Nässe und die anschließende Trocknung verziehen wird.“
Jeshua nahm einen Stock und stocherte in der Glut; er gab mir Zeit, seine Worte zu überdenken.
„Ein paar Tage später kann es schon wieder anders sein“, fuhr er dann fort. „Den Tischler dürstet, und er freut sich über den anhaltenden Regen, während der Bauer schimpft, weil zu viel Regen seine Ernte ebenfalls ruinieren könnte. Wie du siehst, kann der gleiche unschuldige Regen auf verschiedene Weise gedeutet werden. So ähnlich ist es mit diesem Sternbild. Wenn ich es für ein gutes Omen halten will, so kann ich dies tun, es wird mir vielleicht sogar in manchen Momenten Kraft geben, weil ich denken könnte, meine Geburt war von diesem seltenen Himmelsereignis begleitet oder ...“
„Oder man könnte annehmen, es ist ein Fluch, der einen seit der Geburt verfolgt“, sagte ich dunkel und starrte ins Feuer. „Kann dieses Ereignis bedeutungslos sein? Einfach ein astronomischer Zufall?“
„Natürlich kann es das. Doch eines verrät der Kosmos: Es herrscht eine perfekte Ordnung. Nichts geschieht einfach so, aber die Bedeutung eines Ereignisses mag uns erst spät zuteilwerden. Siehst du?“
Jeshua erhob sich und zeigte auf das Firmament.
„Komm, lass uns eine Weile die Sterne beobachten. Das gelingt auch ohne Astrolabium.“
Er entfernte sich vom Feuer und legte sich in eine Senke. Ich folgte ihm und ließ mich mit meiner Decke in seiner Nähe nieder; wir lagerten etwas abseits der anderen. Die Dunkelheit strich plötzlich kalt über meine Haut; einen Augenblick lang roch ich den Rauch, der sich in den Falten unserer Gewänder verfangen hatte.
Als ich nach oben blickte, zog ein feines Gleißen über den Himmel.
„Vielleicht ist es Zufall“, sagte Jeshua leise, „vielleicht aber ist diese Sternenspur eine Begrüßung für zwei Menschen, die unter dem gleichen Himmelsbild geboren worden sind. Zwei Menschen, die dreißig Jahre später zusammentreffen und gemeinsam die Sterne beobachten.“
Vor Verblüffung stockte mir der Atem. Ich lag da wie auf einem Nagelbett, starrte zwischen die hellen Punkte am Himmel, nur nicht zu ihm, und meine Gedanken fanden so wenig Halt wie Wüstensand auf seiner ewigen Wanderschaft.
Ein bekanntes Gefühl klammerte sich an meinen Knochen fest. Ich starrte hoch, versuchte, das Gefühl meiner Kindheit loszuwerden und unterdrückte ein Stöhnen, weil mein ganzer Körper plötzlich giftig schmerzte. Ich wollte nicht, dass Jeshua meinen Aufruhr bemerkte und wandte mein Gesicht zur Seite. Im selben Moment spürte ich eine Bewegung neben mir. Jeshuas Hand legte sich nah an meine und berührte nur leicht meine Handkante mit seiner, so unmerklich, als hätte sich an dieser Stelle der Wind zu Wärme verdichtet. Ich zitterte plötzlich heftig, und mich durchströmte eine unerwartete Gefühlsregung, ähnlich wie die Kraft einer Welle, die meinen Körper von Wasser zu Land drängte: Ich war vergessen, erinnert, mir selbst zu nah. Erschüttert lag ich da. Und zum ersten Mal seit einer Ewigkeit fühlte ich eine Antwort nahen.
Ich hatte die Augen noch geschlossen, da spürte ich eine Berührung an meiner Schulter. Meine Hand ruckte hervor, bekam eine andere Hand zu fassen und drückte sie von mir, gleichzeitig richtete ich mich auf.
Jeshua schaute mich durch die Dämmerung ernst an. Ich ließ seine Hand los und war froh, dass er nichts sagte.
„Ich wollte fragen, ob du mit mir den Morgen begrüßen willst“, sprach er. Ich rieb mir über das Gesicht und blickte auf den noch fast dunklen Himmel. Ich zog die Brauen hoch.
„Wie tust du das? Und warum tust du das?“
Er lachte leise, es klang warm wie der erste Sonnenstrahl des Tages.
„Viele Fragen für diese stille Stunde. Lass mich sie später beantworten, wenn es dann noch nötig ist. Begrüßt du manchmal den Tag?“
„Gezwungenermaßen“, murmelte ich.
Er setzte sich vor mich.
„Hast du den Morgen jemals einfach begrüßt?“
„Was meinst du damit?“
„Ohne persönliche Gefühle?“
Ich dachte über die ungewohnte Frage nach.
„Selten. Vielleicht noch nie.“
„Warum?“
„Meistens habe ich den Morgen herbeigesehnt, und dann gab es Zeiten, in denen ich wünschte, er würde nicht einsetzen.“
„Siehst du? Der Morgen ist auch hier etwas sehr Persönliches geworden. Vielleicht versuchst du ihn heute als etwas zu sehen, was einfach ist, weder gut noch schlecht. Einfach der erhabene Wechsel vom Dunkel zur Helligkeit.“
Mit diesen Worten drehte Jeshua sich in die Richtung, in der sich der Wechsel vollziehen würde. Und ich war nicht in der Lage, gerade diesen Morgen ohne Regung zu betrachten. Er spiegelte all meine Verwirrung, Unruhe und Ungewissheit wider. Ich sehnte den Tag herbei und wünschte gleichsam, die Nacht würde bleiben. Kurz gesagt: Es war mein Morgen, so wie viele andere nach ihm.
In Bethzaida sprach Jeshua wieder auf dem Marktplatz. Ich musste bald aufbrechen, um meinen Geschäften nachzugehen, dennoch folgte ich mit David der Gruppe auf ihrem Weg zum nächsten Dorf. Wir wanderten durch die grünen behäbigen Hügel auf Kefar Nahum zu, und Jeshuas und meine Schritte fanden sich nebeneinander ein. Der See Tiberias glänzte träge neben unserem Fußweg; Seevögel stiegen vom Ufer auf.
Wir hatten das Dorf beinahe erreicht, da fragte ich Jeshua, was sie dort tun und wie lange sie bleiben würden.
„Wir treffen hier auf Freunde von uns. Gemeinsam werden wir weiter durch die Dörfer gehen und mit den Menschen sprechen.“
„So wie in Chorazim und Bethzaida?“
„Ja. Wir nehmen auch Menschen mit, die sich uns anschließen wollen.“
„Was heißt das? Sie gehen eine Weile mit euch, so wie ich?“
Er schüttelte den Kopf. „Sie bleiben.“ Die Sonne schien ihm von der Seite ins Gesicht; seine Augenfarbe war ein dunkles Blaugrün, vermischt mit Braun, als hätte sie sich den Farben Galiläas angepasst.
„Sie folgen dir nach?“, fragte ich wieder konzentriert auf unser Gespräch.
„Sie folgen der Wahrheit.“
Ich stutzte. David zerrte an seinem Zügel.
„Du bist also die Wahrheit?“, fragte ich herausfordernd.
„Zumindest so lange, bis du mir das Gegenteil beweisen kannst“, gab Jeshua zurück.
Ich hob belustigt die Augenbrauen. „Wo sind deine anderen Anhänger, wenn du sagst, dass sie dir folgen?“
„Sie gehen meiner Bitte nach, auch woanders etwas für die Wahrheit zu tun.“
„Aha. Wovon lebt ihr, Jeshua? Die Wahrheit ist sicherlich nicht essbar genug.“
„Oh doch! Wir leben von dem, was Gott uns zuteilwerden lässt.“
Gott. Ich merkte, wie ich mich anspannte. Ich schaute auf Jeshuas Füße, die über das grüne Gras wanderten.
„Und was lässt Gott euch zuteilwerden?“, sprach ich. „Ist er nicht derjenige, der beständig durch die Hände seiner Priester einfordert?“
„Wir bekommen alles, was wir brauchen“, antwortete Jeshua. „Gott ist nicht der Feind, Judas, nur wenn du ihn weiterhin dafür hältst.“
Ich forschte in seinen Augen.
„Manchmal“, sagte Jeshua leiser als zuvor, „halten wir Gott für unseren Feind, obwohl wir selbst uns an den Schmerz des Lebens binden.“
Ich sah kaum noch, wo ich herging.
„Sie alle haben gegen das Gesetz der Priester ihre Familien verlassen, um der Wahrheit zu folgen und die Wahrheit über sich selbst zu erfahren“, fuhr er fort, unbeirrt wie seine Schritte.
Ich blieb stumm, und er sagte: „Wir haben immer die Wahl.“
„Ach ja?“, schnaubte ich und dachte unwillkürlich an meine Channah; ihr blasses Gesicht blickte mich aus meinem Inneren an. Ich hätte sie niemals allein gelassen.
„Ja“, sagte er so ruhig, als würde er nicht spüren, wie erregt ich war. „Wir wählen immer selbst.“
Ich war aufgewühlt wie ein sandiges Wasserloch und rieb Davids schwarzen Hals. Jeshua ließ mich.
Nach einiger Zeit konnte ich mich ihm wieder zuwenden.
„Wie ernährt Gott euch alle, wenn ihr nicht arbeitet?“, fragte ich barsch, aber Jeshua schien nicht verärgert.
„Wir arbeiten, Judas, wir arbeiten mit ihm.“
„Wie?!“, forderte ich so hart, dass Marjam und der junge Johannes sich umdrehten und uns mit gerunzelter Stirn beobachteten.
„Ich biete meine Hilfe als Handwerker oder Heiler an. Oftmals bekommen wir im Austausch ein Lager oder eine Mahlzeit.“
„Du bist ein Heiler?“, fragte ich beklommen, und er nickte. Ich konnte nichts mehr sagen. Als Jeshua zu sprechen ansetzte, hob ich eine Hand.
„Wo wir gerade von Arbeit reden ...“, begann ich rasch. „Ich muss jetzt aufbrechen, um meiner eigenen nachzugehen.“
Ich schwang mich auf mein Pferd und wandte Jeshua schweigend den Rücken zu.