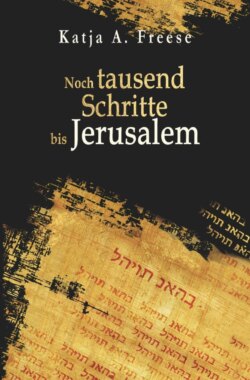Читать книгу Noch tausend Schritte bis Jerusalem - Katja A. Freese - Страница 5
Оглавление
Fallen
Ich galoppierte in die entgegengesetzte Richtung davon und erklomm mit David einen der grünen Hügel; Weitsicht konnte ich gut gebrauchen. Ich setzte mich ins Gras und schaute über die glatte Fläche des Sees Tiberias. Frieden. Unerreichbar. Familie verlassen. Channah, die unlängst mich verlassen hatte.
Im vergangenen halben Jahr hatte ich des Öfteren in Caesarea am Hafen gestanden, bereit zu gehen. Etwas hielt mich davon ab, eines der einfahrenden Schiffe zu besteigen, deren Segel prall gebläht waren von all der unbekannten Freiheit. Hatte ich zu lange verharrt, so dass ich mich nicht mehr zu bewegen wusste? Wenn die Schiffe ausliefen, folgte nur eine einzige Frage ihrer gischtweißen Spur: Konnte man sich selbst jemals entkommen?
Mit Channahs Tod hatte ich die Unabhängigkeit erhalten, mein Elternhaus zu meiden und nur noch geschäftlich mit Vater und Onkel zu verkehren. Doch meine Familie würde diesen Eigensinn nicht viel länger dulden. Meiner Schwester wegen hatte ich ausgehalten.
Jeshua kann heilen, stieg der ungebetene Gedanke in mir auf. Hätte er Channah heilen können? Als ich noch weiter zurückdachte, krampfte sich alles in mir zusammen. Wie konnte es einen gütigen Gott geben?
David spürte meine Unruhe und schob seinen warmen Kopf an meinen Hals. Nur ein Mal, ein einziges Mal, hatte ich mich einem Menschen anvertraut. Vertrauen schafft Wunden.
David wieherte unversehens wild und riss den Kopf hoch.
„Ja, weiter! Lass uns verschwinden“, murmelte ich.
Mit einem heftigen Grollen schüttelte ich die Gedanken ab und sprang auf die Füße. Ich war in der Stimmung für eine Prügelei, für einen Wettkampf, für Wein, für irgendetwas, um das Leben auszuhöhlen. Und wo gab es mehr Möglichkeiten des Verfalls als in Sepphoris?
Mit der Abenddämmerung traf ich in der Stadt ein und brachte David unter. Direkten Weges suchte ich Titus Flavius auf, und damit begann eine Woche im Delirium. Tagelang hielt ich mir die Geschäfte vom Leib und schloss mich den sinnlosen Zerstreuungen der reichen Bürger an. Ich spielte um Geld, trank viel und ließ mich auf endlose Streitgespräche politischer und philosophischer Natur ein. Selbst Zenon aus Athen, der noch immer in Sepphoris weilte, bekam seine Debatte mit mir.
Er traf mich auf der Straße an und lud mich in das Haus eines Freundes ein. Die Anwesenden wurden unseres Gesprächs schnell überdrüssig und wandten sich der leichten Unterhaltung eines Possenreißers zu.
„Wahrheit und Erkenntnis sind nicht erlernbar“, sagte Zenon versonnen und sah den anderen bei ihren Spielereien zu. Wir lagen uns auf bequemen Polstern gegenüber, zwischen uns eine Tafel mit kunstvoll arrangierten Schlemmereien.
„Demnach sind Wahrheit und Erkenntnis das Privileg der Klugen?“, fragte ich.
„So ist es.“
Ich versuchte, mich nicht von dem Geschrei der anderen ablenken zu lassen, die einen Pfau im Zimmer freigelassen hatten; sie wetteiferten darum, wer ihn dazu bringen konnte, ein Rad zu schlagen.
„Also dürfen nur die Klugen regieren? Und das Volk fällt von einer Entmündigung in die nächste! Die sogenannten Klugen sind ihrer Selbstbestimmung würdig, der Rest ist auf der Stufe mit jeglichem Vieh“, sagte ich verächtlich.
„Das gemeine Volk ist nicht wie Vieh! Welch würdeloser Vergleich!“ Zenon trank aus seinem Weinkelch und speiste von seinem Delikatessenteller, ehe er fortfuhr: „Sie sind wie Kinder, die an die Hand genommen werden müssen. Sie brauchen Regeln, weil sie es nicht besser wissen.“
„Spräche es nicht für die Klugheit eines Lehrers, diese auch aus einem Schüler hervorzubringen?“
„Die Klugheit, von der wir hier reden, ist nicht hervorzubringen, sie ist bereits vorhanden oder nicht.“
Der Pfau hatte mittlerweile Reißaus genommen, er hüpfte aufgeregt über den Tisch und stieß die Weinschalen um. Zenon sicherte sich rasch die in Honig ertränkten Vogelhälse. Ein Jüngling warf sich neben uns auf den Pfau und zerdrückte unter dem Gelächter der Umstehenden einige Pasteten.
„Und reicht diese Klugheit allein aus, um zur Erkenntnis zu führen?“, fragte ich weiter, als wir wieder Ruhe hatten.
„Oh nein, wie schon Sokrates sagt, gehört die Tugend ebenso dazu und der Sinn für das Schöne“, sprach Zenon.
„Bist du im Besitz von all dem?“
Er setzte sich bedächtig auf und blickte mich an.
„Gewiss.“
Ich atmete tief durch und trank selbst einen Schluck Wein. Dies war ein Gespräch von vielen, die mich nicht weiterbrachten. Zenon bediente sich wahlloser Aussagen anderer Philosophen, dennoch wollte ich sehen, wohin er mich führen würde.
„Und wenn die Tugend fehlt, aber der Wunsch nach Erkenntnis da ist? Wird man sie jemals erreichen können?“, fragte ich.
„Gewiss nicht“, entgegnete er scharf. „Dieser Mensch wird Schaden anrichten durch sein Bestreben; dieser Mensch wird für andere eine Gefahr darstellen, weil er keine Moral kennt, mit der sein wacher Geist zu bändigen wäre.“
Jetzt richtete ich mich ebenfalls auf. „Und wo wäre dann für diese Menschen Platz in der Gesellschaft?“
„Sie wären der Feind, sie gilt es auszumerzen. Zum Wohle aller, versteht sich.“
Ich spürte Aufregung in mir wachsen. „Wenn nun aber solch ein Mensch Kenntnis über sich besitzt, wenn er sich erkannt hat mit allem Schaden, den er anzurichten vermag? Kann ihn das nicht retten? Kann ihn das nicht auf den rechten Weg führen? Durch einen Lehrer?“
Zenons Gesicht verschwand für einen langen Schluck in seiner Weinschale. Ich nahm den Blick nicht von ihm.
„Nun, wenn die Erkenntnis ihm aber nicht hilft, den rechten Weg zu erkennen, dann sehe ich nicht, wie ein Lehrer ihn retten soll. Ein wahrer Lehrer wird sich nur zu denen hingezogen fühlen, die der Wahrheit würdig sind.“
Ich lachte trocken. „Dann“, schloss ich das Gespräch und stand auf, „sollten wir beide unsere Zeit nicht länger mitein-ander verschwenden.“
Zenon war entweder nicht klug oder schnell genug, um etwas auf meine Worte zu entgegnen.
Ich warf dem wieder eingesperrten Pfau einen bedauernden Blick zu und floh zurück in das Treiben der Stadt.
Gab es einen Lehrer, der eine wahrhafte Antwort gefunden hatte? Und der sich dazu entschied, sie auch aus jedem anderen hervorzubringen? Meine Kehle schnürte sich zu, als drückten mir viele Hände die Luft ab. Gab es jemals Aussicht auf Freiheit?
Am letzten Abend der Woche besuchte ich Titus. Er und seine Freunde wollten gerade das Theater besuchen und waren hocherfreut, als ich mich ihnen anschloss. Zu Titus’ Erheiterung griff ich nach einem Weinkrug, um ihn mitzunehmen. In dem großen Theater trafen wir zu meinem grimmigen Vergnügen auch auf den hübschen Marcus Iunius, der mich erschrocken ansah. Ja, er wäre heute der Richtige für eine Prügelei. Ein paar Schläge von ihm würden vermutlich ausreichen, um eher mir eine behagliche Ohnmacht zu bescheren.
Ich blickte über die Ränge und sah auf den Ehrenplätzen unseren gelangweilten Tetrarchen Herodes Antipas mit seiner ihm angeheirateten Schwägerin Herodias. Etwas weiter links gab sich der Präfekt von Judäa die Ehre. Pontius Pilatus saß neben seiner Frau Claudia Procula auf gepolsterten Plätzen und harrte des Spiels. Meine Tante Lavernia, die in den besten römischen Kreisen verkehrte, konnte ich gottlob nirgends ausmachen.
Der Wein tat seine Wirkung, und ich genoss das alte Schaustück des Plautus namens Menaechmi. Zwillingsbrüder erkennen sich nach Jahren der Irrungen wieder. Ich griff nach dem Weinkrug, als das Publikum schallend lachte, aber ich an den seltsamen Zufall denken musste, dass Rabbi Jeshua und ich im gleichen Jahr und Monat geboren worden waren. Benommen ließ ich den Krug sinken; das Publikum bedrängte mich plötzlich wie ein Schwarm kreischender Möwen.
„Verdammt“, murmelte ich, weil ich nicht an ihn und seine Worte denken wollte. Ich schaute zur Seite und sah, wie Marcus mich mit neuem Mut musterte.
Danke, Herr!, betete ich, drückte meinen Sitznachbarn Titus nach hinten und rammte Marcus meine Faust in das wohlgeformte Gesicht. Er stöhnte auf. Titus ergriff meinen Arm und zog mich auf die Füße. Ich wehrte mich, als er mich unsanft aus dem Theater schob. Auf der Straße kam eine römische Wache auf uns zu.
„Was ist los?“, herrschte der Mann mit dem Speer uns an.
„Ich bin ein elender Jude, der einem angesehenen Römer eine verpasst hat“, gab ich kund und bekam von der Seite einen Schubs. Der Speer richtete sich auf mich.
„Ist das wahr?“, fragte der Wachmann mit verengten Augen.
Ich riss gerade den Mund auf, um meine Wahrheit noch zu vertiefen, als ich ausgerechnet Marcus hinter mir sagen hörte: „Ich bin Marcus Iunius Scipio. Es war alles ein Versehen, er ist ein Freund von mir und sehr betrunken.“
Der Wachmann beäugte uns noch eine Weile misstrauisch, ehe er etwas brummte und uns ziehen ließ.
Ich wurde von Titus und Marcus gestützt, die mich trotz meiner Proteste durch die Straßen zu einem Haus brachten; dort wurde ich durch kühle Korridore geführt. Schließlich presste Titus mich in einem dämmrigen Raum auf ein Polster, brachte mir einen Krug Wasser und verschwand. Marcus hockte sich vor mich.
„Es war kein Versehen“, sagte ich. „Ich suche Streit.“
Marcus fuhr sich mit einer Hand über seine geschwollene Wange.
„Das habe ich gemerkt“, erwiderte er und lächelte schwach. Er setzte sich neben mich, nahm mir den Wasserkrug ab und trank einen Schluck. Mit dem, was als nächstes geschah, hätte ich am wenigsten gerechnet. Statt mir einen Rückschlag zu verpassen, ließ Marcus den Kopf auf seine angewinkelten Knie sinken und flüsterte: „Ich will wieder nach Rom zurück.“
„Was?“ Ich richtete meinen Oberkörper auf und starrte zu dem zusammengekauerten Hünen. Er legte seinen Kopf schräg und blickte mich trostlos an.
„Mein Vater hat mich gegen meinen Willen hierher geschickt“, seufzte er und schloss einen Moment lang die Augen.
„Warum?“
Er blieb stumm und sah elend aus.
„Warum, Marcus?“, fragte ich noch einmal, diesmal etwas entgegenkommender.
„Weil ich nicht heiraten will.“
„Aha? Verlangt es bei euch auch das Gesetz?“
Er schüttelte den Kopf. „Politik.“
„Ist die Frau so schlimm, die er dir gewählt hat?“
Marcus zuckte mit den Schultern. Er seufzte tief, ehe er sagte: „Ich liebe keine Frauen. Ich liebe Männer.“
Das war keine Überraschung. „Ich verstehe“, murmelte ich.
„Und du?“, flüsterte er.
Ich schnaubte leicht. „Weder noch.“
„Weder Mann noch Frau?“, rekapitulierte er langsam und sah mich verwirrt an. „Also Tiere?“
„Äh ... nein. Auch nicht“, fügte ich deutlich hinzu.
„Also gar nicht?“, fragte er erschüttert, und jetzt war es an mir den Kopf zu senken. Als ich ihn wieder aufrichtete, war mir schwindelig.
„Jedenfalls meistenteils nicht freiwillig“, entkam es mir.Was ließ ich mir von diesem Römer meine Geheimnisse entlocken? Ich schüttelte den Kopf.
„Vergiss es bitte“, sagte ich und wollte aufstehen. „Der Wein ...“
„Es tut mir sehr leid“, sagte Marcus aufrichtig.
„Schon gut.“ Ich trat bei dem Versuch aufzustehen auf den Saum meines Gewandes und stolperte auf meine Knie zurück.
„Dreck!“, zischte ich und blieb knien. „Ich verabscheue mein Leben“, sprach ich tonlos. „Wirklich, ich verabscheue es. Ich sehe keinen verdammten Sinn in all dem hier, und ich bin nicht gut genug für etwas anderes ...“
Und die Hand, die sich auf meinen Rücken legte, war seltsam tröstlich in ihrer Unbewegtheit. Sie forderte gerade nichts.
Ich sackte zusammen. Verflucht war ich, und daran würde sich nichts ändern; ich hatte kein Recht, meinen Erinnerungen zu entkommen.
Die fremde Hand zog mich vorsichtig näher, und ich fiel seitlich gegen Marcus’ festen Körper. Ich blieb einfach an dieser Wärme lehnen und wehrte mich gegen den Wunsch, jemandem nahe zu sein. Die großen Hände hielten mich, streichelten dann und wann über meinen Rücken.
Oh Gott, dachte ich, dies muss die Unterwelt sein.
Ich liege in Herakles’ Armen ...
Ich fühlte mich umschlossen von einem engen Kosmos, der dank des Weines den Großteil der Welt in dunkle Winkel drängte, entschärfte. Ich fand keine Kraft, mich von dem Menschen neben mir zu lösen, schien mit einem Mal süchtig nach ehrlicher Nähe. Marcus spürte das. Er küsste mich aufs Haar und streichelte behutsam meinen Nacken. Ich rührte mich nicht. Als seine Finger in den Ausschnitt meines Gewandes gleiten wollten, zuckte ich aus dem roten Weinnebel und spannte mich an. Sofort hielt Marcus inne und nahm seine Hand zurück. Dennoch war der alte Drang zu entkommen stärker, und ich mühte mich, Abstand zwischen unsere beiden Körper zu bringen.
„Es tut mir leid, Judas“, flehte Marcus, während ich durch die Dämmerung starrte. „Ich habe einen Moment geglaubt, du würdest es mögen. Bitte bleib hier und schlaf einfach, ja? Ich möchte dich so nicht in die Stadt schicken.“
Ich schwankte in meiner Hocke und ließ mich wieder auf das Polster fallen. Marcus rührte sich nicht, und ich war sicher, dass er es nicht noch einmal versuchen würde. Und so machte ich ihm ein großes Kompliment dadurch, dass ich einfach neben ihm einschlief.
Im Morgengrauen kam ich zu mir und bemerkte unwohl, wie nah ich bei Marcus gelegen hatte. Ich stöhnte leise, weil mein Kopf schmerzte und der saure Geschmack von zu viel Wein meinen Mund ausfüllte. Ich richtete mich langsam auf, und Marcus erwachte. Stumm erhob auch er sich und stand harrend da, als wartete er auf eine Bestrafung.
„Danke“, sprach ich und nahm Marcus’ Überraschung wahr. „Und verzeih, dass ich dich geschlagen habe. Das ist ganz und gar nicht meine Art.“
Er strich sich mit einem Finger über die Schwellung seiner Wange. „Das wird mich ein paar Tage an dich erinnern.“ Hoffnungsvoll fügte er hinzu: „Werde ich dich wiedersehen?“
„Mir wäre es lieber, wenn du dich trauen würdest, nach Rom zurückzukehren, um das Leben zu führen, das du führen willst.“
„Wir werden sehen“, wich er aus. „Aber du weißt, wo du mich finden kannst?“
Ich nickte. Es war an der Zeit aufzubrechen. Trotz des pochenden Schwindels im Kopf verließ ich raschen Schrittes das Haus, um zu meiner Unterkunft zu gehen. Dort wusch ich mich, packte meine Habseligkeiten zusammen und holte David aus dem Stall. Auch diesen Ort verließ ich im Galopp.
Um ein Haar hätte ich vor dem Stadttor einen Reiter vom Weg abgedrängt.
„Hoppla“, rief er und zügelte seine kleine Stute. „Judas aus Judäa, richtig? Der Mann, der Gott so überaus gut kennt! Ich habe dich nicht vergessen.“ Er grinste mich ungezwungen an und zwinkerte.
Ich brauchte einen Moment, ehe ich ihn erkannte. Es war der Mann, der mich bei meinem letzten Besuch in Sepphoris vor Marcus’ Annäherung gerettet hatte.
„Thomas, entschuldige.“
„Mal wieder auf der Flucht vor stumpfsinnigen Römern?“, fragte er.
„Das könnte man tatsächlich so sagen“, bekannte ich und hatte das Gefühl zu erröten.
„Das gefällt mir“, sagte er und grinste wieder. Ich lachte dumpf und brachte David dazu, im Schritttempo neben Thomas’ Stute zu gehen.
„Übrigens habe ich den Wanderprediger gesehen, von dem du erzählt hast. Er heißt Jeshua.“
„Ah!“, rief Thomas erfreut. „Was für ein Zufall! Wenn es stimmt, was ich gehört habe, soll er heute in einem Dorf hinter Tiberias sein.“
„Wirklich?“, fragte ich erschüttert.
Thomas sah mich neugierig an und antwortete: „Ich hatte vor, ihn sprechen zu hören, bevor ich mich auf meinen Weg nach Caesarea Philippi mache. Willst du mich nicht begleiten?“
Ich senkte einen Augenblick den Kopf.
„Ja“, sagte ich dann und wich zwei römischen Fußsoldaten aus. „Ja, ich will ihn sehen.“
Thomas nickte zufrieden und warf mir ein kleines weißes Brot zu. Genüsslich biss er in seins und ritt neben mir weiter. Ich atmete tief durch und nahm ebenfalls einen Bissen Brot.
Der Tag war mild, der Himmel hing blau über uns. Wir rasteten unterwegs einmal, und Thomas erzählte mir von seinen Geschäften in Caesarea Philippi. Er war ähnlich wie ich als Einkäufer tätig, doch handelte seine Familie mit Speisen und Gewürzen. Seine Vorfahren waren von der Insel Paros nach Israel gekommen. Da Thomas eine hervorragende griechische Bildung genossen hatte, disputierten wir den Rest des Weges über die Komödien von Menander und Aristophanes.
Kurz vor dem Dorf wurde ich langsamer.
„Und du bist sicher, dass es heute ist?“, fragte ich nervös.
„Natürlich nicht!“ Thomas lachte. „Aber das werden wir ja gleich feststellen. Dort vorn ist schon der Markt.“
Wir ritten im Schritttempo auf den kleinen Platz. Mit rasch klopfendem Puls suchte ich die Menge nach einem bekannten Gesicht ab, doch fand keines.
Thomas wurde bald unruhig und wollte nicht länger warten, so ritt ich feige mit ihm. Auf der Straße zum Dorf kam uns eine Schar Wanderer entgegen. Ich erkannte Jeshua sofort. Die Art, wie er sich bewegte – aufrecht und gelassen –, war mir bereits vertraut. Wir winkten einander im gleichen Moment zu.
„Das ist er, nicht wahr? Großartig!“, rief Thomas und hielt sein Pferd an. Auch Marjam, die neben dem jungen Johannes ging, hatte mich entdeckt und hob ihre Hand zum Gruß.
„Seht euch diese Frau an!“, sprach Thomas ehrfürchtig.
Wir stiegen von unseren Pferden und erwarteten die Wanderer. Jeshua war als erster bei uns und lächelte vermutlich genauso zurückhaltend wie ich selbst. Ich stellte ihm Thomas vor. Jeshuas ehrliche Freundlichkeit erreichte auch ihn, und so gingen wir alle gemeinsam zurück zum Markt.
Wie ich es schon zweimal gesehen hatte, hielt Jeshua auf den Brunnen zu und begann einfach zu reden.
„Es ist wichtig, etwas benennen zu können. Bekommt eine verschwommene Angst einen konkreten Namen, muss sie weichen. Ansonsten hält sie uns in ihren Klauen, und wir erleiden sie in jeder Hinsicht. Ähnlich ist es mit verschiedenen Schmerzen. Beginnen wir unseren Schmerz anzuhören, muss auch er weichen, und die Heilung kann einsetzen, manchmal augenblicklich.“
Unauffällig schaute ich zu Thomas, er lauschte zunächst stumm, nickte ab und an oder hob abwartend die Augenbrauen.
Nach seiner Rede kam Jeshua zu uns, begleitet von Nathanael und Johannes. Wir begaben uns an den Rand des Marktes, und Thomas und ich banden unsere Pferde an.
„Das, was du über die Angst gesagt hast, widerspricht nicht dem, was Plato meint“, sprach Thomas und tippte sich dann gegen die Stirn. „Wie drückte er es noch gleich aus?“
„Angst ist Ausdruck einer Schlechtigkeit der Seele, die leidvoll ist und weiteres Leid gebiert“, half ich aus. Thomas nickte sogleich.
Jeshuas Augenmerk ruhte nicht auf Thomas, sondern auf mir, als er sagte: „Ich denke auch, dass jeglicher Zustand immer mehr desgleichen anzieht. Doch gefällt mir Platos Aussage besser, dass Angst Ausdruck einer unvollkommenen Erkenntnis ist. Denn damit kommen wir wieder zu einer Lösung. Was nützt uns die Umschreibung der Angst, wenn wir kein Werkzeug erhalten, um sie aufzulösen?“
Thomas und ich nickten beide, während Nathanael und Johannes Jeshuas Ausflug in die griechische Philosophie eher stirnrunzelnd folgten.
Nach einer Weile blickte Thomas prüfend zum Himmel.
„Ich muss mich auf den Weg machen. Aber ich werde nach dir Ausschau halten“, sagte er zu Jeshua. „Und auch nach dir, Judas. Das Gespräch ist gerade erst auf die Beine gekommen, wollen mal sehen, ob es noch weitere Schritte zu gehen vermag.“
Er schwang sich auf seine Stute.
„Außerdem hoffe ich, Jeshua, dass du Judas seine besondere Frage beantworten kannst!“, sagte er augenzwinkernd. Ich schnaubte.
„Welche Frage?“, wandte Jeshua sich neugierig an mich.
Thomas kam mir zuvor: „Ein Philosoph hat ihn zu einer Diskussion herausgefordert, aber Judas hat deutlich gemacht, dass er nur die Antwort auf die einzig bedeutende Frage haben will.“
Jeshua sah mich erwartungsvoll an, und ich sprach ohne Umschweife: „Ich will wissen, warum das Leben so beschissen und warum Gott so ein quälender Mistkerl ist, der es nicht schafft, dem Menschen eine einfache Antwort zu geben.“
Jeshua lachte mit gesenktem Kopf. Das war auch die Sprache, die Nathanael verstand, denn der lachte am lautesten und schenkte mir ein anerkennendes Augenzwinkern. Jeshua sagte zu mir: „Das sind zwei Fragen, Judas. Und beide werde ich dir beantworten, aber dazu brauche ich etwas deiner Zeit.“
Ich hob meine Augenbrauen. „Bedeutet das nicht, dass es keine einfache Antwort gibt?“
„Nein, das bedeutet es keineswegs. Es braucht nur Zeit, Gottes Einfachheit zu akzeptieren“, sagte er ernst.
„Tja, Zeit ist leider das, was ich gerade nicht mehr habe“, sprach Thomas von seinem Pferd aus. „Aber ich bin gespannt auf mehr!“
Ich verspürte Bedauern, als er davonritt, und bemerkte den verunsicherten Blick, den Johannes mir zuwarf.
Jeshua war des öffentlichen Redens noch nicht müde, und ich folgte ihm in das Marktgedränge zurück. Er sprach darüber, dass wir nicht über andere richten sollten.
„Ihr wollt doch auch nicht, dass jemand über euch richtet, nicht wahr?“
Manche Dorfbewohner hatten mit ihrer Arbeit aufgehört. Eine grauhaarige Matrone stützte sich auf einen Karren voller Fisch, den ihr Mann geschoben hatte, und stierte Jeshua an. Sie trat einen Schritt vor und spuckte deutlich vor ihm aus. Ich hielt die Luft an.
„Richte nicht über mich, Mutter“, sprach Jeshua leise und blickte sie geradeheraus an, „so will ich nicht über dich richten.“ Sie starrte zurück. Ihre Augen verengten sich, fast so etwas wie Furcht schien aufzuflackern und sich in Wut zu wandeln. Sie spuckte noch einmal vor ihm aus, aber es schien Jeshua nichts auszumachen. Er sprach einfach weiter, und ich sah zu, wie die Alte mit ihrem Karren voll stinkender Fische an mir vorbeischlurfte, meinen Blick bemerkte. Sie blieb stehen, ein boshaftes Grinsen verformte ihr runzliges Gesicht und zeigte ihre wenigen verbliebenen Zahnstumpen. Sie schob sich um den Karren herum und kam auf mich zu. Ich konnte meinen Blick nicht von ihr abwenden. Sie griff zur Seite in den stinkenden Fischabfall, der neben den stumpf glänzenden Fischleibern lag, und warf ihn mit einer Handbewegung vor meine Füße. Jeshua hörte auf zu reden. Die Alte schob sich noch näher und spuckte dann auch vor mir aus. Ich blieb erstarrt stehen, der Gestank des Abfalls stieg vom Boden auf. Plötzlich war Jeshua an meiner Seite.
„Richte nicht über ihn!“, sprach er dermaßen achtunggebietend zu der Alten, dass sie jäh zitterte. Sie wich einen Schritt zurück. Ihr Mann hatte ängstlich den Karren losgelassen, es rumpelte, und die Fischleiber und ihre Überreste verteilten sich um die Beine der Alten. Sie fing an zu schreien. Eine römische Wache kam hinzu und bahnte sich einen Weg zu dem Fischweib. Sie zeigte keifend auf den Karren, dann auf Jeshua.
„Ich habe dir kein Leid zugefügt, Weib. Dein Mann hat den Karren losgelassen.“
Die Wache musterte den ruhigen Jeshua und stach abschätzig mit seinem Speer in einen der Fische.
„Die stinken, als wären sie schon seit Tagen tot. Bring die Schweinerei wieder in Ordnung“, sagte er zu dem Weib, das daraufhin weiterschrie. „Und zetere nicht so, sondern sorge besser dafür, dass du mit diesem Unrat niemanden vergiftest!“
Er schüttelte sich angewidert und nickte Jeshua zu. Dieser zog mich von der Alten weg.
„Kümmere dich nicht um sie“, sagte er zu mir. „Sie ist seit einer langen Zeit fauliger als ihre Fische.“
Mit gesenktem Kopf ging ich mit ihm an den Marktbesuchern vorbei zu David.
„Nur ein Stück weiter hat man uns eine Unterkunft angeboten, dort werde ich im kleinen Kreis noch mehr erzählen. Schließe dich uns für heute an, Judas“, drängte Jeshua sachte. Ich nickte, mied aber den Blick in seine Augen. Eine eigenartige Schwäche machte mich benommen, vielleicht forderte die vergangene Woche ihren Tribut, ich wollte allein sein, war jedoch nicht in der Lage, jetzt fortzureiten. Schweigend band ich David los und folgte den anderen mit Schritten wie im Schlaf zu einem schiefen Häuschen am Rande des Dorfes.
Ich stieg hinter Jeshua und Johannes die kurze Treppe zum Dach hinauf. Ich stand dort verloren und schaute über die Landschaft, die Menschen, so fernstehend, fremd. Plötzlich erfasste mich ein bekanntes Gefühl. Mitten auf diesem Dach stockte mir der Atem, Schwindel lähmte mich und meine Gliedmaßen begannen zu zucken. Nein, nicht hier, nicht jetzt! Ich versuchte, noch ein paar Schritte zu gehen, und während ich fiel, hörte ich Jeshuas Stimme „Nathanael!“ rufen.
Jemand fing meinen Sturz ab, und wir gingen beide zu Boden. Doch mein Fall nahm kein Ende, drängte mich tiefer und tiefer in dunkles Vergessen. Weg von mir. Weg von ihm.
Das Nächste, das ich dumpf wahrnahm, war eine junge Stimme, die fragte: „Wieso heilst du ihn nicht, Rabbi?“
„Weißt du noch, was ich euch gestern erzählt habe? Jeder von uns hat einen freien Willen und entscheidet selbst. Auch ob er Heilung zulassen will“, erklärte Jeshua.
Die Worte hatten einen trüben Klang, als befände ich mich hinter einer Wand aus schlammigem Wasser. Unbeteiligt hörte ich zu, als ginge es um einen anderen, fühlte nichts.
„Aber Rabbi“, begann Johannes verständnislos, „wieso will sich einer so quälen?“ Seine Stimme klang aufgeregt. „Können wir gar nichts tun?“
„Wir können etwas tun und ihn lassen. Wir können bei ihm bleiben und da sein, wenn er uns braucht.“
Ich spürte, dass Jeshua beharrlich in meiner Nähe blieb, während ich fort war, fern in einem Versteck, das ich seit meiner Kindheit kannte.
Irgendwann hörte ich jemanden in die Stube treten. Ich konnte nicht sagen, wie viel Zeit vergangen war.
„Jeshua, wieso kannst du ihm nicht helfen?“, fragte eine weibliche Stimme beunruhigt. Marjam.
„Er möchte meine Hilfe nicht“, sagte er leise, und sie fragte nicht weiter.
„Jeshua, ich kann dich ablösen und bei ihm bleiben.“
„Nein.“
Wenig später hörte ich ihre leichten Schritte und das schwere Schleifen des Türleders. Störrisch blieb Jeshua bei mir, tropfte mir immer wieder Wasser in den Mund und rieb mir das Gesicht mit einem feuchten Tuch ab. Mir war, als sagte er: Ich lasse dich in Ruhe, aber ich lasse dich nicht allein.
Ich sank tiefer in mich hinab durch die Räume eines Traumes; Zimmer für Zimmer vollkommene Leere.
Ich erwachte in ferner Ahnung eines Albtraums. Schwer atmend schlug ich mit einem Arm um mich und hob den Kopf. Wo war ich?
Jeshua saß keine zwei Schritte von mir entfernt, und ich starrte ihn beklommen an. In diesem Moment schob jemand den Türvorhang beiseite, und Licht drang in die Stube – rotes Dämmerlicht.
„Ah“, sagte Simon mit einem erfreuten Blick auf mich und schaute dann zu Jeshua. „Du hast ihn geheilt, Rabbi!“
„Nein, Simon“, erwiderte Jeshua nur und stand auf, um mir eine Schale Wasser zu reichen.
Simon zog die Brauen zusammen. Ich trank von dem Wasser und versuchte, wacher zu werden, die Situation und den Tag zu verstehen. Als hätte Jeshua meine Frage vernommen, sagte er wie nebenbei: „Es ist der nächste Morgen, Judas. Du hast die ganze Nacht geschlafen.“
Er selbst sah aus, als hätte er die ganze Nacht nicht geschlafen.
„Wir werden noch hierbleiben, bis Judas sich vollständig erholt hat, Simon. Sag Marjam, dass wir ihr jetzt dankbar für ein gutes Essen wären.“
Simon nickte wieder und ging.
Jeshua sagte zu mir: „Du hast solche Anfälle schon öfter durchgemacht, nicht wahr?“
„Ja“, murmelte ich.
„Waren sie jedes Mal gleicher Art?“
Weil mir die Kehle unter seiner freundlichen Anteilnahme eng wurde, schüttelte ich nur mit dem Kopf und schloss die Augen. Seine Nähe war schwer zu ertragen und schön zugleich.
Nach einer Weile flüsterte er: „Was immer in deinem Leben geschehen ist, es hat dich hierher gebracht. Und was immer mir widerfahren ist, hat mich an genau die gleiche Stelle geführt, Judas. Hier stehen wir nun beide, geführt von demselben Stern. Glaubst du nicht, dass wir einander helfen sollten zu verstehen?“
Ich öffnete wieder meine Augen.
„Was ist es, dass du verstehen müsstest?“, flüsterte ich zurück und rieb meine rissigen Lippen aneinander. Er lächelte ein bisschen, wirkte einen Moment lang wie ein verlegenes Kind, ehe er sagte: „Wie ich deine Freundschaft gewinnen kann.“
Am Nachmittag ging es mir gut genug, um aufbrechen zu können.
„Bei Neumond werden wir in Kefar Nahum sein, wenn du mich ... uns ... wiedersehen willst“, sprach Jeshua. „Wir haben immer einen Platz für dich, vergiss das nicht.“
Ich nickte stumm, konnte und wollte kein Wort des Abschieds finden.
Dennoch musste ich gehen. Zurück in die tiefsten Schatten.