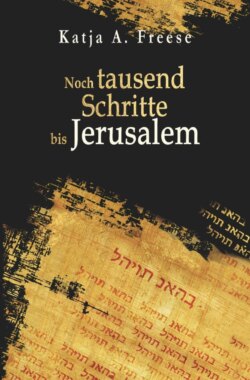Читать книгу Noch tausend Schritte bis Jerusalem - Katja A. Freese - Страница 6
Оглавление
Im Labyrinth
Ich machte mich in Richtung Sepphoris auf, und zwar, um offenstehende Geschäfte abzuschließen. So ritt ich zunächst ins syrische Damaskus, das nicht weit vom See Tiberias entfernt war, und arbeitete mich durch die großen Städte Galiläas und Judäas. Nur Jerusalem mied ich. Ich weiß nicht wieso, aber ich konnte diese Stadt jetzt nicht ertragen. Zumeist lagerte ich im Freien und ließ mich auf keine Verhandlungen ein, die mich länger als einen Tag irgendwo hätten halten können.
Schließlich machte ich mich auf den Weg nach Iskarioth. Das Stadthaus meiner Familie glich einer Festung. Aus Angst vor den Sicarii, die ihn wegen seiner Verbindungen zu den Römern jederzeit meucheln konnten, hatte mein Vater sich hinter imposanten Mauern verschanzt. Ich hatte David und mein Bündel am Morgen in einer nahegelegenen Herberge zurückgelassen, bereit für einen baldigen Aufbruch.
Ich sammelte mich, bevor ich an das hohe Tor klopfte. Es öffnete mir ein unbekannter Diener und fragte mich nach Namen und Ansinnen. Mein Vater wollte mir bereits an der Tür vermitteln, dass ich das Recht auf familiäre Behandlung verwirkt hatte, denn der Diener ließ mich auf der Straße warten. Kurz darauf geleitete er mich in das Haus und forderte mich auf, im Atrium Platz zu nehmen. Ich setzte mich neben den gurgelnden Marmorbrunnen. Die Zeit verkürzte ich mir mit Platons Phaidon, über den Tod und die Unsterblichkeit der Seele. Ich las immer nur ein paar Zeilen, ehe ich wieder meinen Kopf hob und mich im halbdunklen Innenhof umblickte. Die Schatten bargen noch die eigentliche Kälte dieser Jahreszeit und ließen mich frösteln.
Als ich Schritte hörte, atmete ich tief ein und erhob mich. Mein Vater trat aus dem Säulengang. Stumm, ohne mich zu begrüßen, ließ er seinen Blick über mein weißes Gewand schweifen, das mit einem einfachen Lederstreifen gegürtet war. Er selbst präsentierte sich in einer aufwändig verzierten Tunika und mit reich geschmückten Handgelenken; in dem einzigen Sonnenflecken des Innenhofs blieb er stehen. Ich versuchte gewappnet zu sein für das, was nun folgen würde und zog den prallen Beutel mit den Gewinnen der letzten Tage aus meinem Umhang. Die Geldstücke klirrten leise aneinander, als ich den Beutel auf einem Marmorsockel ablegte. Ich straffte meine Schultern und durchbrach das uralte Schweigen.
„Meine Geschäfte für diese Familie sind abgeschlossen.“ Meine Worte verdichteten sich wie Morgennebel, hingen sichtbar zwischen uns. Der Blick meines Vaters veränderte sich, Wut wilderte in seinen Augen. Ich schaute nicht weg, dachte an Jeshua und die Freiheit, die er mir in Aussicht gestellt hatte, und fuhr entschlossen fort: „Ich werde gehen und nicht zurückkehren.“
Mein Vater vereinnahmte jäh den gesamten Schatten um uns herum, schien mit ihm zu wachsen. Mein Herz begann unwillkürlich zu klopfen, wie das des kleinen Jungen, der ihn fürchten gelernt hatte.
„Wage es nicht, so mit mir zu sprechen!“ Seine Stimme erhob sich gleichsam mit seiner Hand, als wären beide durch einen Faden miteinander vernäht.
Trotz des Dranges zu fliehen, blieb ich fest stehen. Ich war kein Junge mehr und sagte so ruhig wie möglich: „Ja, das ist die einzige Waffe, die dir zur Verfügung steht, nicht wahr?“
Seine Hand ballte sich zu einer Faust, doch er benutzte sie nicht. Einen Moment blieb er still, dann rief er nach dem eigentlichen Wächter dieser Festung. Dem Minotaurus. Mein Herzschlag dröhnte mir plötzlich in den Ohren, schlug von innen angstvoll gegen meine Haut. Er war hier. War ich verrückt, noch einmal diese Mauern zu betreten? Mich fangen zu lassen. Stampfende Schritte bewegten sich auf uns zu.
Drohend.
Der Minotaurus.
Er kommt.
Eine schmale Mondsichel spiegelt sich in der Wasserschale am Fenster. Sie verschwimmt, als hätte Wind das Wasser bewegt, doch ich bin es, der sich auflöst. Verloren blicke ich auf den Marmor, auf dem ich knie. Das verwischte, verschmierte Rot ist Teil der Marmorierung geworden.
Die Stille um mich brennt ahnungsvoll, spannt sich durch meinen gesamten Körper. Jedes Härchen stellt sich schmerzhaft auf. Ich krümme mich unwillkürlich nach vorn. Zum ersten Mal habe ich mich dem Ausgang dieses düsteren Labyrinths genähert, doch der Minotaurus lauert hinter mir, bereit, mich aufzuhalten. Die Spannung steigert sich ins Unerträgliche. Ein Sirren bringt mich dazu, den Atem einzusaugen. Die Peitsche zerteilt mit ihrer Schärfe erst die Stille, dann die Haut in meinem Nacken. Einen Moment lang droht der Schmerz mich aufzuspalten. Ich beiße die Zähne fest zusammen, lasse kein Stöhnen entweichen. Schwärze zieht sich um mich herum zusammen. Ich dränge die Schatten mit aller Kraft von mir und versuche, den Kopf zu heben, ich muss bei mir bleiben. Mein Vater hat seinen Teil getan, er hat die Peitsche an Onkel Johab weitergereicht. Der lässt sie pendeln. Ihn so zu sehen, weckt meine schlimmste Erinnerung. Schwarz schwingt die Peitsche durch mein Herz, ehe sie meinen Rücken trifft und mir den Atem nimmt. Ein weiterer Schlag zischt über mich. War die Welt jemals sanft, das Leben jemals sicher? Die Schläge kommen schneller, heftiger. Ich kann das Stöhnen nicht mehr zurückhalten. Ich brauche einen Gedanken, etwas, das mich zusammenhält. An die, die gegangen sind, kann ich mich nicht länger lehnen. Ich bekomme einen Tritt auf den Rücken und werde auf den Marmor gedrückt. Ich bin ganz unten angelangt.
„Hier gehörst du hin“, raunt der Minotaurus. Onkel Johab verliert die Kontrolle, so wie damals. Ich sehe noch immer vor mir, wie es vor dreizehn Jahren geendet hat. Die Schatten kommen wieder näher, sind wie freundliche, weiche Schwingen. Und wäre es nicht gut, wenn auch ich endlich ende? Nichts mehr aushalten müssen. So viele Schmerzen, Schmerz, zu viel, zu viel. Wieso bin ich nicht längst gebrochen? Wieso nicht? Wie eine Stichflamme durchzuckt mich mein vertrauter Albtraum, und absurderweise ist dies der Gedanke, den ich brauche, um auf die Knie zurückzukommen. Es gibt immer noch etwas zu beschützen, auch wenn ich nicht weiß, was es ist.
Onkel Johab ist abgelenkt, mein Vater hat ihm in die Peitsche gegriffen. Er will nicht mit meinem Tod befleckt sein. Ich nutze diesen Moment. Mühsam richte ich meinen Oberkörper auf und gebrauche die Waffe, die ich am besten beherrsche.
„Vater“, flüstere ich eindringlich und erringe seine Aufmerksamkeit, „du wirst nachts aus deinen Albträumen erwachen und feststellen, dass sie nicht gegangen sind. Deine Tochter Channah wird dich verfolgen; deine Ehefrau Judith verfolgt dich. Sie warten und beobachten dich.“
Ich sehe, wie Furcht ihn fesselt, obwohl er sich dagegen wehrt. Er war schon immer zutiefst abergläubisch und feige.
„Ja, Vater, denn du hast ihren Tod verschuldet, nicht wahr? Du wirst Channah nachts an deinem Bett atmen hören. Du hast sie verabscheut und versteckt, doch sie hat sich nichts mehr gewünscht, als ein gütiges Wort von dir zu hören. Sie hat es niemals bekommen, wartet noch immer.“
Ich beobachte, wie der Gesichtsausdruck meines Vaters zwischen Wut und Angst wechselt.
„Und auch das Blut ihrer Mutter lässt sich nicht von deinen Händen waschen, das weißt du nur allzu genau“, fahre ich fort. „Judith hat sich das Leben genommen, weil sie nicht mehr ertragen konnte, dass du die Frau deines Bruders immer und immer wieder genommen hast“, ende ich.
Mein Vater erstarrt augenblicklich, doch Johabs Körper beginnt zu beben, und seine Augen blicken irr. Der Minotaurus brüllt. Ein Kampf entsteht zwischen den beiden Brüdern. Ich krieche vorwärts, immer weiter. Ich schaffe es, auf die Beine zu kommen und erreiche den Ausgang des Labyrinths, in dem ich mein gesamtes Leben umhergeirrt bin.
In der Herberge ist alles still. Im Dunkeln der Nacht wasche ich mir mühsam die Wunden und ziehe ein neues Gewand aus dem bereitgelegten Gepäck über. David wartet im Stall und schnaubt nervös, als er das Blut an mir riecht. Ich muss all meine Kraft aufbieten, um mich auf seinen Körper zu hieven und festzuhalten, vertraue mich seinen Instinkten an.
Von Iskarioth aus dränge ich durch die Wüste, auf der Spur des abnehmenden Mondes.
Ich blicke nicht zurück, es ist ohnehin nichts mehr geblieben. Außer mir selbst, einem Gefäß voller Risse.