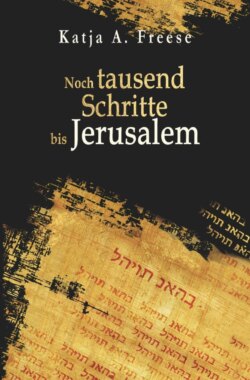Читать книгу Noch tausend Schritte bis Jerusalem - Katja A. Freese - Страница 7
Оглавление
TEIL II
In Scherben
Kefar Nahum war von hohen Eukalyptusbäumen umgeben und lag direkt am Tiberias. Beim Anblick des friedlichen Gewässers überkam mich Erleichterung. Ich hatte tatsächlich meine Familie verlassen und eine Rückkehr unmöglich gemacht.
Langsam ritt ich an der Zollstation vorbei, und ein paar Kinder liefen neben David und mir her bis auf den bevölkerten Markt. Die Bauern hatten die erste Ernte eingebracht und boten sie neben dem typischen Fisch in aufgestellten Bretterbuden feil. Kefar Nahum war ein aufblühendes Handelszentrum und befand sich nahe der Via Maris, die es mit Damaskus verband. Simon hatte erzählt, dass hier eine römische Truppenabteilung stationiert sei. Neugierige Blicke und auch einige der Kinder folgten mir und dem Hengst, als ich mich zu Simons Haus durchfragte. Simon war Fischer und schien gut genug zu verdienen, er besaß ein Steinhaus nahe am Wasser. Seine Frau Naamit zeigte Gastfreundschaft und bot mir ein Lager an, nachdem sie mich ausgiebig gemustert hatte. Vermutlich sah ich erschöpft aus, aber ansonsten konnte man nichts von den Peitschenhieben erkennen. Ich hatte mein Gesicht am Ufer des Jordans betrachtet, die Wunde am Kopf wurde von den Haaren verdeckt, alles andere verbarg das Gewand; so wie immer. Meine Familie hatte stets darauf geachtet, dass nach außen nichts zu erkennen war.
Naamit war eine mütterlich aussehende Frau mit rundlichen Hüften und starken Armen.
„So, du willst dich also auch Jeshua anschließen“, stellte sie fest. Was sie davon hielt, war nicht zu deuten. Von ihrer Art glich sie ihrem Mann, sie strahlten beide sowohl Verlässlichkeit als auch Unnachgiebigkeit aus. Sie bot mir einen Becher Wasser an und bereitete eine tiefe Schüssel zum Waschen meiner Füße vor. Ich nahm diese Willkommensgaben an, ebenso etwas zu Essen. Befangen aß ich von dem Brot und dem Joghurt.
Es war dunkel in der Stube, beklemmend, als wäre ich im Halbschlaf. Dazu passte das drückende Summen hinter meiner Stirn, das mich seit Tagen verfolgte; es rührte von Johabs Tritten gegen meinen Kopf. Die Ecken der Stube lagen im Dunkeln, die wenigen Möbel waren nur als Schemen zu erkennen. Ich lenkte meine Aufmerksamkeit auf das Brodeln des Topfes über der Feuerstelle und den Anblick der Tonkrüge, die sorgfältig in einem Regal aufgestellt waren. Eine sanfte Schärfe stieg mir in die Nase, als Naamit begann, einige Lauchstangen zu schneiden.
Was tat ich hier nur? Ich saß bei einer Fremden, nunmehr ohne Familie, ohne Habe, ohne Arbeit. Das einzig Vertraute in all dem Ungewiss war der dumpfe Schmerz, der meinen Körper umgab und mich zusammenhielt.
Naamit stand auf, um den Lauch in den Eintopf zu geben. Sie bückte sich zu einem Wasserkrug. Sogleich erhob ich mich und nahm ihn ihr ab.
„Da hinein“, sagte sie und zeigte auf den brodelnden Topf über dem Feuer. Ich beugte mich vor und goss etwas Wasser ein. Würzig riechender Dampf strich heiß über mein Gesicht.
„Du hast Blut an deinem Gewand!“, stieß Naamit überrascht aus. Abrupt richtete ich mich auf und wandte meinen Rücken von ihr ab.
„Ich habe mich vor meiner Abreise verletzt“, bekannte ich zögernd. „Ich dachte, es wäre verheilt. Ich habe bereits mein anderes Gewand mit dieser Verletzung ruiniert.“ Iskarioth hatte ich ohne Geld verlassen, wollte nichts mitnehmen, worauf meine Familie hätte Anspruch erheben können. Jetzt war ich nicht mal mehr in der Lage, mir ein neues Gewand zuzulegen. Naamit musterte mich, als hätte sie meinen Gedanken nachvollzogen.
„Wir werden es einen halben Tag in Wasser einweichen lassen und sehen, ob die Flecken rausgehen“, nahm sie sich der Sache an. „Ich werde dir eines von Simons Gewändern geben. Er hätte nichts dagegen, und wenn doch, dann soll er sich auf der Stelle beschweren, und das kann er nicht. Also!“ Sie senkte ihre Mundwinkel und warf ihren dicken braunen Zopf nach hinten. Das Angebot konnte ich kaum ablehnen.
Sie verschwand nach hinten und kam einen Augenblick später mit einem hellen Stoffbündel zurück. Sie drückte es mir in die Hand und schickte mich damit in einen angrenzenden Raum. Es war eine kleine Kammer mit einem Lager am Boden, einer Truhe aus Holz und einer Waschschüssel. Ich entkleidete mich vorsichtig. Die Wunden schienen nicht wieder aufgegangen zu sein, und so faltete ich das Gewand zusammen und legte es für Naamit auf die Truhe. Ich zog mir den frischen, rauen Stoff über, der meine Haut brennen ließ. Ich hörte das Zischen der Peitsche, erinnerte mich an die brutale Kraft, die in mein Fleisch geschnitten hatte. Ich biss die Zähne zusammen und blickte an mir herunter. Konnte man so einfach ein anderer werden? Konnte man die Vergangenheit mit all ihren Fesseln gegen eine neue Gegenwart eintauschen?
Trotz Naamits Freundlichkeit fühlte ich mich wie ein Eindringling. Ermüdet fiel ich früh auf mein Lager in der Kammer nahe der Stube. Ich konnte nicht einschlafen, betrachtete die zarte Mondsichel durch die Fensterluke, bis das Bild mit einem Mal kippte und der Mond verschwamm. Ich erschrak. Ich stand in einer Halle, doch das Licht schwand, die Fackeln an den Wänden erloschen nach und nach, bis nur noch eine Flamme übrig blieb. Der Rauch, gemischt mit Parfümöl, drang mir beißend in die Nase.
Sie war hier.
Ich hatte es nicht geschafft, hatte den Ausgang nie passiert, war noch immer im Labyrinth gefangen! Ich wimmerte, wurde kleiner, ängstlich. Die Nacht löste sich aus dem Fensterrahmen, floss mir als bitterer Wein in den Mund. Ich ertrank fast daran, und der leere Schwindel der Droge erfasste mich. Aber nicht einmal ein ‚Nein’ kam über meine Lippen.
Dann trat sie in den Fackelschein. Die Goldbänder an ihren Handgelenken, über ihren Brüsten und an den Hüften klirrten leise. Sie stand niemals ruhig da, immer wellte eine unmerkliche Bewegung durch ihren Körper, zart und geübt wie bei einer Schlange. Ich fühlte die alte Ohnmacht durch mich kriechen wie Gift.
„Glaubst du wirklich, du könntest mir entkommen, mein Schöner?“
Sie griff nach der Mondsichel, die sich noch immer im Ausschnitt des Fensters zeigte, und hielt sie einen Moment später in der Hand.
„Wem gehörst du?“ Sie kam näher.
Mir, wollte ich schreien, aber meine Zunge gehorchte mir nicht. Sie streckte die Mondsichel nach mir aus und schnitt ihren Namen in die nackte Haut meiner Brust.
Lavernia.
Ich konnte nur willenlos zusehen, bis ich ein Geräusch von außerhalb der Mauern vernahm. Ein Rascheln, Schritte. Und es war nicht mehr meine Tante, die vor mir kniete. Es war Jeshua. Die winzige Flamme einer Öllampe erhellte sein besorgtes Gesicht.
Bist du hier? Wo bin ich? Der Mond, ich ...
Ich kämpfte um Klarheit. Vielleicht war Jeshuas Anwesenheit nur die Wirkung von Lavernias Halluzinogen. Er redete mit mir, aber ich verstand nicht, was er sagte. Das Summen in meinem Kopf war unerträglich laut geworden. Ich schlug mir hilflos auf die Ohren.
Ich bin nicht hier, ich bin nicht hier.
Mein Mund konnte nicht sprechen, war zu lange stumm gehalten worden, die Worte, die ich fühlte, hatten niemals das Tor meiner Lippen passiert. Sie formten sich an jeder einzelnen Stelle in mir, brachen aus der Knochentiefe hervor, drückten durch meine Adern und gegen meine Haut, um zu entkommen, doch dem Mund entwichen sie nicht.
HILF MIR!
Risse, Risse, in dem Gefäß, das ich war.
Als hätte Jeshua mich gehört, erreichte mich durch die Dunkelheit nur ein Wort.
Ja.
Er legte seine Hände fest auf meine Schultern. Die Risse brannten, vertieften sich. Das alte Gefäß knackte. Helligkeit trat jäh vor meine Augen und blendete jeden Muskel in mir. Ich brach endgültig auseinander, und alles Wasser strömte mit einem Mal hervor. Hustend, schluchzend. Die hässlichen Geräusche bahnten sich ihren Weg. Verzweifelt. Alt. Einsam.
Ich sackte zusammen, unfähig eine eigene Bewegung zu bestimmen.
„Ich werde dir helfen, wenn du mich lässt“, flüsterte Jeshua. Seine Arme und Worte hielten den wunden Rest von mir, so dass ich nicht verloren ging.
Er war hier.
Ich war aufgewacht.
Laute Stimmen aus der Stube weckten mich. Benommen schaute ich mich um. Ich war allein, nur ein Umhang am Boden zeigte mir, dass Jeshua tatsächlich hier gewesen war. Mit beiden Händen bedeckte ich meine entzündeten Augen. Aller Schutz war fort, ich fühlte mich wie gehäutet, erinnerte mich, wie diese sonnenhafte Helligkeit durch meinen Körper gedrungen war und an das Gefühl flammender Reinigung.
Im Zimmer war es stickig, deshalb stand ich auf, trank etwas und wusch mich mit dem Wasser aus der bereitstehenden Schüssel. Dann schlug ich zögernd den schweren Türvorhang zur Seite und fühlte eine grenzenlose Verlegenheit, als ich aus der Kammer in die Stube trat. Sechs Menschen saßen um den niedrigen Tisch herum und drehten sich zu mir. Ich verschränkte unwillkürlich die Arme vor der Brust, kam mir in dem neuen Gewand wie ein verkleidetes Kind vor.
„Judas“, rief Marjam erfreut, „du hast dich uns angeschlossen!“
Ich erwiderte ihr Lächeln mit einem Nicken. Als nächstes wurde mir Simons unbestimmter Gesichtsausdruck gewahr. Er blickte an mir herunter und dann zu Naamit.
„Da ist also mein gutes Gewand, du treuloses Weibsstück, und ich kann weiterhin den alten Flicken hier anziehen.“ Er klopfte ihr im Vorbeigehen auf die Hüfte und lächelte mich grimmig an.
„Ich danke euch für eure Gastfreundschaft, aber ich werde sie nicht weiter in Anspruch nehmen müssen“, sagte ich und wandte mich in Richtung Tür. Ich wollte aus diesem Haus hinaus, mich an den Tag gewöhnen.
„Kommt gar nicht in Frage“, sagte Naamit, und Simon brummte. Es war schwer zu sagen, ob es Zustimmung oder Missbilligung ausdrücken sollte.
„Sicherlich will euer Rabbi es bewohnen“, erwiderte ich fahrig.
In diesem Moment duckte sich jemand durch den niedrigen Hauseingang; mit ihm floss die Sonne herein. Jeshua. Er schien froh, wieder in Kefar Nahum zu sein, denn er lächelte gelöst.
„Der Rabbi teilt es gern mit dir, wenn du magst“, sagte er und schob sich an Nathanael vorbei. Alle Augenpaare sahen zu mir, schienen mich zu bedrängen. Jeshua war plötzlich nur noch Teil dieser Gemeinschaft, die mir fremd war. Ich schüttelte den Kopf.
Sein Lächeln verlor sich. Er blieb stehen, nickte still und griff nach einem Stück Brot auf dem Tisch. Er wirkte mit einem Mal so unsicher wie ich, obwohl er sich hier offensichtlich zuhause fühlte.
„Ich gehe hinaus.“
Meinen Blick auf den Ausgang gerichtet, bahnte ich mir einen Weg an dem vollbesetzten Tisch vorbei.
Die Nachmittagssonne brannte heiß auf mein unbedecktes Haupt. Wasser. Es zog mich zum See. Ich rannte die letzten Schritte hinunter an den klaren Ufersaum. Ich ließ mich auf die Knie fallen, tauchte meinen Kopf in das Wasser und zog ihn erst wieder heraus, als mir die Luft ausging. Zu meinem Unwillen spürte ich schon wieder Tränen nahen und drückte meinen Kopf erneut in das kühle Nass. Reiß dich zusammen, Judas! Ich fühlte mich nicht mehr wie ich selbst, war nur noch Scherben.
Erst am frühen Abend kehrte ich zurück, um nach David zu sehen und mein Bündel aus Simons Haus zu holen. Zum Glück hatte die Stube sich geleert. Lediglich Naamit stand bei der Feuerstelle und trat auf mich zu.
„Judas, ich habe dein Gewand gewaschen, aber ich konnte die Flecken nicht entfernen.“ Ehe ich etwas erwidern konnte, sprach sie weiter. „Darum schlage ich dir einen Tausch vor: Du behältst das Gewand, das du gerade trägst. Ich kann dir auch noch ein weiteres zum Wechseln überlassen, dafür behalte ich deines. Aus dem Tuch werde ich etwas anderes nähen. Bist du einverstanden?“
Ich runzelte die Stirn. „Das ist kein fairer Handel.“
„Und ob! Ich weiß, wie teuer so ein edler Stoff ist. Was sagst du?“
Ich nickte überfordert. „Dann danke ich dir.“
„Warte einen Augenblick.“
Sie nahm die Stiege zur zweiten Ebene des Hauses. Allein stand ich in der jetzt so stillen Stube. Der Duft des Brotes, das auf dem Ofen buk, erfüllte den Raum, und mein Magen zog sich vor Hunger schmerzhaft zusammen. Ich versuchte, ihn nicht zu beachten. Die Holzleiter knarrte, und Naamit kam mit einem Gewand für mich zurück. Sie überreichte es mir und wandte sich wieder ihrer Arbeit zu.
Ich ging weiter zu der Kammer, in der ich übernachtet hatte, und traf dort Johannes an. Der Junge saß auf einer Matte am Boden und putzte seine Sandalen. Freundlich begrüßte er mich. In plötzlicher Eile nahm ich mein Bündel von der Holztruhe und legte das Gewand hinein. Dann langte ich nach meinem Umhang und verließ die Kammer. In der dämmrigen Stube lief ich beinahe in Jeshua hinein. Stumm sah ich ihn an und wusste nichts zu sagen. Dunkle Furcht wuchs in mir, hielt die Schatten meines Labyrinths aufrecht. Vielleicht um das Zwielicht zu überwinden, fragte er „Geht es dir gut, Judas?“ und fasste mich am Arm. Ich zuckte zurück. Er hatte eine der Wunden getroffen. Oder meine Angst. Seine Hand fiel von mir. Ich schüttelte den Kopf, konnte es ihm nicht erklären. In diesem Moment trat Johannes aus der Kammer, und ich nutzte die Gelegenheit, aus Jeshuas Gegenwart zu flüchten, obwohl er der Grund meines Hierseins war.
Für die Nacht streckte ich mich am Seeufer aus und lauschte dem Plätschern der trägen Wellen, die ans Ufer schwappten. Ich fürchtete den Schlaf, dachte an Jeshua, den Talisman gegen böse Träume. Der Nachthimmel über mir wurde mir zu weit, und wie ich so kämpfte, trat jemand zu mir.
„Judas?“, fragte eine laute Stimme.
„Ja?“ Ich setzte mich auf.
„Ich bin es, Nathanael. Jeshua hat mir gesagt, dass ich dich hier draußen finden würde. Darf ich mich zu dir setzen?“
„Ja, natürlich.“ Tatsächlich war ich gerade froh über diese Ablenkung. Ich hörte, wie sich Nathanael auf den Boden fallen ließ. Eine Woge Weingeruch wehte mir entgegen.
„Du wirst dich uns also dauerhaft anschließen?“
„Das hatte ich so geplant, ja“, murmelte ich.
„Gefällt mir! Hier ist übrigens Brot – und ein Tuch voll Feigen für dich.“
Mein Magen knurrte augenblicklich, und Nathanael lachte. Das Essen landete in meinem Schoß.
„Danke.“ Ich schlug das Tuch auseinander und spürte die rissige Haut der Trockenfeigen unter meinen Fingern. Hungrig biss ich von einer ab, eine körnige Süße füllte meinen Mund.
„Ich soll dir von Jeshua etwas ausrichten“, sagte Nathanael, und ich hörte auf zu kauen.
„Ja?“, fragte ich unwohl.
„Wir leben hier als Gemeinschaft. Das heißt, du bekommst einen Schlafplatz, wenn du ihn brauchst, ebenso Essen und Kleidung. Jeder trägt auf seine Weise etwas bei, mach dir also keine Gedanken. Wir alle freuen uns, dass du hier bist.“ Mir war, als vernähme ich Jeshuas Stimme hinter diesen Worten. Er, der nichts einforderte. Mich erreichte seine ungewöhnliche Güte, und ich wurde augenblicklich ruhiger.
Nathanael ließ mich eine Weile essen, dann fragte er: „Und? Wie fühlst du dich?“
„Hm, kann ich nicht genau sagen.“
„Weißt du“, sagte Nathanael leiser, „als ich damals mit ihm gegangen bin, ist es mir auch nicht leichtgefallen. Alle dachten, ich sei verrückt.“
Ich brummte.
„Als der Rabbi mir die Hände aufgelegt hat, hab ich geheult wie ’ne Katze, die ersäuft werden soll.“
Ich sagte nichts, dachte an die gestrige Nacht, an das Gefühl, zwischen Albtraum und Wirklichkeit zu schwimmen.
„Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, Judas, wollte dir nur sagen, wie es bei mir war ...“
„Das weiß ich zu schätzen.“
Ich betrachtete die winzigen Lichtpunkte der Sterne, die sich im Seewasser spiegelten.
„Nathanael?“, fragte ich. „Wieso will Jeshua ausgerechnet mich dabeihaben? Ich weiß gar nicht, ob ich mich eigne ... ich meine ... ich weiß auch nicht.“ Meine Hand grub sich tief in den Sandboden neben mir.
Nathanael schwieg kurz. „Jeshua braucht jeden von uns für eine Aufgabe. Außerdem scheint er dich zu mögen. Als du letztens davongeritten bist, hat er abends am Feuer zu Marjam gesagt, dass es ganz schön still ohne dich sei. Da war er ebenfalls still. Ich fand es mit dir auch unterhaltsamer, ehrlich.“
Ein Trinkschlauch schlug leicht gegen mein Bein, und ich nahm ihn an. Der rote Wein schmeckte herb und benebelte mir bereits nach ein paar Schlucken die Sinne. Ich legte mich zurück auf den weichen Sand und ließ ihn die Wunden an meinem Rücken kühlen.
„Ach ja“, sagte Nathanael, „das wird dich freuen: Der Freund von dir, dieser Thomas, wird nach Kefar Nahum kommen.“
„Was?“, fragte ich ungläubig und setzte mich wieder auf.
„Ja, wir haben ihn bei Bethzaida getroffen, und Jeshua hat zu ihm gesprochen. Danach sind wir weitergezogen, und Jeshua meinte, Thomas würde in Kefar Nahum zu uns stoßen. Bislang hat er immer recht behalten.“
„Ach?“ Wie machte Jeshua das nur? Nach ein paar Worten wollte Thomas ihm folgen?
„Hatte er auch was über mich prophezeit?“
„Nein“, antwortete Nathanael, „über dich nicht.“