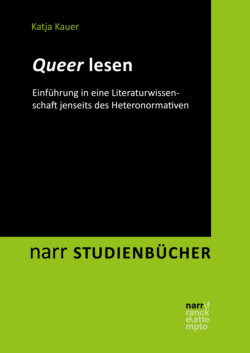Читать книгу Queer lesen - Katja Kauer - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I ‚Abweichendes‘ Begehren in ‚konservativen‘ Texten / queer desire – straight text
ОглавлениеEduard von Keyserling: Wellen (1911)
Eduard von Keyserling (1855–1918) ist ein prominenter Vertreter der Literatur des Fin de Siècle. Er galt zu seiner Zeit als Erfolgsautor, gehört jedoch heutzutage nicht so selbstverständlich zum Schulkanon wie sein um eine Generation älterer Kollege Theodor Fontane (1819–1898), mit dem er häufig verglichen wird. Keyserlings Werk „erfährt in regelmäßigen Abständen eine beachtliche Renaissance“1, und zwar meist unter Zuhilfenahme derselben Stichwörter: Untergang des baltischen Adels, Ironie und Antiutopie. Den Forschungsstand zu dem Autor beschreibt Armin von Ungern-Sternberg als ein erhärtetes Bild von einem „feinsinnige[n], wenngleich etwas konservative[n]“2 Autor, das einer Revidierung harrt. Keyserling malt Stimmungsbilder dekadenten Lebens und unerfüllter Liebe. Die Texte erzählen von der sich im Niedergang befindenden Welt des baltischen Landadels, dessen Konventionen bereits um 1900 der Moderne nicht mehr standhalten können. Sie laden eine (post-)strukturalistisch geschulte Germanistin geradezu ein, sie genauer zu untersuchen. Sie zeigen eine starke Typisierung der Figuren und eine Gestaltung in binären Oppositionen,3 die auf der Textebene immer wieder Brüche produzieren. Das betrifft, wie in der folgenden Lektüre zu zeigen sein wird, vor allem die Sexualität der Figuren, ohne dass diese Brüche vom Autor beabsichtigt zu sein scheinen. Keyserling steht eigentlich nicht im Verdacht, in seinen Texten die Heteronormativität bewusst zu unterwandern. Trotzdem bieten Keyserlings Texte sowohl für eine Genderanalyse als auch eine Queeranalyse einen dankbaren Gegenstand, auch wenn dieser Umstand in der bisherigen Forschung zu Keyserling keine dezidierte Beachtung fand. Sein Prosawerk ist bevölkert von zarten Femme-Fragile-Gestalten, mit Femme-Fatale-Figuren oder ‚weißen‘ (reinen) und ‚roten‘ (erotischen) Frauen, die in ihrer Typisierung wie ‚aus der Zeit gefallen‘ wirken, sowie mit Männern, die bemüht sind, ihre Männlichkeit gegen die Einbrüche des Weiblichen zu behaupten.
Die Femme fatale und die Femme fragile sind die beiden für das Fin de siècle charakteristischen Imaginationen des Weiblichen, in denen sich vor allem sexuelle Wünsche und Ängste figurieren. Während die Femme fragile einen sublimierten Eros verkörpert, eine ideal überhöhte, verklärte, entkörperte Sexualität, stellt die Femme fatale eine übersteigerte, meist in ein exotisches Gewand gehüllte Form der Erotik vor, die dämonisiert wird. Diese beiden Bilder des Weiblichen sind Männerphantasien, die in einem misogynen Zug des Denkens fundiert sind.4
Es ist von erotischen Wünschen und Verwicklungen die Rede, von den Sehnsüchten nach Ausbruch aus der starren Welt und von den Gefahren, die die Übertretung von sittlichen Grenzen für die Figuren bedeutet. Über psychologisierende Einblenden lassen die Texte Figuren entstehen, die ihre Subjektivität in dem strengen Raster von Standes- und Geschlechternormen entwickelt haben und die in ihrem Aufbegehren eigentlich nur die Unmöglichkeit einer tatsächlichen Flucht vor den Direktiven, denen sie sich innerhalb ihrer altadeligen Welt zu beugen haben, deutlich machen. Dass diese Normen in Bezug auf das geschlechtliche Verhalten binär gesetzt sind, also gemäß einer strikten Zweiteilung von ‚männlich‘ und ‚weiblich‘ in den Texten etabliert werden, verwundert nicht. Sind die Frauenfiguren in der adligen Welt zurückgezogen, fragil, künstlerisch begabt, nur im bescheidenen Maß fertil, bestechen die kontrastierenden Männerfiguren durch Lebensechtheit, praktischen Sinn, erotische Kraft und Potenz. Die konkreten Figurationen sind zwar von Text zu Text verschieden, dass die männlichen und weiblichen Figuren als Gegensatzpaare auftreten, bleibt jedoch immer unverkennbar. Deutlich ist auch, dass Frauen als – einmal verehrte, einmal verachtete – Sexualobjekte dienen. Sie lösen das Begehren aus und die Männer leben es aus. Während nämlich in fast allen Texten Keyserlings den Männern aufgetragen ist, ihre als ‚natürlich‘ geltende Männlichkeit, sprich den Hang zur Promiskuität und ihren Freiheitsdrang, in den Nischen, die der adlige Kosmos zur Verfügung stellt, beispielsweise mit Hausmägden, Künstlerinnen oder gesellschaftlich verfemten Frauen auszuleben, ist für die weiblichen Figuren der Adelswelt diese Möglichkeit verschlossen und wird von ihnen auch nicht vermisst: Die weiblichen Figuren zeigen oft kein eigenes Begehren. Sie begnügen sich damit, den an sie gestellten häuslichen Anforderungen in feiner Garderobe, Handarbeiten verrichtend oder Romane verschlingend gerecht zu werden. Ende des 19. Jahrhunderts galt der Sexualtrieb bereits als etwas Naturgegebenes. Aus diesem Grund erscheinen die allzu reinen ,weißen‘ Frauen zwar verehrungswürdig, doch degeneriert, der Autor, der sie erdacht hat, zeigt ihnen gegenüber oft Mitgefühl. Die Frauen wirken wie eingesperrt und scheinen den Schlüssel zu ihrer Befreiung entweder nicht zu finden oder in falsche Hände zu legen. Den adligen, meist ‚weißen‘ Frauen entspricht es in dieser streng geschlechtlich-dualen Welt, den rein privaten Raum zu besetzen, der von ihren Männern für die weiblichen Wesen reserviert wurde. Für ein Leben jenseits der häuslichen Grenze sind sie nicht geschaffen. Junge Frauen, die noch vor dem Eintritt in die Mutterschaft stehen, werden als Sehnsuchts- und Begehrensobjekte stilisiert und unterstehen einer sinnlichen Funktion, ältere Frauen agieren entweder altjüngferlich oder mütterlich, ihnen kommt vor allem die häusliche Funktion zu. Auch der Roman Wellen hält an diesem Schema fest. Mann und Frau sind gänzlich verschieden. Die Bedürfnisse der Geschlechter ergänzen sich nur schlecht, so dass in die heterosexuellen Beziehungen ein Scheitern eingeschrieben ist.
Anlässlich einer Neuausgabe des 1911 erschienenen Romans Wellen entstanden Rezensionen, die eine schwärmerische Ode auf Eduard von Keyserling singen. Er wurde gar als „besser als Fontane!“ bezeichnet.5 Die Rezension aus dem Jahr 2011 zeugt von einem neu erwachenden Interesse an dem Autor. Dieses Interesse an Keyserling besteht bereits seit mehr als 20 Jahren, behauptet Jin Ho Jong in einer Arbeit zu Keyserling aus dem Jahr 2006:
Die vielzitierte Äußerung Jens Malte Fischers von 1974, daß Keyserling „der wahrscheinlich unbekannteste große deutsche Erzähler“ des zwanzigsten Jahrhunderts sei, scheint nicht mehr haltbar zu sein. Denn die in den letzten zwanzig Jahren ständig gestiegene Anzahl neuer Ausgaben seiner literarischen Werke und wissenschaftlichen Arbeiten über ihn deutet darauf hin, daß Keyserling von den Lesern und der Wissenschaft neu entdeckt wird: In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts erschienen insgesamt elf neue Ausgaben und in den 90er Jahren siebzehn, während es in den 70er Jahren lediglich sechs neue Ausgaben gab. In diesem Zeitraum wurden auch deutlich mehr wissenschaftliche Arbeiten zu Keyserling veröffentlicht, so daß von einer Vergessenheit keine Rede mehr sein kann.6
Die Neuausgabe und Rezension von 2011 sind Ausdruck eines schon vorher bestehenden Interesses an dem Autor Keyserling. Die Inhaltsangabe des Romans Wellen hält der Rezensent Michael Maar, den ich hier exemplarisch anführe, kurz:
Die Handlung tut überhaupt nichts zur Sache, obwohl auch sie schön ausgedacht und nicht ganz ohne Überraschung ist. Die junge Frau mit den zu vollen Lippen hat ihren alten adligen Gatten verlassen und ist mit einem Maler Hans durchgebrannt. Das von der Gesellschaft geächtete Paar, das in einer Fischerhütte an der Ostsee lebt, weckt allerhand romantische und sinnliche Motionen aufseiten der zur Sommerfrische versammelten Familie der Generalin von Palikow. Vor allem die Männer, allesamt liiert, verfallen dem Reiz der durchgebrannten Gräfin, die zumindest einen von ihnen somnambul gewähren lässt.7
Auf einem queeren Blick scheint das neu erwachte Interesse aber nicht zu beruhen. Selbst eine genderorientierte Analyse über die Konstruktionen des Weiblichen und Männlichen im Prosawerk Eduard von Keyserlings, in der durchaus konstatiert wird, dass die Frauenfiguren brüchig sind, das heißt widersprüchlich erscheinen8, und dass sich in den heterosexuellen Beziehungen Ambivalenzen zeigen, die durch problematische Asymmetrien hervorgerufen sind,9 verbindet diese Thesen nicht mit dem Wort queer. Was an Keyserling fasziniert, steht bisher keineswegs mit der Forschungsrichtung in Zusammenhang, die ebenso jung ist wie das seit den 80er Jahren gewachsene Interesse an dem baltischen Autor.
Soll nun ein solcher Text wirklich zum Gegenstand einer queeren Lektüre gemacht werden, in dem eine durchgebrannte, sinnliche Gräfin körperliche Begierde in liierten, liebeskranken Männern weckt? Hat dieser Text, der von einer völlig heteronormativ verfassten Welt erzählt, ein queeres Potential? Ja, denn die schöne junge Frau ruft, folgen wir der kurzen Inhaltsangabe, auf Seiten der gesamten Familie „sinnliche Motionen“ wach. Wenn auch „vor allem die Männer“, so heißt es in der Zusammenfassung des Rezensenten, der schönen jungen Frau verfallen, verspricht diese adverbiale Betonung doch auch, dass nicht nur Väter, Söhne und andere männliche Ostseebadbesucher, sondern auch die anwesenden Frauen ihre romantischen Wünsche auf die „zu vollen Lippen“ der hübschen Gräfin projizieren. Diese Inhaltsangabe vermag eine queere Lektüre zumindest sinnvoll erscheinen zu lassen. Tatsächlich werden wir, wenn wir uns dem Text nähern, sehen, dass sich besonders eine Frau von Doralice so fasziniert zeigt, dass wir ohne Weiteres von ‚Entflammtsein‘ und ‚Verliebtheit‘ sprechen können. Von dieser Frauenbeziehung schweigt die Rezension jedoch: Sie verhandelt unter Stichwörtern wie „Paarstudie“ die Beziehungen ‚heterosexueller‘ Paare in einer heteronormativ verfassten Welt und lässt keine queeren Inhalte des Romans vermuten. Eine andere aufschlussreiche Rezension zu Keyserling, die eigentlich für die Erzählung Schwüle Tage wirbt, sagt über Wellen:
Es geht in Wellen eben nicht wie bei Effi Briest darum, dass kunstvoll der Ausbruch aus einer einengenden adeligen Welt beschrieben wird. Nein, Keyserling hebt in dem Moment an, als die Gräfin Doralice, die mit dem jungen Maler Grill durchgebrannt war und nun an der Ostsee eine vermeintliche Salz auf unserer Haut-Idylle lebt, von der Langeweile und der Konvention erfasst wird. Gräfin Doralice hatte das „Leben“ gesucht – und war zu Frau Grill geworden. […]
Die Gräfin Doralice, die sich in ihrer Aussteigeridylle so eingesperrt fühlt wie in ihrer adeligen Heimat, beginnt ausgerechnet mit einem Grafen auf Sommerurlaub anzubändeln, der genau jenem Milieu entstammt, dem sie einst unbedingt entfliehen wollte. So wie hier endet bei Keyserling jeder Fluchtversuch in der Schleife, aus der es kein Entkommen gibt.10
Da ich behaupte, dass Keyserlings Texte überaus geeignete Gegenstände für queere Analysen zu sein versprechen, lässt sich darüber sinnieren, ob die Inhaltszusammenfassung von Florian Illies dieses Versprechen negiert oder untermauert. Nichts deutet auf homoerotische Verwicklungen hin, doch werden wir sehen, dass die Beziehung zwischen Doralice und Lolo von zentraler Bedeutung für den Text ist und dass zumindest die Jüngere eine schicksalsträchtige Passion für die Ältere hegt: Die Rezensionen frappieren, weil sie etwas im Text Offensichtliches nicht in Worte fassen, nämlich ein ‚anderes Begehren‘ der in heterosexuellen Strukturen gefangenen weiblichen Figuren, die von Doralice ebenso auf- und angeregt werden wie die Männer. Dieses ‚andere Begehren‘ erklärt keine der Figuren zu Lesben, doch es führt dennoch dazu, dass sie dankbare Gegenstände für eine queere Analyse sind. Es ist ein Missverständnis, wenn wir glauben, dass queere Analysen besonders dort zielführend sind, wo die Gegenstände schon explizit homosexuell bzw. homoerotisch konnotiert sind. Die Klassiker der schwulen Literatur queer zu lesen ist, als würde man in Kuhmilch Milchpulver geben, um den Geschmackseindruck zu verstärken. Eine queere Lektüre vermag Inhalte, die gegen die Heteronormativität gerichtet sind, gerade in Texten aufzudecken, die einen heterosexuellen Kosmos illustrieren und als heterosexuelle Paarstudie gelten können. Dabei geht es nicht um eine Art psychoanalytischer Literaturwissenschaft, also um den Versuch, auf der Ebene einer jeweils einzelnen Figur etwas Unbewusstes ins Bewusstsein zu heben, das heißt es kann nicht darum gehen, eine der Figuren als ‚eigentlich‘ homosexuell outen zu wollen. Einen Text queer zu lesen, bringt ein kollektiv verdrängtes Textbegehren zum Vorschein. Folgen wir der empirischen Literaturwissenschaft, ist unverkennbar, dass ein Text und seine Figuren immer erst dadurch Sinn bekommen, dass jemand
etwas mit ihnen macht, über sie redet oder sie erfindet, über sie nachdenkt oder sie träumt […]. Indem jemand mit Gegenständen wie Texten etwas tut, schafft er diese Gegenstände, nicht als „Ding an sich“, sondern als ein jeweils bestimmtes Etwas für jemanden.11
Die Texte lassen sich auch aus einer queeren Perspektive „schaffen“, wodurch eine subversive Wirklichkeit generiert wird. Dazu bedarf es keines vermeintlichen Zaubertricks, sondern eines neuen Blickwinkels.
Vergegenwärtigen wir uns, was Queer Reading überhaupt bedeutet. Geht es da nicht immer um Kategorien, die sexuelle Präferenzen bezeichnen, die wir ‚schwul‘, ‚lesbisch‘, ‚bisexuell‘ nennen, oder geht es nicht gar um Phänomene wie Geschlechterrollentausch? Ist ein queerer Text nicht angereichert mit seltsamen Gestalten – was dem englischen Wortsinn nach queer bedeutet –, die in ihrer geschlechtlichen Identität nicht festzulegen sind? Spricht ein queerer Text nicht, in leisen oder lauteren Tönen, von dem verworfenen, verleugneten Begehren?
Während die ersten Fragen eher Vorurteile berühren, ist die letzte unbedingt zu bejahen. Werden Texte gegen den Strich, also queer gelesen, entdeckt man das verleugnete und unter Verschluss gehaltene Begehren als ein durch die Heteronormativität ausgeblendetes Phänomen, von dem die Texte ebenso eifrig erzählen wie von der Liebe zwischen Mann und Frau. Eine queere Lektüre richtet ihr Augenmerk gezielt auf das in der Rezeption bisher ausgeblendete Begehren. Damit ist nicht gesagt, dass alle Texte eine heteronormative Oberfläche und eine queer-subversive Tiefenebene hätten, wohl aber, dass wir in unseren Lektüren meist darauf konditioniert sind, heteronormative Wirklichkeit zu erschaffen, obwohl die Texte und ihre Figuren auch anders gelesen werden können. Unser historisch gewachsenes, prokreatives (fortpflanzungsorientiertes) Sexualverständnis ist durch Begriffspaare geprägt, wonach nur eine Begehrensform als natürlich und daher legitim eingestuft wird, nämlich die heterosexuelle. Diesem konsensorientierten Verständnis nach bedeutet ‚homosexuell sein‘ so etwas wie eine Markierung aufzuweisen. Der betroffene Mensch kann nichts dafür und muss anerkannt werden, seine Existenz ist in Naturgesetzen begründet, aber sie gilt dennoch als Abweichung. Der Status als Abweichung, selbst wenn er nicht abwertend gemeint ist, verhindert es, Heteronormativität zu überdenken. Ihr ist nicht durch homosexuelles Verhalten beizukommen. Sie wird durch die Abweichung nicht relativiert, da eben der Ausnahmestatus der homosexuellen Orientierung die Norm bestätigt statt infrage stellt. Solange die homosexuelle Liebe immer die ‚andere Art‘ zu lieben ist, bedarf jede Anerkennung einer strategischen Rechtfertigung. Queer referiert in der englischen Sprache in erster Instanz auf die Vorstellung von Falschheit, allerdings, worauf in der Einleitung hingewiesen wurde, in ironischer Weise. Was passiert mit unserem Begriffssystem, wenn Figuren, die eindeutig als heterosexuell identifiziert sind, homosexuell begehren und sich dieses Begehren als völlig normal zu erkennen gibt? Eine queere Lektüre ist eine, die die Dichotomie hetero- vs. homosexuell, also die Setzung des Begehrens in ein Begriffspaar, dessen gegensätzliche Teile sich gegenseitig ausschließen, nicht akzeptiert. Eine queere Lektüre akzeptiert die Vorstellung nicht, dass die Heterosexualität die Homosexualität gelungen verdrängt, sprich, dass dort, wo von heterosexueller Liebe die Rede ist, das homosexuelle Moment nicht hörbar sein kann. Da sich die heteronormative Kodierung unserer Gesellschaft (als kultureller Imperativ) ihrer Wahrheit stets neu versichern muss, indem sie permanent eine Ontologie des Gegensatzes zwischen ‚natürlich‘ und ‚unnatürlich‘ betreibt, ist das, was sie verwirft, immer auch auf unbestimmte Weise in die Texte eingesenkt. Der literarische Text besteht nicht außerhalb gesellschaftlicher Konventionen und historisch gewachsener Räume.
Konventionen, Werte, Alltagstheorien im allgemeinsten Sinne sind vielmehr die entschiedenen Faktoren für die Regelhaftigkeit der sprachlichen Praxis. Prädikate wie „literarisch“ müssen deshalb Kommunikaten zugesprochen werden und aus den Regeln und Konventionen, die in einer Gesellschaft jeweils gelten, erklärt und kritisiert werden.12
Deshalb hat es weder mit einer psychischen Verfasstheit des Autors/der Autorin zu tun noch mit der Beschaffenheit des Textes, dass das Queere in ihm für die meisten Leser*innen nicht augenfällig ist. Doch es ist vernehmbar, besonders in Texten wie denen Keyserlings, die so deutlich von dem unerfüllten Begehren ihrer Figuren erzählen und die die heterosexuellen Beziehungen, meist aus der Perspektive der Frauen, als nicht erfüllend und glücklos darstellen. In einem Queer Reading werden die vermeintlich weniger offensichtlichen, gegen die Heterosexualität gerichteten Sinnzusammenhänge herausgestellt.
Dieses Lektüreverfahren wollen wir an Wellen erproben. Dass dieser Roman eine Auseinandersetzung mit der gleichgeschlechtlichen Liebe nicht vor sich herträgt, liegt daran, dass der Autor Keyserling keineswegs über homosexuelle Subjekte schreiben wollte. Nie käme jemand darauf ihn als ‚schwulen Autor‘ zu bezeichnen. Niemand erwartet von ihm ein Statement in diese Richtung. Keyserling skizziert in Wellen eine Welt voll Melancholie. Ist das auf das eigene Geschlecht gerichtete Begehren womöglich ein Bestandteil, wenn auch ein bisher überblendeter Teil, dieser Welt im oben beschriebenen Sinn?
Ziehen wir ein literaturwissenschaftliches Lexikon zu Rate, sehen wir, dass Wellen nicht mit homosexuellen Inhalten in Verbindung gebracht wird. Der Versuch einer queeren Lektüre an diesem Roman ist also keineswegs kanonisch. Im Killy Literaturlexikon wird Wellen nur am Rande erwähnt, und zwar als ein Text, der, wie die meisten Texte des Autors, einen Ausbruchsversuch aus der adeligen Welt als zum Scheitern verurteilt darstellt.13 Kindlers Literatur Lexikon widmet sich dem Roman ausführlicher:
Während eines Sommeraufenthalts in einem Fischerdorf werden die Generalin Palikow, die Familie des Barons von Buttlär mit den Backfischen Nini und Lolo, Lolos Verlobter Leutnant Hilmar, der bucklige Geheimrat Knospelius und der bürgerliche Maler Hans Grill mit seiner adligen Frau, Gräfin Doralice, wie zufällig zusammengeführt. Dieses letztgenannte Paar erschüttert die konventionelle Starrheit des baltischen Adelsbewusstseins. Die kühle, sensible Schönheit Doralice hat dem „lebensvollen“ Bürgerlichen zuliebe ihre standesgemäße Verbindung mit dem in entleerten Manierismen erstarrenden Gesandten Köhne-Jasky aufgegeben. Zunächst als Femme fatale von den Standesgenossen geschnitten und dämonisiert, zwingt sie diese durch Menschlichkeit und Charme zu persönlichem Kontakt. Die Baronessen Lolo und Nini verehren in ihr schwärmerisch die emanzipatorische Selbstbestimmung ihrer eigenen Zukunft, Lolos Verlobter dagegen erkennt in ihr eine Gleichgestimmtheit in Leidenschaft und Sensibilität: „Man denkt nur eins, man will nur eins, so stark, daß man sich wundert, daß das Ziel einem nicht entgegenkommt.“ Er verliebt sich; die „kleine Familienkolombine“ Lolo versucht den Selbstmord.14
Auch dieser Inhaltsangabe ist keine Homoerotik zu entnehmen. Wir erfahren zwar, dass die jungen Baronessen Doralice verehren und dass die ältere von ihnen einen Selbstmordversuch unternimmt, der aber vermutlich der Abtrünnigkeit ihres Verlobten Leutnant Hilmar geschuldet ist. Dass homoerotisches Begehren in diesem Text, folgen wir allgemeinen oder auch literaturwissenschaftlich fundierten Zusammenfassungen und Inhaltsangaben, eine Rolle spielen könnte, wird nicht thematisiert, weil die meisten Lektüren den Regeln und Konventionen, die in unserer Gesellschaft gelten, folgen. Eine queere Lektüre vermag es, eine Bedeutungsebene herauszuarbeiten, die in gängigen Besprechungen ausgeblendet ist.
Im Roman, der im Jahr 2004 für das Fernsehen verfilmt (Regie: Vivian Naefe) und 2012 auch für das Theater adaptiert wurde, wird uns mit Doralice eine Frau gezeigt, die versucht, ihren Lebenshunger zu stillen und nun mit einem erfolglosen Maler in einem Kurort an der Ostsee gestrandet ist. Hans Grill wurde von dem um viele Jahre älteren Gatten Graf von Köhne-Jasky beauftragt, seine schöne, junge Gattin Doralice zu porträtieren. Es scheint, als hätte sie sich naiv und kopflos von dem stürmischen Mann zum Ehebruch hinreißen lassen. Aus diesem Grund fühlt sie sich sozial an ihn gebunden, leidet aber unter den Konsequenzen des voreiligen Ehebruchs. Obwohl 100 Jahre nach der Erstausgabe der Austritt aus einer Ehe keineswegs ein starkes moralisches Tabu mehr darstellt, erscheinen Doralices Seelenqualen auch für heutige Leser*innen durchaus nicht antiquiert. Die Leidensgeschichte der Gräfin legt nahe, dass es einzelnen Individuen nicht möglich ist, Konventionen zu sprengen. Freiheitverheißende Grenzüberschreitungen sind verhängnisvolle Chimären in Keyserlings Text. Was auf den ersten Blick wie eine Art Bruch mit Geschlechterkonventionen aussieht, hält sein Versprechen nicht. Die Konvention holt die Gräfin ein. Der Roman erzählt, wie sehr Doralice unter dem Ehrverlust, der der Preis ihres leidenschaftlichen Bekenntnisses zu Grill war, leidet. Aus Grills Perspektive erscheint sie ‚degeneriert‘, weil sie sich heimlich in ihr adliges Nest zurücksehnt. Sein Blick auf sie entspricht einem seit dem 18. Jahrhundert bestehenden, fortschrittsoptimistischen bürgerlichen Diskurs, wonach adlige Privilegien nur zu einer Lähmung und kulturellen Verkrümmung führen. Doralice wird dem Freigeist ihres neuen Mannes nicht gerecht und sehnt sich nach der Sicherheit ihres bisherigen Lebens zurück, was ein gängiger Topos von Ehebruchgeschichten bis in die literarische Gegenwart hinein und – wie im Killy zusammengefasst – ganz typisch für Keyserlings Werke ist. Das gesellschaftliche Außenseiterdasein ist ein zu schweres Los für eine sensible Frau wie Doralice. Sie ist schön, mysteriös, lebensfremd, verschlossen, fragil und blaublütig und verkörpert par exellence genau das Weiblichkeitsbild, das sie als Dame des Adels kennzeichnet. Sie changiert zwischen den Weiblichkeitsimagines der Femme fatale und Femme fragile. Aus Perspektive des Adels ist sie fatal, aus Perspektive des bürgerlichen Mannes fragil. Carola Hilmes argumentiert überzeugend, dass eine Frauenfigur wie Doralice mit den binär gesetzten Begriffen kaum zu fassen ist, weil die Grenzen zwischen Verführungspotential, das auf die Männer fatal wirkt, und fragiler Unschuld, die sich gegen Verführung behaupten muss, bei dieser Figur verschwimmen. Doralice ist eher dem mythischen Bild einer Wasserfrau entlehnt.
Deutlicher als Femme fragile und Femme fatale, die immer wieder mit realen Frauen aus Geschichte und Gegenwart verwechselt werden, entstammen die Wasserfrauen einer meist freundlichen, im Grunde heilen Märchenwelt, deren patriarchalische Grundstruktur ebenso unbestritten ist, wie das ausdrücklich Unrealistische. Ihr entlehnt Eduard von Keyserling diejenigen Frauenfiguren, die nicht ausschließlich der weißen Schlosswelt zugehörig sind bzw. nicht in ihr verbleiben. Die Bezüge zu den legendären Meerjungfrauen erscheinen mir im Falle von Mareile [Mareile ist die Hauptfigur aus dem 1903 erschienenen Roman Beate und Mareile, Anmerkung KK] ebenso klar wie im Falle der Romanheldin von Wellen, wo das dazugehörige Element, die Macht des Meeres und der Einfluss von Wasser, Wind und Wellen auf die weitere Handlung schon im Titel vorgegeben wird.15
Wasserfrauen sind Wesen, „die unter Umständen gefährlich werden können, von denen aber zuerst ein großes Glücksversprechen ausgeht.“16 In binärer Opposition ist Grill von herber Attraktivität, praktisch veranlagt, durchsichtig in seinen Handlungen und seinem Begehren, stark und eben. Er zeigt sich abgestoßen von dem adligen Habitus seiner Frau, was zu einer zunehmenden Entfremdung des Paares führt. Die unterschiedliche Sozialisation, die den Reiz dieser Liebe ausmachte, wird zur unüberwindlichen Grenze und zerstört die Harmonie des jungen Paares, das in dem Ostseebad für Aufsehen sorgt. Die Schönheit der „Wasserfrau“ Doralice und ihre Abtrünnigkeit ziehen die Aufmerksamkeit der Nachbarschaft auf sich. Im unmittelbaren Umkreis verbringt die Familie der verwitweten Patriarchin Gräfin Palikow ihren Sommeraufenthalt. Sie besteht aus ihrer uncharismatischen Tochter, der Baronin von Buttlär, deren untreuem Gatten, Baron von Buttlär, den Kindern Wedig, Nini und Lolo. Zugehörig zum Kreis sind noch die altjüngferliche Gesellschafterin der Gräfin, Fräulein Bork, Lolos Verlobter, Leutnant Hilmar, sowie der nicht zur buttlärischen Familie gehörige körperlich versehrte Geheimrat Knospelius. Doralice zieht sie alle magisch an. Das Glücksversprechen, das sie verheißt, ist scheinbar geschlechtsneutral. Die Abtrünnige wird durch die Aufmerksamkeit der adligen Gesellschaft, die jedoch von Baronin von Buttlär, die um die Integrität ihrer Familie fürchtet und von Eifersucht auf die schöne junge Frau geplagt ist, nicht gebilligt wird, mehr und mehr von der Sehnsucht nach Rückkehr in diese adlige Welt heimgesucht. Ihr ist bewusst, dass sie mit ihrer Sehnsucht nach den Menschen und Sitten ihres Geburtsstandes ihren Malergatten und die Idee einer konventionsüberschreitenden romantischen Liebe verletzt und dass eine Rückkehr in ihr altes Leben moralisch ausgeschlossen ist. Leutnant Hilmar, der wie der Baron von Buttlär und der Geheimrat für Doralice entflammt ist, macht ihr einen leidenschaftlichen Antrag, ihre Verbundenheit zu Grill aufzugeben und sich ihm anzuschließen, den Doralice, mehr gedankenlos als durchdacht, ablehnt. Wenn sie auch einmal die Konventionen, die für eine verheiratete Frau gelten, gebrochen hat, zeigt sich in ihrem gegenwärtigen Unwohlsein und ihrer erneuten Gefangenschaft, diesmal in der Beziehung zu Grill, dass es für sie keinen Ausbruch mehr geben soll. Fatalistisch hält sie an der Beziehung zu Grill fest.
Dieses Festhalten an der einmal getroffenen Entscheidung entspricht wiederum dem Topos von Ehebruchsgeschichten des 19. Jahrhunderts. Die Ehebrecherin möchte vor sich und der Gesellschaft, trotz ihres Konventionsbruchs, nicht als flatterhaft erscheinen. Im Grunde genommen entspricht Doralice dem passiven, domestizierten Typus des Weiblichen, denn im Rahmen der Romanhandlung weiß sie ihre sexuellen Wünsche, einer Dame von Stand angemessen, anders als die männlichen Figuren durchaus zu zügeln. Natürlich fühlt sie sich zu Hilmar hingezogen, mehr als zu dem Mann, für den sie ihr bisheriges Leben aufgab, aber weder hat sie im Sinn noch fühlt sie sich berechtigt, der jungen Freundin und Bewunderin Lolo den Verlobten auszuspannen. Dass sie Grill einst gefolgt ist, scheint weniger Ausdruck ihres eigenen primären Begehrens gewesen zu sein, sondern ihre Passivität und Unentschlossenheit lässt vermuten, dass sie einfach nicht in der Lage war, der vehementen Werbung des potenten jungen Mannes, eines Gegenbildes des greisen Ehemanns, standzuhalten. Sie fiel ihrer Unentschlossenheit und Schicksalsergebenheit zum Opfer und musste deshalb dem folgen, der am rücksichtslosesten um sie warb. Erst Grill hat sie im sexuellen Sinn zur Frau gemacht und als eine solche wird sie mehr begehrt als dass sie selbst Begehren zeigt. Den Fehler, sich ihrer eigenen Geschlechtlichkeit (als sexuelles Objekt) auszuliefern, will sie keineswegs wieder begehen. Hilmar wirkt nicht so stark auf sie, dass diese Gefahr droht. Wünschen und Sehnsüchten traut Doralice nicht. Sie braucht feste Strukturen, die ihr Halt geben. Haltlosigkeit wird in Wellen auch als typische Qual des Weiblichseins dargestellt. Doralices Sehnsucht nach einer strukturverheißenden männlichen Hand baut auf der Prämisse auf, dass Frauen weder einen eigenen Lebensplan noch ein authentisches Begehren aufweisen. Sie sind Fähnchen im Wind. Ihre Schönheit macht sie angreifbar, unfrei, und was und wen sie wirklich lieben, bleibt rätselhaft.
Diese mustergültige Entgegensetzung von ‚männlich‘ und ‚weiblich‘, die in einer Vorstellung von Heterosexualität kulminiert, die völlig phallozentrisch definiert ist, das heißt allein Männern die Fähigkeit zukommen lässt, aktiv zu begehren, zu werben und die begehrte Frau zu erobern, wird an einer Stelle allerdings nachhaltig gebrochen. Doralices Erotik, die in gewisser Weise selbstbezogen und ohne authentische Lüste ist, erregt eben nicht nur die männliche Aufmerksamkeit. Spiegelt ihr jedoch eine andere Frau zurück, wie begehrenswert sie ist, droht der schönen, widerstandslos in den Grenzen ihres Geschlechts gefangenen Doralice keine Gefahr. Im Gegenteil: Sie kann sich für einen Augenblick von den Grenzen, die die Konventionen ihr setzen, befreien. Lolo, die Tochter der Buttlärs, fühlt sich zu der schönen Frau ebenso leidenschaftlich hingezogen wie die Männer um sie herum. Dies ist zunächst nicht weiter bemerkenswert; es gehört zum Topos der strengen Geschlechtersegregation, dass junge, gerade gesellschaftlich debütierende Mädchen für bereits verheiratete Frauen schwärmen. In Anna Karenina wird daraus sogar ein Lehrsatz abgeleitet. Kitty, die Frau, die Wronski zugunsten Annas aufgibt, ist eine glühende Verehrerin von Annas Reizen, eine Verehrung, die ins Gegenteil umschlägt, als sie in Anna eine Nebenbuhlerin erkennt.
Anna war augenscheinlich entzückt von dem schönen jungen Mädchen, und ehe Kitty sich noch recht besinnen konnte, fühlte sie, dass sie nicht nur in Annas Bann geraten war, sondern sich auch in sie verliebt hatte, wie sich eben junge Mädchen in verheiratete Frauen, die etwas älter sind als sie, zu verlieben fähig sind.17
Auch die deutsche realistische Autorin Marie von Ebner-Eschenbach, die eher als moralinsauer gilt und wie Keyserling das Etikett ‚konservativ‘ trägt, hält das Modell der schwärmerischen Jugendliebe einer jungen Frau zu einer etwas älteren für einen Allgemeinplatz. In einem 1893 als Kleiner Roman veröffentlichten Text erzählt eine ehrenwerte, äußerst anerkannte Hofrätin von der Schwärmerei ihrer Jugendjahre, die sie als ein allgemein weibliches Phänomen ansieht:
Haben Sie nicht auch einmal in frühen Mädchenjahren einen Fanatismus der Liebe und Bewunderung für eine etwas ältere Frau in sich genährt, die Ihnen der Inbegriff aller Herrlichkeit schien? Es kommt oft vor in den Ausläufern der Backfischzeit. Einen solchen Götzendienst trieb ich im Stillen mit der Gräfin. Ich hätte mich auf die Folter spannen lassen, um ein freundliches Wort von ihr zu verdienen […].18
Die männerdominierte Gesellschaft hat kein Problem damit, wenn sich die noch nicht im Ehestand domestizierte jugendliche (A)Sexualität der Mädchen ‚Begehrensobjekte‘ innerhalb ihres eigenen homosozialen Raumes sucht. Das Patriarchat hat eine hohe Toleranzschwelle gegenüber dieser sich so harmlos ausnehmenden femininen Zärtlichkeit zueinander. Diese Allianzen, so erzählt es auch Effi Briest,19 brechen mit dem Eintritt der jungen Frauen in die Ehe. In gewisser Weise ist diese homosoziale Idealisierung der Mädchen untereinander sogar ein Vehikel der patriarchalischen Sexualmoral, um die Jungfräulichkeit der Mädchen zu bewahren, weil sie die Lüste der jungen Mädchen vom Einbruch des Männlichen reinhält. Wie von Lilian Faderman und Karin Lützen, auf die in der Einleitung referiert wird, dargestellt wurde, ist dieses Begehren völlig gefahrlos, solange Frauen als asexuell gelten. Was aber – ähnlich wie lesbische Pornographie, die allein für einen männlichen Konsumenten inszeniert wurde – als Stütze einer frauenfeindlichen Sexualmoral angesehen werden kann, hat doch das Potential der Brechung: Lolos Schwärmerei nämlich, die auf den ersten Blick für den Leser und die Leserin zu Beginn des 20. Jahrhunderts nichts Atypisches aufweist, ist nur scheinbar den gängigen Konventionen angepasst, in ihr scheint die Subversion der sexuellen Repression auf. Lolo hatte bereits das Vergnügen, die undurchsichtige, schlecht beleumundete Frau aus der Ferne zu beobachten, als sich beide, abseits von den anderen, beim Schwimmen auf einer Sandbank begegnen. Diese Begegnung sollten wir einem close reading unterziehen. Sie ist wie folgt beschrieben:
„Wer geht denn dort ins Meer?“ fragte Wedig und zeigte zum Strande hinab.
„Das“, sagte die Generalin, „muß die Köhne sein.“ […]
„Reizend“, bemerkte Fräulein Bork, „marineblau und einen kleinen gelben Dreimaster, und wie die schwimmt!“
„Sehr schick“, brummte Wedig. Das jedoch erregte aufs neue Frau von Buttlärs Aufregung. „Schweig“, herrschte sie ihren Sohn an, sie stand auf, schwenkte ihr Tuch, rief wieder „Lolo, Lolo! Aber sie schwimmen ja aufeinander zu, auf der Sandbank müssen sie sich ja treffen. Ach Gott, armes Kind!“
„Na setz dich, Bella“, beruhigte die Generalin ihre Tochter, „jetzt ist es nicht zu ändern. Sie wird Lolo auch nicht gleich anstecken.“
[…]
„Die Dame ist doch zuerst da“, rief Wedig triumphierend.
„Lolo scheint müde, sie schwimmt langsam“, bemerkte Fräulein Bork; „ah, ah, die Gräfin geht ihr entgegen, sie will ihr helfen.“
„Unerhört“, stöhnte Frau von Buttlär. „Jetzt reicht sie Lolo die Hand“, meldete Wedig, „ah, jetzt steht Lolo, die Dame legt ihr den Arm um die Taille, und Lolo stützt sich auf ihre Schulter.“
[…]
Lolo stand drüben auf der Sandbank, sie war bleich geworden und atmete schnell: „Oh, ich halte Sie schon“, sagte Doralice, „legen Sie den Arm auf meine Schulter, so wie man beim Tanzen den Arm auf die Schulter des Herrn legt – so. Es war doch ein wenig zu weit, Sie sind das nicht gewohnt.“
„Danke, gnädige Frau“, sagt Lolo und errötete, „jetzt ist mir besser, ich bin das Meer nicht gewohnt, und ich wollte dort immer im Blanken schwimmen, und das war ein wenig zu weit.“
[…]
Lolo antwortete nicht, sie dachte nur, würde sie doch noch sprechen. Nach der Anstrengung des Schwimmens kam ein köstliches Behagen über sie. Gern wollte sie lange noch so stehen in dem lauen Wasser, sich schwesterlich an diese schöne geheimnisvolle Frau lehnend, diese seltsam schimmernden Augen, diesen Mund mit den schmalen, zu roten Lippen ganz nahe haben. Doralice sprach jetzt von den gleichgültigen Dingen, von dem heißen Tage, und daß es am „Bullenkruge“ wenig Schatten gebe und vom Schwimmen, und Lolo hörte ihr zu wie etwas Erregendem, Verbotenem, dessen Schönheit sie, sie allein jetzt plötzlich erkannt hatte.
„Jetzt, denke ich, schwimmen wir“, schlug Doralice vor, und sie warfen sich in das Wasser, schwammen dicht nebeneinander, wandten zuweilen die Gesichter einander zu, um sich anzulächeln. „Geht es?“ rief Doralice. „Wir sind gleich da.“
„Oh, es geht, es geht schön“, antwortete Lolo.
Es war fast so bequem, als lägen sie beide auf einer grünen Atlascouchette und könnten sich unterhalten. Ja, das war es, sie wollte sich unterhalten. […]
„Gnädige Frau, ich sehe sie jeden Abend von meinem Fenster aus im Mondschein spazierengehen.“
„So“, erwiderte Doralice und legte sich auf die Seite, um Lolo ansehen zu können, ihr Gesicht war über und über mit flimmernden Tropfen übersät, „das ist dann wohl Ihr Fenster oben im Giebel, in dem ich jeden Abend Licht sehe?“
„Ja“, rief Lolo begeistert zurück. Es freute sie, daß Doralice zu ihr raufgeschaut hatte. Nun waren sie angekommen und gingen ans Ufer.
„Es ist hübsch“, meinte Doralice, „so zu zweien zu schwimmen“, und sie reichte Lolo die Hand. Lolo nahm diese kleine feuchte Hand, hielt sie einen Augenblick und führte sie dann schnell zu ihren Lippen. „Ich – ich danke Ihnen, gnädige Frau“, sagte sie leise.
„Nicht doch“, wehrte Doralice, beugte sich vor und küßte Lolo auf den Mund.20
Lolo (Kati Eyssen) und Doralice (Marie Bäumer) in der Romanverfilmung von Vivian Naefe (Regie), 2004. Foto: ZDF / Algimantas Babravicius.
Die Verfehlung wird durch den sorgenvollen Ausruf der Mutter schon vorweggenommen, bevor die beiden Frauen sich treffen. Die mütterliche Sorge: „sie müssen sich ja treffen. Ach Gott, armes Kind!“ erotisiert (oder dramatisiert zumindest) das Zusammentreffen der beiden Frauen, indem es diese Begegnung von vornherein tabuisiert und als eine Gefahr für die Jüngere dämonisiert. Der Ausstrahlung und Präsenz von Doralice wird eine sexuell aggressive Kraft zugesprochen, die zwar von der Großmutter abgeschwächt wird („Sie wird Lolo auch nicht gleich anstecken“), die sich aber bestätigt. Die Begegnung ist eben gerade nicht völlig asexuell. Doralice wird hier, wenn wir es geschlechtlich sehen wollen, zu einer männlichen, machtvollen Figur, der es gelingt, in Lolo (sowohl psychisch als auch physisch) zu dringen. Die Penetration, also die erotische Inbesitznahme, die Doralice an Lolo vollzieht, eingeleitet durch die männliche Rolle als Retter und Stütze im Akt des Andienens ihrer starken Schulter, ist noch in heterosexueller Symbolik gehalten. In einer heteronormativen Perspektive ist Begehren nur da erkennbar, wo ‚männlich‘ und ‚weiblich‘ als Gegensatzpaare aufeinandertreffen. Doralice nimmt in der Begegnung mit Lolo vorerst den männlichen Part wahr. So formuliert sie selbst: „legen Sie den Arm auf meine Schulter, so wie man beim Tanzen den Arm auf die Schulter des Herrn legt“. Sie erklärt sich mit dieser Aufforderung zu eben diesem verführenden Herrn. Zwei schöne junge Frauen spielen im Element des Wassers das Anbahnen einer heterosexuellen Beziehung nach. Sie entgleiten damit nicht nur dem mütterlichen Blick, sondern auch den ihnen zugestandenen Genderrollen. Für einen kurzen Moment schwimmen sie sich frei. Lolo, die errötet, sich dankbar erweist und durch die Anrede „gnädige Frau“ sich als die Schwächere und die Bewundernde stilisiert, präsentiert sich als weibliche Figur, die von Doralice ergriffen und erobert wird. Sie erkennt die männliche bzw. als männlich geltende Potenz ihres Gegenübers an, indem sie sich widerspruchslos führen lässt. In der strategischen Position eines „Herrn“ verführt Doralice Lolo allerdings auf unverkennbar weibliche Art. Während das männliche Geschlecht(steil) durch die Eindeutigkeit des Phallus im abendländischen Kulturkreis versinnbildlicht ist, wird das weibliche Geschlecht(steil) als diffuser und weniger eindeutig über die Lippen symbolisiert. In der binären Opposition zwischen Einheitlichkeit und diffuser, unfassbarer Geschlechtlichkeit gilt das männliche Geschlecht als dasjenige, das mit der Fähigkeit ausgestattet ist, vor- und einzudringen. Diese Logik wird durch die sich die männliche Rolle aneignende Doralice durchbrochen. Sie drückt Lolo ihre „zu roten“ Lippen in einem Kuss auf, der nicht nur eine erotische Konnotation trägt, sondern auch ein Symbol für den sexuellen Akt ist. Der Kuss wird dann demgemäß von der Mutter als unverzeihlicher moralischer Tabubruch gewertet. Der Mund bzw. die Lippen von Doralice bleiben von da an für Lolo unvergesslich. Als sie ihren Verlobten, der etwas später zu der Familie stößt, wiedersieht, schwärmt sie unverhohlen von der geheimnisvollen Frau.
Als sie an den Fischerhäusern vorübergingen, begann auch Lolo von Doralice zu sprechen […].
„Ach, die durchgebrannte kleine Gräfin ist hier“, sagte Hilmar, „nun, es ist gut, daß sie dich gerettet hat, aber sag, warum sprichst du von ihr mit einer so gerührten Stimme, als sei sie etwas Heiliges? Durchgebrannte Gräfinnen sind doch wohl nichts besonders Heiliges.“
„Weil sie mich rührt“, entgegnete Lolo erregt. „Ich weiß selbst nicht warum. Vielleicht weil sie so schön ist und doch nicht gut ist. Vielleicht aber, wenn jemand so schön ist, muß man ihn lieben, aber sie tut etwas weh, diese Liebe. Ich glaube, wenn einer sich in die Gräfin verliebt, dann muß es schmerzen.“
„Nun, nun“, beruhigte Hilmar sie, „wird es denn so arg sein mit dieser Schönheit?“
[…]
„Das ist sie“, flüsterte Lolo.
Ihnen entgegen kamen Hans und Doralice. Als sie aneinander vorübergingen, nickte Doralice lächelnd Lolo zu, die beiden Herren grüßten förmlich. „Nun?“, fragte Lolo, sobald sie vorüber waren.
„Gewiß, allerdings“, sagte Hilmar, „ein schönes Kindergesicht mit einem merkwürdig schicksalsvollen Munde.“
Lolo schwieg eine Weile, dann wiederholte sie sinnend: „Ein schicksalsvoller Mund, das hast du gut gesagt, ich suche schon lange einen Ausdruck für diesen Mund.“21
Das gemeinsame Schwimmen wird von Lolo auch als ein Beieinanderliegen „auf einer grünen Atlascouchette“ imaginiert. Mit diesem Beieinandersein wird nicht nur die im Roman erzählte Ausgeschlossenheit Doralices aus der Welt des Adels in Frage gestellt; vielmehr handelt es sich um den Bruch mit der geschlechtlichen Rolle, weil Doralice als bisher stets passiv Begehrte und Bewunderte durch das aktive Bezeugen der Gunst für ihre kleine Verehrerin ausschert. Dass sie, ähnlich wie Lolo, eine Femme fragile ist und eben auch nur über die zarte, wenig exotische Schönheit eines Kindes verfügt, wird durch den Mund, der als „schicksalsvoll“ bezeichnet wird, symbolisch unterlaufen. So wenig das Attribut „schicksalsvoll“, das man eher zur Charakterisierung von Lebensberichten als zur Darstellung von körperlichen Merkmalen verwenden würde, angemessen erscheint, so deutlich queert dieses Attribut die gängige Vorstellung einer adligen Schönheit. Das adlige, weibliche Leben ist nicht schicksalsvoll, ereignisreich oder verhängnisvoll, sondern klar geordnet. Frauen haben kein Schicksal, ihr Schicksal ist ihr Mann. Sie sind keine aktiven Wesen. Doralice jedoch bekommt ein besonderes Schicksal zugesprochen, das an ihre geschlechtliche Ausstrahlung und in gewisser Weise auch an ein sexualisiertes Attribut, den Mund, gebunden ist; dadurch gelingt eine Übertretung der gewöhnlichen weiblichen Rolle. Während der Phallus per se als erlebnishungrig und schicksalsvoll vorgestellt werden kann, ist er doch ein Organ der Aktivität. Lippen sind in binärer Entgegensetzung passiv und schicksalsergeben konnotiert. Man kann in sie dringen, wobei sie der Penetration bloß ausgesetzt sind. Nicht so Doralices Lippen. Trotz ihres Kindergesichts verfügt sie über einen als männlich angesehenen Eroberungswillen und die Fähigkeit der Inbesitznahme. Und auf diese Weise ist Lolo von Doralices schicksalhaftem Mund, der ihr so unvermittelt nahe war, besetzt und erobert. Da Doralice auf ein weibliches, sie anhimmelndes Gegenüber trifft, das sich auf die Tatkraft der heroischen Retterin angewiesen zeigt, nimmt sie als die Ältere nun die ‚männliche‘ und damit aktive Position an und erwidert Lolos schüchterne Avancen. Die Queerness, die homoerotische Merkwürdigkeit der oben beschriebenen Kussszene durchbricht für einen kurzen Moment die allein heterosexuell ausgerichtete Begehrensökonomie des Erzählten, indem sie zwei Frauen aufeinandertreffen lässt, die ihre Passivität, die auf sie als weibliche und dazu noch kindlich-fragile Figuren appliziert ist, aufgeben. Auch die harmlose Lolo wird plötzlich zur ‚Wasserfrau‘. Die Szene kann zwar auch so gelesen werden, dass sie Doralices unwidersprochener Attraktivität Deutlichkeit verleiht, doch es bleibt etwas, was in der Logik der Heteronormativität nicht einsichtig ist, dass sich nämlich zwei Frauen emphatisch aufeinander beziehen. Die eindeutig als ‚männlich‘ zu lesende, aktive Position, die Doralice in der Rettungsszene einnimmt, wird ihr kurz darauf durch Lolo entzogen. Vom Moment ihrer erotischen Erweckung durch Doralice an zeigt sich Lolo als die Werbende, indem sie zum Beispiel der Verehrten um Mitternacht rote Rosen in ihr Zimmer streut. Wollen wir die Opposition ‚männlich‘ und ‚weiblich‘ bemühen, ist Lolo nun der „Herr“, der seine Schulter anbietet. Doralice fällt in die weibliche Rolle der Umworbenen zurück und Lolo geriert sich als jugendlich stürmischer Galan.
Als sie zu Hause in ihr Wohnzimmer traten, fanden sie, daß Agnes die Lampe nicht angezündet hatte. Das Zimmer war voller Mondschein, und ein starker, sehr süßer Duft schlug ihnen entgegen. Auf dem hellbeschienenen Fußboden aber lag es wie eine dunkelrote Lache. „Sieh doch, Rosen, lauter Rosen“, rief Doralice. Sie kniete vor den Rosen nieder, beugte sich ganz auf sie hinab, griff nach ihnen, hatte beide Arme voll von ihnen, drückte ihr Gesicht in sie hinein, als wolle sie sich in ihnen baden. An einem der Sträuße hing ein Papierstreifen, auf dem „Lolo“ stand.22
Hans Grill fühlt sich von den Rosen, die mit ihrem prächtigen Stiel und ihrer roten Blüte phallisch konnotiert sind, bedroht: „Laß sie und ihre dicken Rosen, was sollen wir damit.“23 Selbst wenn wir die Rosen nicht als sexuelles Symbol lesen müssen, lässt die Reaktion Grills darauf schließen, dass er die Rosen einem potenten Nebenbuhler zuordnet und als Bedrohung wahrnimmt, obwohl er gesagt bekommt, dass „die kleine Lolo […] all die Rosen durch das Fenster geworfen [hat].“24 Die Prächtigkeit der Rosen symbolisiert eine verschwenderische Welt, in der Grill nicht mithalten kann. Sie verfehlen die positive Reaktion auf Seiten der Angebeteten auch nicht. In fast grotesker Weise versenkt sich Doralice in die Rosen und gibt sich ihnen bzw. den durch sie erweckten Gefühlen hin. Lolo ist in Doralice verliebt. Nach ihrer körperlichen Begegnung mit Doralice ist Lolo völlig von der schönen Frau ergriffen. Sie gesteht ihrer Schwester in der Nacht nach dem gemeinsamen Schwimmen mit Doralice:
„Ja, sie war herrlich, aber das wußte ich, und daß ich sie werde lieben müssen, daß wußte ich auch, aber ich wußte nicht, daß sie etwas an sich hat, das einen weinen machen könnte.“25
Wirklich unübersehbar wird jedoch Lolos Hingabe an Doralice erst, als sich Hilmar in Doralice verliebt und permanent die Nähe der aus dem Adelskreis ausgeschlossenen Frau sucht. Hilmar wirbt ganz geradeheraus um die Gunst der „durchgebrannten kleinen Gräfin“ und hofft, an die Stelle von Hans Grill treten zu dürfen. Er ist bereit, für seine Verliebtheit die Verlobung mit Lolo zu lösen, ein Vorhaben, das für Lolo durchaus offenkundig wird. Obwohl „alle so schlecht von ihr sprechen, […] alle so gegen sie sind“,26 wobei „alle“ die wohlerzogenen, unerotischen und von ihren Männern betrogenen Damen meint, die in der Erzählung allein von Lolos Mutter, Frau von Buttlär, repräsentiert werden, bleibt Lolo der Verehrten verbunden, obwohl sie die Ursache für die Distanz ist, die ihr Verlobter zu ihr aufbaut. Statt in Doralice eine Konkurrentin zu sehen, identifiziert sich die junge Frau mit dem (männlichen) Begehren ihres Verlobten. Als Hilmar sich von Gewissenbissen getrieben seiner jungen, als naiv eingestuften Braut erklären will, unterbricht sie ihn:
„Nein, du kannst nichts dafür, wir können beide nichts dafür. Es gibt manches in der Welt, das stärker ist als wir beide. Ich habe das jetzt verstanden. Oh, ich hab jetzt sehr viel verstanden. Früher glaubte ich, sich lieben ist Hand in Hand sitzen und sich lange Briefe schreiben. Aber jetzt weiß ich, sich lieben ist eine furchtbar große Sache […].“27
Statt wie ihre Mutter, deren Ehemann natürlich auch ein Auge auf die schöne Gräfin geworfen hat, Doralice mit Eifersucht zu begegnen und sie zu schmähen, richtet Lolo ihre eigene emotionale Energie auf Doralice. Das pubertierende Mädchen agiert, anders als sich aus der heteronormativen Logik des sich überall manifestierenden weiblichen Kampfes um männliche Aufmerksamkeit schließen ließe, nicht als Schmäherin der schönen Frau. (Kitty, der Gegenfigur von Anna Karenina in Tolstois Roman, gelingt dies beispielsweise nicht. Als der ihr Versprochene für Anna entbrennt, gibt die junge Frau ihre Schwärmerei für Anna auf und zieht sich enttäuscht zurück.) Der altbekannte Diskurs um weibliche Rivalität, der gemeinhin auch Frauenfreundschaften strukturiert, wird in Keyserlings Text nicht aufgenommen. Als Lolo beobachtet, wie Hilmar Doralice eine erneute Liebeserklärung macht – „Sie sah Doralice im Sessel sitzen und Hilmar neben ihr knien, allein das erschütterte sie nicht stark, sie hatte das erwartet, auch das mußte so sein“28 –, entschließt sie sich zu einer Art Liebesopfer. Sie sucht den Wassertod, um Hilmar für seine Liebe zu Doralice freizugeben. Statt aber mit irgendeinem Groll gegen Doralice diese Entscheidung zu treffen, erscheint es eher so, als möchte sie damit weniger einen Vergeltungsschlag gegen den abtrünnigen Verlobten üben als ein Opfer für die schöne Gräfin bringen. Mit ihrem Suizid sanktioniert sie Hilmars Beziehung zu Doralice und gestattet ihm die Liebe zu der schönen Frau, die keine Kompromisse kennt. Lolo wird jedoch bei ihrem nächtlichen Selbstmordversuch von Fischern des Ortes gerettet und in Doralices nahe am Meer liegendes Häuschen gebracht. Doralice, die zwar Hilmars Werben erkannt und sicher auch genossen hat, ist dennoch entsetzt von der Konsequenz, die Lolo daraus zieht, und sorgt sich aufrichtig um die Freundin. Sie stellt sie zur Rede:
„Wie – wie ist Ihnen jetzt?“ fragte Doralice.
„Gut“, sagte Lolo mit einer Stimme, als antworte sie auf eine müßige, gleichgültige Frage.
Aber Doralice beugte sich leidenschaftlich über sie, als wolle sie sie erwärmen und beschützen. „Wie konnten Sie das tun?“ flüsterte sie.
Lolo zog ein wenig die Augenbrauen empor und sagte in demselben kühlen, überlegenen Tone: „Er kann nichts dafür. Das wußte ich, als ich Sie sah, er wird nicht anders können, und Sie – Sie können nichts dafür, daß Sie so schön sind.“29
Für Lolos Familie, vornehmlich die bodenständige Großmutter, sieht es so aus, als wäre Lolo aus Eifersucht ins Wasser gegangen. Die bekannten Diskurse um eine sich völlig vom Mann abhängig zeigende Frau, die der Schmähung wegen den Liebestod anstrebt, beanspruchen ihre Geltung. Dieser Deutung, wir bemerkten es in Kindlers Zusammenfassung, schließt sich die Literaturwissenschaft und -kritik an. Allerdings legt der Text auch eine andere Deutung nahe als die, den ersehnten Wassertod als einen Suizid aus Liebesschmerz einer von ihrem Verlobten verschmähten jungen Frau zu verstehen. Ist Lolos Liebesschmerz tatsächlich auf Hilmar gerichtet oder ist er nicht viel mehrdeutiger? Die intime Verbindung, die sich in der vertrauten Rede der beiden Rivalinnen kundtut und die allerdings nur in einer weniger kurzsichtigen Perspektive aufscheint als der, welche das weiblich-weibliche Begehren ausblendet, verdeutlicht, dass es Lolo bei ihrem Selbstmordversuch nicht um Hilmar geht. Doralice weiß sofort, dass dieser Liebestod ihr gegolten hätte. Wir haben es hier mit einer Begehrensbeziehung zwischen Frauen zu tun, und obwohl Lolo keineswegs so stürmisch und offen heraus um Doralice werben kann wie ein Mann, besticht ihr Gefühl für die erwachsene, schöne Frau durch emotionale Treue. Der schwermütige Akt des Suizidversuchs resultiert nicht aus der Zurückweisung durch Hilmar, sondern aus der Zärtlichkeit für Doralice, die unverkennbar, weil in der sozialen Realisation undenkbar, durch Melancholie gekennzeichnet ist. Um diese Bedeutungsebene jedoch herauszufiltern, bedarf es jenes queeren Blickes, der das eindeutig Scheinende gegen den heteronormativen Strich bürstet. Der queere Blick filtert nicht etwa etwas heraus, was sich hinter dem Offensichtlichen verbirgt, nein, der queere Blick lässt eine Sichtweise zu, die den Text ebenso plausibel dechiffriert, weil er das im Text erscheinende Begehren nicht nur als heterosexuell kodiert voraussetzt.
Wie aber gelang es in bisherigen Interpretationen des Textes, diese naheliegende Lesart nicht zu entfalten? Lolos innige Hingabe an Doralice und ihre romantische Schwärmerei, die sich in ihrer Melancholie und Unerfüllbarkeit zu all den anderen erotischen Verwicklungen fügt, in die die Menschen um Doralice geraten, ist dadurch charakterisiert, dass es sich keineswegs um etwas immens Herausstechendes, den Plot Störendes handelt – deswegen wird der Text auch nicht als homoerotischer eingestuft –, sondern die weibliche Schwärmerei für Doralice ist etwas, das der Erzähllogik nach nur die erotische Kraft der von vielen Seiten Angebeteten herausstellt. Wie bereits betont ist das weiblich-weibliche Schwärmen in der homosozial organisierten Welt – als Paradebeispiel dafür gelten die Mädchenpensionate des 19. Jahrhunderts – keineswegs ungewöhnlich und passt zu einem Jahrhundertwenderoman, da adoleszente Mädchen wie Lolo und altjüngferliche Frauen wie Fräulein Bork, die auch für Doralice schwärmt, abgeschnitten von Männern leben und sich vorerst nur in homosozialen Kontexten verlieben können. Als der Roman jedoch entstand, gab es das Konzept der Homosexualität schon und wir können davon ausgehen, dass Keyserling den Diskurs kannte. Der Text, der eine Zuneigung zeigt, die über ‚Schwärmerei‘ hinausgeht, verweigert sich dennoch strikt dem Homosexualitätsdiskurs, denn seine Frauenfiguren sind nach Maßgabe der damals herrschenden medizinischen Vorstellung über Frauenliebe nicht homosexuell, obwohl offensichtlich ist, dass Lolo Doralice leidenschaftlich liebt und dass Doralice diese Liebe als angenehm empfindet. Wenn wir das, was Lolo empfindet, zur ‚Schwärmerei‘ erklären, kann dies als Stärkung der heteronormativen Ordnung verstanden werden, und zwar dann, wenn Doralice als eine Art Vorbild für Lolo aufgefasst wird, dem die Jüngere nachzueifern versucht. Genauso wird es in einem Standardwerk der Literaturwissenschaft gedeutet. Wir erinnern uns: „Die Baronessen Lolo und Nini verehren in ihr schwärmerisch die emanzipatorische Selbstbestimmung ihrer eigenen Zukunft […].“30 Ja mehr noch, es entspricht der gängigen patriarchalen Logik, jenes das Männliche substituierende Entflammt-Sein einer jüngeren Frau für eine etwas ältere nur als eine Verstellung und Einübung in ein später eintretendes ‚wirkliches‘ heterosexuelles Liebesverhältnis geltend zu machen, so als nähmen die beiden adoleszenten Frauen in ihrer Schwärmerei ihre heterosexuelle Zukunft (bzw. Erfolgsgeschichte, in der Doralice zum role model wird) vorweg. Diese das lesbische Potential negierende Deutung ist aber mitnichten schlagkräftig, da Lolo ja bereits verlobt ist, also debütiert und somit den rein homosozialen Raum schon verlassen hat. Männer und deren Küsse sind ihr nicht mehr fremd, die Schwärmerei für eine Frau ist hier nicht Substituent für die ‚wirkliche‘, noch ausstehende heterosexuelle Liebe.
Lolos romantisches Verlangen nach der schönen Frau ist also keine Ersatzhandlung, denn es gibt ja schon einen Hilmar in ihrem Leben. Ihre Liebe ist auch nicht rein seelisch, es ist der Körper, der Mund Doralices, der Lolo anzieht. Die Deutung, dass es sich um eine Identifikation mit der Geliebten seitens des Mädchens handelt, wirkt etwas plausibler; Identifikation mit dem weiblichen Gegenüber gilt als ein Indikator des weiblich-weiblichen Begehrens. Nicht zuletzt wollte der lesbische Feminismus die Frauenliebe unter der Prämisse einer gegenseitigen Identifikation als Ausgestoßene aus dem Machtfeld des Patriarchats geltend machen. Allerdings konnte ja gezeigt werden, dass Lolo in ihren Gefühlen für Doralice sich weit mehr mit Hilmars sexuellen Wünschen identifiziert, als dass von einer Identifikation mit der zwar begehrten, aber doch als fremd und geheimnisvoll empfundenen Frau die Rede sein könne. Doralice, als die gesellschaftlich Ausgestoßene, stellt zwar eine interessante Reibungsfläche für das jungfräuliche, behütete Mädchen dar, bietet ihr aber wenig Spielraum für eine Identifikation. Selbst wenn die Schwärmerei Lolos nur als Ausdruck von Überspanntheit, ohne schweres Gewicht, gelesen werden sollte, ist ihr queeres Potential nicht abzusprechen, da es nicht nur die rein heterosexuelle Begehrensökonomie des Textes stört, sondern schrittgleich damit die Frauen aus den Fesseln einer rein passiven Rolle enthebt. Sowohl Doralice, die zwischen der Imagination einer begehrenswerten Femme fatale und einer sexuell bedrängten Femme fragile changiert, als auch Lolo, die noch jungfräuliche Femme fragile, werden in ihren Männerbeziehungen durch den männlichen Blick zu zerbrechlichen Objekten stilisiert sowie degradiert. Dabei sind sie keineswegs nur zart, sondern, folgen wir Carola Hilmes, Figurationen von Wasserfrauen, die auch dämonisch sein und die ihrer Definition gemäß von Männern nicht glücklich gemacht werden können. Die Frauen selbst werden im heterosexuellen Kontext als begehrenslos figuriert. Sie können Begehren beim Mann wecken, jedoch nicht in gleicher Weise für ihn empfinden. Das trifft auch auf Doralice zu, von der wir ahnen, dass ihr Ehebruch nicht Folge von Begehren, sondern von Langeweile und Wehrlosigkeit war. Die Frauen ‚geben sich hin‘ und ‚werden besessen‘, ‚der Mann nimmt sie‘ und ‚besitzt sie‘. In den weiblich-weiblichen Begehrensbeziehungen heben sich diese strikten Rollenzuweisungen auf, indem jede der beiden Frauen sowohl als aktiv werbend als auch als umworben verstanden werden kann. Schien anfänglich Doralice mit ihrem ungehörigen Kuss, der als Symbol der Eroberung des weiblichen Gegenübers, ja vielleicht sogar als ein Penetrationssymbol gelesen werden kann, die Fordernde zu sein, entwickelt kurz darauf Lolo Strategien, ihre Leidenschaft für Doralice, zum Beispiel durch die „dicken Rosen“, mitzuteilen.
Letztendlich weisen beide Frauen die ihnen zugedachten Männer zurück. Lolo weist Hilmar zurück, dem sie sich durch Suizid entziehen will, und Doralice weist ihn verbal zurück, indem sie seinen Antrag ausschlägt. Aber auch Hans Grill, der zum Ende der Romanhandlung verunglückt, vermag seine Rolle als Doralices junger Gatte schon lange nicht mehr erfolgreich auszufüllen. Während ihr ehemaliger greiser Ehemann, der ihr sogar die Rückkehr in die standesgemäße Beziehung angeboten hat, durch sein Alter weiterhin für Doralice unattraktiv bleibt, zeigt sich Hans Grill durch sein geschlechtliches Wesen, sein teilweise herrisches Gehabe, als nicht kompatibel mit Doralices Sehnsüchten. Diese werden sich auch nicht mit Hilmar oder gar mit dem verkrüppelten Geheimrat, der ihr ebenfalls seine Liebe gesteht, erfüllen. Der draufgängerische, promiskuitiv lebende Vater Lolos, der Doralice desgleichen zu verführen trachtet, ist Doralice nur widerlich und kommt als Liebhaber für sie überhaupt nicht in Frage. Doralice bleibt allein zurück, gefühlsmäßig isoliert. Dass das Eheleben von Lolo nur die Unerfülltheit der Mutter, die permanent von ihrem Mann betrogen wird, nachzubilden droht, wird schon dadurch deutlich, dass sich ihr zukünftiger Ehemann nicht einmal in der Verlobungszeit den erotischen Verlockungen einer anderen Frau entziehen konnte. Lolos Ehe wird in psychischer Isolation mit dem immer als fremd, aber stark empfundenen Mann enden. Frauen wie Doralice fühlen sich zunehmend durch das Begehren der Männer gedemütigt, nicht beglückt. „Menschenmänner“ enttäuschen naturgemäß die Meerjungfrau, weil sie ihr nicht gewachsen sind.31
Lolo (Kati Eyssen, von hinten) bedankt sich bei der von ihr bewunderten Gräfin Doralice (Marie Bäumer) für ihre „Rettung“. Foto: ZDF / Algimantas Babravicius.
Lolos Schwärmerei aber belebt Doralice. Die Frauen schenken sich für einen Augenblick den Austritt aus einer Ordnung, die nicht zu ihren Gunsten eingerichtet ist. Lolo entgeht mit ihrer Hingabe an Doralice für einen kurzen Augenblick dem abgedroschenen, demütigenden Schicksal einer passiven Ehefrau, das Hilmar für sie bereithält. Wellen, in dem so mustergültig die männliche und die weibliche Welt, die männlichen und die weiblichen Rollenerwartungen und die männlichen und die weiblichen Sehnsüchte entgegengesetzt werden, wirkt zwar durchaus heteronormativ, da der Roman scheinbar nur von heterosexuellen Beziehungen erzählt, aber indem er sie erzählt, spricht er gleichzeitig von dem Scheitern eben dieser Beziehungen in emotionaler Hinsicht und der verkannten Liebe zweier Frauen. Mit Lolos Schwärmerei für Doralice unterwandert er das Gebot, dass eine augenfällige sexuelle Attraktion ausschließlich vom anderen Geschlecht auszugehen habe. Die Unterwanderung dieses Gebots, welches sichtbar durch den ungehörigen Kuss verletzt wurde, ist milde, sie kann überlesen werden, aber sie ist Teil der „hetero-narrativen“ Struktur des literarischen Textes, der heterosexuelle Beziehungen (und deren Scheitern) um 1900 zur Sprache bringt. Welches Antlitz auch immer das körperliche Begehren einer Frau um 1900 zu haben hätte, ohne die seelische Verbundenheit, die sich zwischen Doralice und Lolo zeigt, ist es nicht denkbar und in diesem Sinn ist dieses Begehren innerhalb der heteronormativ ausgerichteten Struktur des Textes auch die einzige Leidenschaft, die nicht in die strenge Ökonomie weiblicher Sexualverleugnung gepresst ist. Keyserlings Werk ist berühmt dafür, über den adligen Kosmos ein „Gefühl des Zu-Ende-Gehens“32 zu legen. Insofern vermittelt der Text auch das Gefühl, dass die Frauen ihre Rolle als Objekte für Männer bald abzulegen trachten. Die weiblich-weibliche Erotik ist der einzig mögliche Austritt aus einer für Frauen völlig repressiv angelegten Sexualkultur und gleichzeitig die Bedingung für die Beständigkeit dieser Repression ihrer eigenen sexuellen Wünsche. Es steht in dieser Welt fest, dass Frauen keine allzu romantischen Wünsche auf ihren Mann projizieren sollen, der zu anderen Aufgaben berufen ist als der, seine Frau zu beglücken.
Doralices und Lolos gegenseitige Geneigtheit ist die différance im Text, das Moment der Verschiebung und Bedeutungsstiftung. ‚Différance‘ ist ein Begriff aus der Dekonstruktion, also der poststrukturalistischen Literaturwissenschaft, durch die Queer Studies inspiriert sind. Er stammt von Jacques Derrida und besagt, dass Bedeutung nie als etwas Festes gegeben ist, sondern sich der Sinn permanent verschiebt. Sinnverschiebungen sind keine Unfälle, sie stützen und realisieren den Text erst. Die Wortschöpfung ist nicht gleichbedeutend wie der bereits für den Strukturalismus sinnstiftenden Begriff ‚Differenz,‘ obwohl er in ihr anklingt, da sich im Französischen beide Begriffe nur in der Schrift unterscheiden. „Das Wort ist eine glückliche Wendung Derridas: unhörbar, wird die Differenz zwischen ‚différance‘ und ‚différence‘ nur schriftlich markiert“.33 Ist die heterosexuelle Liebesgeschichte und das Scheitern oder Zu-Ende-Gehen der heterosexuellen Beziehungen der deutlich vernehmbare ‚Sinn‘ von Wellen, dann kann die beginnende, wenn auch nicht in eine Paarbeziehung mündende homoerotische Verbindung tatsächlich als ‚différance‘ benannt werden. Sie entsteht in Differenz (différence) zu den homosexuellen Beziehungen, ist aber auch in diesen Beziehungen enthalten, weil Lolo sich mit ihrem Verlobten gerade aufgrund ihrer eigenen Gefühle für Doralice identifizieren kann. Grills Ansprüche auf Doralice wiederum aktualisieren sich durch Lolos rote Rosen. Die heterosexuellen Beziehungen werden durch die homoerotische Beziehung belebt, herausgefordert, zum Scheitern verurteilt. Die queere Analyse kann auch ohne die Referenz auf dieses Zauberwort der Dekonstruktion vorgenommen werden, es erweist sich für die homoerotische Bedeutungsebene jedoch als treffende Bezeichnung. Die différance erst verleiht dem Roman die erotisierende Sinnebene und spricht für Doralices große Anziehungskraft. Indem dieser Jahrhundertwenderoman davon spricht, wie und warum die Männer ihr, der verfemten Gräfin, verfallen, erzählt er (eben auch) eine Geschichte der Begierde, die sich dem Männlichen völlig entzieht.