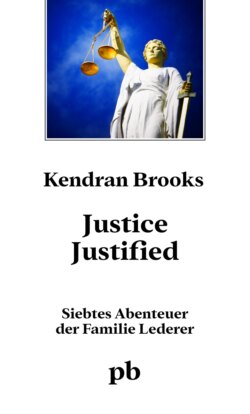Читать книгу Justice justified - Kendran Brooks - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Urlaub mit Hindernissen
ОглавлениеWie ein Wirbelwind rannte das kleine Mädchen im Pyjama aus ihrem Schlafzimmer und durch den Flur im Obergeschoss zur breiten Marmortreppe, stapfte die Stufen eiligst hinunter, beinahe zu schnell für die kurzen Beine, glitt mit ihren Pantöffelchen auch prompt aus, stolperte und drohte zu stürzen, fing sich jedoch geschickt am Geländer ab, hetzte weiter ins Erdgeschoss. Dort fegte sie durch die Vorhalle und hinein in die Küche, erblickte dort endlich ihre Mutter und rief mit breit lachendem Gesicht: »Fahren wir heute endlich los?«
Alabima drehte sich lächelnd zur ihrer Tochter um.
»Ja, heute geht’s los, Alina. Aber zuerst müssen wir noch packen.«
»Ich hab schon alles raus und aufs Bett gelegt. Alles was ich brauche«, meinte die Kleine stolz, »du musst es nur noch im Koffer verstauen.«
Es würde für viele Jahre wohl das letzte Mal sein, dass die gesamte Familie Lederer einfach so und unterm Jahr in den Urlaub fliegen konnte. Denn Alina wurde im kommenden Sommer eingeschult und von da an gab es außerhalb der ordentlichen Ferienwochen kaum mehr Freiräume. Die Lederers hatten sich für eine öffentliche Schule entschieden, damit ihre Tochter so frei und so natürlich wie nur möglich aufwachsen durfte.
Es war Anfang Mai und die Eisheiligen standen noch vor der Tür. Die Frühlingssonne wärmte jedoch schon kräftig und alles grünte und blühte am Lac Léman, in La Tour-de-Peilz, wo die Familie seit Jahren in ihrer Villa am See lebte.
Jules Lederer, Sohn eines Schweizer Diplomaten und der Tochter einer Zürcher Industriefamilie, hatte sein Vermögen selbst verdient, war viele Jahre lang als Problemlöser für private Auftraggeber und Weltkonzerne tätig gewesen. Doch was mochte man sich unter einem Problemlöser vorstellen? Und warum konnte sich der Schweizer damit ein Vermögen verdienen? Er hatte Wirtschaftswissenschaften an der HSG studiert, wurde nach seinem erfolgreichen Abschluss von einer weltweit tätigen Anwaltskanzlei in Zürich angestellt. Zuerst betreute er die wohlhabende Klientel in verschiedenen Steuer- und Rechtsfragen. Später kamen handfestere Aufträge hinzu. Jules bewährte sich auch darin, nicht zuletzt aufgrund seiner über viele Jahre hinweg gepflegten Leidenschaft für asiatische Kampfsportarten.
Nach ein paar Jahren wurden ihm der administrative Rahmen der Kanzlei zu eng und er machte sich selbstständig. Die meisten seiner Klienten blieben ihm treu, neue kamen hinzu. Und so reiste Jules viele Jahre in der Welt herum, löste die Probleme anderer, verdiente sich damit eine goldene Nase. Jules hatte auch einen ausgeprägten Hang zu Geheimnissen entwickelt, spürte ihnen nach, wo immer er auf sie stieß, fand manche lange Zeit verborgene Sünde hochrangiger Persönlichkeiten heraus, ließ sich sein Schweigen manchmal ohne Skrupel bezahlen, brachte die Wahrheit in anderen Fällen an die Öffentlichkeit.
Vor sechs Jahren hatte er bei einem seiner Aufträge Alabima kennengelernt. Seitdem waren sie ein Paar, hatten nach einem Jahr ihre Tochter Alina bekommen. Alabima war Äthiopierin aus dem Stamm der Oromo und damit Christin wie Jules. Sie hatte in Addis Abeba Kommunikationswissenschaften studiert und später als Radio-Moderatorin gearbeitet. Doch die Lederers waren nicht zu dritt, sondern eine vierköpfige Familie, denn neben Jules, Alabima und Alina gab es auch noch Chufu. Der Philippine war Waisenjunge, wurde von seiner Mutter gleich nach der Geburt anonym abgegeben. Mit vierzehn Jahren verdingte sich Chufu auf einem Öltanker als Küchenjunge, wo Jules ihn kennenlernte. Alabima und er adoptierten den Jungen, ließen ihn die verpasste Schulbildung nachholen. Chufu lebte seit gut zwei Jahren in Rio de Janeiro, studierte Psychologie an der Universidade Federal, genauso wie seine Freundin Mei Ling. Sie war chinesischer Abstammung, jedoch in Brasilien geboren und aufgewachsen. Ihre Familie betrieb seit Jahrzehnten eine erfolgreiche Kette von China-Restaurants, war zu einem ansehnlichen Vermögen gelangt.
Die wilden Zeiten waren für Jules allerdings Geschichte. Nachdem einer seiner letzten Aufträge die gesamte Familie in höchste Gefahr gebracht hatte, musste er Alabima versprechen, keine Problemfälle mehr für andere zu lösen. Doch das Leben als Frührentner bekam dem Schweizer schlecht. Vielleicht lag es aber auch bloß am Alter, denn er ging immerhin auf die Fünfzig zu und seine Midlifecrisis war eigentlich überfällig.
Jules trat aus seinem Büro auf den Flur im Erdgeschoss, ging durch die Halle hinüber zur Küche.
»Na, ihr beiden?«, begrüßte er Alabima und Alina, fasste die Kleine unter den Armen, hob sie hoch, was diese überhaupt nicht schätzte und dies mit heftigem Zappeln auch ausdrückte.
»Lass mich runter, Papa«, forderte sie Jules unmissverständlich auf, »ich muss noch einmal hoch in mein Zimmer. Ich hab noch etwas vergessen. Für Amerika.«
Jules drückte ihr einen Kuss auf die Wange und ließ sie auf den Boden hinunter. Die Kleine rannte auch gleich los, aus der Tür und die Treppe hoch.
»In fünf Minuten gibt’s Frühstück, Liebling«, rief ihr Alabima mahnend hinterher.
»Oui, oui«, kam von oben eine Antwort außer Atem zurück.
»Alles okay?«, fragte Alabima mit einer Spur von Sorge in ihrer Stimme.
»Ja, ja«, beschwichtigte Jules, »Chufu und Mei haben doch noch Sitzplätze bekommen, müssen allerdings über Mexiko City fliegen. Doch sie können uns wie vereinbart Übermorgen in Dallas treffen.«
»Und sonst?«
Die Äthiopierin blickte ihrem Ehemann forschend ins Gesicht.
»Nein, alles okay«, wehrte er etwas allzu rasch ab.
»Hast du heute noch einen Termin bei Dr. Grey?«
Jules nickte, wirkte ein wenig angespannt.
»Ja, um zehn. Bis zwölf bin ich sicher zurück.«
»Espresso?«
Wieder nickte er, diesmal stumm.
Sie stellte die gewärmte Tasse unter den Ausguss der Kaffeemaschine, drückte die entsprechende Taste des Vollautomaten. Während das Mahlwerk die Bohnen zerkleinerte und die Pumpe anschließend das heiße Wasser durch das Pulver presste, goss Alabima Milch aus den Tetra-Pack in einen Topf, tat einen Wächter hinein, stellte die Pfanne auf das eingeschaltete Kochfeld, holte einen Suppenteller heraus, goss aus dem großen Glasbehälter ein Häufchen Haferflocken hinein, zog eine tiefe Schublade im Schrank auf, holte von dort die Büchse mit dem Schokoladenpulver hervor, zog den Deckel ab, nahm den Messlöffel heraus und schaufelte eine knappe Portion über den Flockenhaufen.
Jules nahm sich den fertigen Espresso vom Abtropfbrett der Maschine, nippte kurz daran, betrachtete sich Alabimas Hinterkopf, ihr schulterlanges, schwarzes, geglättetes Haar, das sie heute Morgen als Pferdeschwanz trug, blickte auf ihren schmalen Hals, auf den weichen Übergang zu ihrem Nacken, auf ihre makellose Haut. Sie war immer noch eine Schönheit, trotz ihrer Mitte-Dreißig. Jules trat hinter sie, umfasste ihren Oberkörper mit dem freien Arm, presste seine Wange über ihre Schulter hinweg an ihren Kopf.
»Ich liebe dich«, flüsterte er ihr ins Ohr, »oh Gott, wie ich dich liebe.«
Alabima drehte sich in seiner Umarmung um, schenkte ihm ein strahlendes Lächeln.
»Das will ich auch hoffen, Mister Lederer. Immerhin möchte ich noch viele glückliche Jahre mit dir verbringen.«
Sie küssten sich weich und warm, ließen zwischen den leicht geöffneten Lippen nur ihre Zungenspitzen kreisen, langsam und schmeichelnd, warm und liebkosend. Als sie sich lösten, waren sie beide etwas außer Atem geraten, blickten einander dafür umso glücklicher an.
Der Milchwächter meldete sich klappernd und Alabima fuhr herum, hob den Topf rasch von der Herdplatte, leerte die Milch über den Flocken aus, griff sich einen Dessertlöffel aus der Schublade, denn die Suppenlöffel waren für Alina noch zu groß, rührte kurz im Teller um, nahm ihn mit beiden Händen auf und stellte ihn auf den Esstisch, legte den Löffel schräg auf seinen Rand.
»Petit déjeuner est prêt«, rief sie so laut in Richtung der Küchentüre, dass es ihre Tochter in der oberen Etage hören musste.
Jules setzte sich mit seinem Espresso an den Tisch, während sich Alabima einen Milchkaffee aus der Maschine ließ und sich dann ebenfalls setzte. Der kleine Wirbelwind stürzte herein, hopste auf den Stuhl mit dem Teller davor, griff sich den Löffel und schaufelte sich etwas vom heißen Haferbrei darauf, pustete so stark darüber, dass sich zwei Flocken lösten und im Bogen auf die Tischplatte fielen, stopfte sich den Rest in den Mund und begann genüsslich zu kauen. Ihre Eltern saßen daneben, schauten ihr stumm zu, hingen ihren Gedanken nach.
»Was ist?«, fragte Alina zwischen zwei Löffeln, blickte misstrauisch erst in das Gesicht der Mutter, dann zum Gesicht des Vaters schräg neben ihr hoch.
»Nichts«, beeilte sich Alabima klar zu stellen, »wir sind bloß glücklich.«
Die Kleine kräuselte ihre Stirn.
»Glücklich?«, fragte sie, ernsthaft darüber nachdenkend, »weil wir nach Amerika fliegen?«
»Ja, auch deshalb. Aber vor allem, weil es dich gibt.«
Alina gab sich mit dieser Antwort zufrieden, widmete sich wieder ganz dem Frühstück. Als der Teller leer gegessen war, stand Jules zusammen mit ihr vom Tisch auf. Während die Kleine wieder nach oben eilte, ging er zurück in seinen Büroraum. Alabima räumte ab, stellte das gebrauchte Geschirr in die Spülmaschine, wischte mit einem feuchten Lappen über den Tisch, wusch ihn unter dem Wasserstrahl des Spülbeckens aus, wrang ihn mit beiden Händen aus und legte ihn über den Hahn.
Die Äthiopierin war froh über Dr. Grey, über die Psychologin, die ihre Praxis in Lausanne betrieb und mit der sich Jules seit ein paar Monaten regelmäßig zu Therapiesitzungen traf. Denn weiterhin schlief der Schweizer schlecht, wachte oft mitten in der Nacht und schweißgebadet auf, konnte kaum mehr einschlafen, war über Tag oft müde, geistesabwesend und mürrisch, wälzte in seinem Gehirn böse Erinnerungen, kam mit ihnen zu keinem Ende, stand nach Ansicht von Alabima kurz vor einer schweren Depression. Der gemeinsame Familienurlaub in den USA sollte ihren Ehemann auf andere Gedanken bringen, ja, neuen Lebenswillen und Kraft in ihn hauchen. Dr. Grey hatte ihnen diesen Rat vor gut zehn Tagen erteilt. Der Ausbruch aus dem täglichen Einerlei sollte für sie alle zu einem Neubeginn werden. Für mindestens vier Wochen wollten sie den Südwesten der USA bereisen, die Schönheiten von Texas, New Mexiko und Arizona genießen und die Seele baumeln lassen.
Dass sich Chufu und Mei für zwei oder drei Wochen eine Auszeit vom Studium gönnten und sie begleiten wollten, machte das Glück für Alabima vollkommen. Denn seit der Philippine in Brasilien lebte und sie ihn darum nur noch selten sahen, fehlte vor allem Jules die endlosen Debatten mit seinem Sohn, die kindischen Reibereien, ihr Foppen und das gegenseitige Hänseln. Früher hatte Alabima öfters Mal von ihren beiden Jungs gesprochen und damit Ehemann und Adoptivsohn gemeint, die sich wieder einmal unnötig und spielerisch fetzten. Ja, die gemeinsamen Wochen würden Jules auch in dieser Hinsicht bestimmt guttun.
Nach dem Aufräumen der Küche wollte sich die Äthiopierin ans Packen der Koffer machen. Gegen zwei Uhr würde das bestellte Taxi sie abholen und zum Flughafen nach Genf bringen. Ihre Maschine flog um vier Uhr nachmittags nach London Heathrow, wo sie übernachten wollten, um am nächsten Tag den um zwei Stunden Flugzeit abgekürzten Sprung über den großen Teich zu wagen.
*
Patrick McPhearsen lebte seit zwei Jahren auf seinem Hausboot an der Themse, wie er sein Schiff nannte. Denn der umgebaute Getreidefrachter mit seinen 1500 Bruttoregistertonnen bot mehrere hundert Quadratmeter Luxus pur. Sein Rumpf wies große, verspiegelte Fenster auf, durch die niemand hineinblicken konnte. Hätte es doch einer geschafft, so würde er von einem riesigen Wohnzimmer mit Marmorböden und neckischen Säulen, einem riesigen, runden Bett mit einer Tagesdecke aus Hermelin und einem prunkvollen Badezimmer mit goldenen Hähnen berichtet haben.
Der Vater von Patrick McPhearsen, Rupert Evangile, war der einzige Bruder von Ollie Oldman McPhearsen gewesen, doch schon seit über zehn Jahren tot, offiziell aufgrund eines Herzinfarkts. Rupert Evangile McPhearsen hatte zeitlebens für seinen älteren Bruder gearbeitet, trat nie aus dessen Schatten, übernahm jedoch nicht selten die Drecksarbeit beim Aufbau des weltweit operierenden Familien-Konzerns.
Nach dem Tod des Bruders hatte sich der Oldman um den damals fünfzehnjährigen Patrick gekümmert, ließ ihn die bevorzugte Universität besuchen, bezahlte den Abschluss Cum Lauda, gab ihm danach einen gewichtigen Posten in einem seiner Unternehmen. Patrick stellte sich leider von Anfang an als Lebemann heraus, ähnlich wie Silver, nahm die Tage, wie die jungen Mädchen fielen, gehörte zu den bekanntesten Party-Löwen von London, wurde von bestimmten Kreisen eng umworben. Auch an diesem Morgen wachte er mit einem grässlichen Kater auf, jedoch für einmal in seinem runden Bett auf der Mayflower, wie er sein Hausboot scherzhaft getauft hatte. Das Original hatte immerhin die Pilgrims in das gelobte Land geführt. Seine Mayflower brachte ihn dagegen immer und immer wieder direkt dem Paradies näher.
Patrick McPhearsen drehte seinen schweren Kopf, stöhnte dabei leise auf. Dafür war bestimmt der viele Whiskey von gestern Nacht schuld und nicht die kleinen, rosafarbenen Pillen, die er sich mittlerweile auch über Tag wie Tic-Tacs einwarf, um seine Laune hoch zu halten. Aus verschwollenen Augenlidern erblickte er einen nussbraunen Haarschopf zwischen den Lacken hervorquellen. Er versuchte sich an das Mädchen zu erinnern, vermochte es nicht. Mit einem Ruck richtete er seinen Oberkörper auf, fühlte zugleich den Schlag in seinem Kopf, stöhnte lauter auf. Der schlanke Mädchenkörper neben ihm begann sich zu regen, hob das Gesicht aus den Laken, starrte aus übermüdeten Augen zu ihm hoch.
»Was is?«
Sie spuckte eine Haarsträhne aus ihrem Mund, fuhr sich mit der Zunge über die trockenen Lippen. Patricks Kopf bemühte sich um Klarheit. Ach ja, die Kleine hatte sich im Blue Moon wie eine Klette an ihn gehängt. Er grinste, dachte an die Bumserei im Damenklo der Diskothek, wie er sie von hinten kräftig genommen hatte, für einmal so ganz ohne Viagra, einfach so und voller Lust.
»Halt dein Maul«, befahl er ihr abweisend.
Sie ließ ihren Kopf wieder sinken, lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Bettlaken, begann sofort tief und schwer zu atmen, dann sogar leicht zu schnarchen. Wie sie hieß, wusste Patrick immer noch nicht zu sagen. Es war ihm aber auch egal.
Seine Muskeln an Armen und Beinen schmerzten ihn, als hätte er gestern ausdauernden Sport betrieben. Verdammter Alkohol, dachte er wieder, ich muss mit dem Saufen aufhören.
Dann grinste er jedoch kurz, wusste er doch ganz genau, dass Abstinenz für ihn völlig unmöglich war. Wie hätte er ohne Whiskey auch nur einen angenehmen Tag verleben können? Immer noch besser, mit beduselten Gedanken durch diese Scheißwelt zu torkeln, als nüchtern und dafür aufrecht zu schreiten.
Zu schreiten?
Was für ein beschissenes Verb.
Etwas für Schwule.
Mühsam rutsche er zum Bettrand, stellte seine nackten Füße auf den Boden, spürte den Hermelinpelz der Tagesdecke auf seinen Sohlen. Er stand unsicher auf, denn die Welt begann sich zu drehen. Taumelnd blieb er auf den Beinen, bis sich nach ein paar Sekunden der rote Nebel vor seinen Augen verzogen hatte.
Wie ein gichtkranker Alter bewegte er sich zum Schrank mit der kleinen Bar. Er goss sich aus der offenen Flasche zwei Finger breit Black Borrow in das danebenstehende, bereits benutzte Glas mit den Spuren eines Lippenstifts an seinem Rand, stürzte den Inhalt seine Kehle hinunter. Erst schüttelte er sich und verzog sein Gesicht vor Schmerzen oder Ekel oder beidem. Mit geschlossenen Augen wartete er auf das Abklingen des Bohrens in seinem Schädel.
Als er seine Lider wieder öffnete, erblickte er einen seltsam gekleideten Mann in der offenen Tür zum Schlafzimmer. Patrick zuckte überrascht zurück, versuchte sich darüber klar zu werden, ob das Bild real war oder bloß eingebildet. Denn der Kerl hatte sich ganz in Plastikfolie verpackte, trug über seinen Straßenkleidern einen Overall aus durchsichtigem Kunststoff mit Kapuze. Nun hob der Kerl seinen linken Arm. In der behandschuhten Hand hielt er eine schwarze Pistole mit überlangem Schalldämpfer. Patrick sah die Mündung auf einmal unnatürlich groß vor seinen Augen auftauchen. Er stierte in das schwarze Loch, mitten hinein, schwankte erneut, begriff nichts, fühlte dafür Übelkeit hochsteigen.
»Grüße vom Oldman«, sagte der Plastikmann grimmig. Patrick McPhearsen registrierte noch das seltsame, nach Russisch klingende Englisch des Bewaffneten. Dann war die Kugel aus dem Lauf in seiner Stirn eingeschlagen, zerfetzte seinen nächsten Gedanken.
Der Knall wurde zwar durch den Schalldämpfer um die Hälfte verringert. Trotzdem richtete sich die junge Frau erstaunt im Bett auf, oder war sie noch ein minderjähriges Mädchen?
»Was is?«, richtete sie dieselbe Frage wie vorhin an Patrick diesmal unbestimmt an den Plastikmann, erkannte dann die Waffe in dessen Hand, wurde auch schon von zwei Kugeln in den Oberkörper getroffen, noch bevor sie vor Schreck hätte schreien oder gar fliehen können. Sie fiel zurück auf das Lacken, spürte noch keinen Schmerz, nur die bleierne Müdigkeit, eine alle ihre Glieder erfassende Schlaffheit, sah immer noch den Mann in Plastik dort stehen, unwirklich, mit einer Pistole in seiner nun gesenkten Hand, wie er näher an das Bett herantrat, den Arm mit der Waffe erneut etwas anhob. Die Mündung tauchte vor ihren Augen auf. Dann wurde die Welt schwarz.
*
Jules klingelte, drückte die Türklinke hinunter und trat ein. Dr. Grey kam ihm lächelnd aus dem Behandlungszimmer entgegen.
»Und? Wie fühlen Sie sich heute, Jules?«
»Blendend, Emanuelle.«
Jules hatte nach rund zwei Dutzend Sitzungen auf die Anrede mit Vornamen bestanden und Dr. Grey war nach kurzem Zögern darauf eingegangen, sah darin vor allem einen Weg, die Vertrautheit und damit das Vertrauen zu verstärken und so noch direkter und stärker in die Psyche dieses Patienten einzudringen.
»Haben Sie sich mit den Punkten beschäftigt, die ich Ihnen das letzte Mal vorgeschlagen habe?«
Jules setzte sich in den von ihr angebotenen Sessel, lächelte die Psychologin spöttisch an.
»Jaaa«, gab er dann provokativ langsam von sich, »ich habe meine Hausaufgaben gemacht.«
»Und?«
»Sie lagen wiederum falsch«, gab Jules siegesgewiss von sich.
Nun lächelte auch Dr. Grey, jedoch nicht etwa spöttisch, sondern mit Nachsicht.
»Sie haben sich intensiv an diesen einen Tag in Mexiko zurückerinnert?«
Jules nickte zustimmend, wirkte auf einmal jedoch irgendwie verbissen oder gar verbiestert.
»Und Sie verspürten dabei keinerlei Angst?«
Er schüttelte stumm und ablehnend den Kopf.
»Auch nicht, als Sie die rostige Säge in die Hand nahmen?«
Jules schluckte hart, verneinte erneut durch kurzes Kopfschütteln.
»Und als Sie sie ansetzten? Zum ersten Schnitt?«
Eine Schweißperle zeigte sich auf der Stirn ihres Patienten. Doch der wischte sie mit dem Handrücken rasch weg, starrte Dr. Grey nun beinahe feindselig an.
»Tat es denn sehr weh?«
Diesmal nickte der Schweizer und seine Kinnlade bebte dabei leicht, als müsste er ein Würgen unterdrücken.
»Und sie verspürten wirklich keine Angst?«
Keine Antwort von ihm. Oder war das verbissene Schweigen eine Zustimmung?
»Wissen Sie, Jules, diese Gedankenübungen dienen nur einem Zweck. In Ihrem Gehirn ist einiges durcheinandergeraten. Tatsachen haben sich womöglich mit Fantasien und Möglichkeiten vermengt. Die tatsächlich erlebten Gefahren vermischten sich mit unterbewussten Ängsten. Und über all dem lastet ihre Verantwortung, für Ihre Familie und für sich selbst. Nicht zuletzt aber auch für die Getöteten.«
Jules wischte sich mit den Daumenballen über die feucht gewordenen Augen.
»Und warum quälen Sie mich weiterhin damit?«
Dr. Grey lächelte nun beinahe traurig.
»Sie sind immer noch in ihrem selbst geschaffenen Käfig gefangen, Jules. Diesen Käfig müssen Sie allein zerstören, und zwar von innen heraus. Alles was ich dabei tun kann, ist Ihnen zu helfen, Sie zu unterstützen, indem ich Ihnen den richtigen Weg aufzeige und sie Schritt für Schritt begleite.«
»Und dazu müssen Sie so lange in meinem Gehirn herumwühlen, bis ich selbst kaum mehr weiß, was Wahrheit ist und was Einbildung?«
»Jules, Sie wissen längst nicht mehr, welche von Ihren Erinnerungen und Empfindungen tatsächlich passiert sind und welche Sie bloß träumten, welche Gefühle Sie bei Ihren möglichen Taten empfunden und welche Sie sich später eingeredet haben. Wenn Sie aus Ihrem selbst geschaffenen Gefängnis jemals ausbrechen wollen, dann müssen wir zuerst jede einzelne Käfigstange analysieren und ihren Schwachpunkt finden. Denn mit jeder neu gewonnenen Erkenntnis schreitet die Korrosion fort. Erst der Rost wird ihnen mit der Zeit den Ausbruch ermöglichen.«
»Schön bildhaft gesprochen, Dr. Grey.«
Der Spott war in die Stimme des Schweizers zurückgekehrt.
»Keine Ausflüchte mehr, Jules. Das haben Sie mir versprochen«, meinte die Psychologin streng.
Er nickte als Zustimmung, sank tiefer in den Sessel.
»Warum eigentlich darf ich nicht liegen während unseren Sitzungen?«
»Weil ich nicht will, dass Sie sich zu sehr entspannen, Jules. Entspannung ist gut, um zu vergessen. Doch das können und dürfen Sie nicht. Noch lange nicht.«
Ein paar Sekunden lang schwiegen beide, sahen sich bloß stumm in die Augen. Es war dann Jules, der fortfuhr.
»Haben Sie irgendwelche Tipps für meinen Urlaub? Oder irgendwelche besonderen Aufgaben?«
»Ja, die hab ich. Sie sollten mit Ihrer Frau über alles sprechen, ihr offen erzählen, so wie Sie das bei mir in den letzten Wochen getan haben. Ich durfte Alabima in der Zwischenzeit ja kennenlernen. Sie wird Sie verstehen. Und Ihnen helfen.«
»Nein«, wies Jules ihren Auftrag strikt ab, »kommt nicht in Frage. Alabima wird nicht auch noch da hineingezogen. Sie bleibt aus dem Spiel.«
»Es ist kein Spiel, Jules«, antwortet Dr. Grey sanft, »denn es geht um Ihr Leben. Oder hatten Sie in letzter Zeit etwa keine Selbstmordgedanken mehr?«
Diesen heiklen Punkt in seinem Leben hatte die Psychologin bislang in all den Sitzungen kaum erwähnt. Nur zu Beginn der Therapie war Selbstmord ein Thema und Jules hatte seither keine Lust verspürt, ihr von sich aus mehr darüber zu erzählen. Doch der Psychologin war von Anfang an klar gewesen, dass das Leben Ihres Patienten stark gefährdet war. Wohl nicht unmittelbar, da war sie sich mittlerweile ziemlich sicher, denn jeder Selbstmörder wälzte diesen Gedanken viele, viele Male, gab ihnen zu Beginn ihrer Verirrungen meist keine echte Chance. Doch jede Idee konnte langsam reifen und zu einer verführerischen Gewissheiten werden. Denn das plötzliche Ende versprach den Patienten zumindest Frieden, für die Seele, für das so arg geplagte Gewissen. Der eigene Tod war zudem die ultimative Sühne, das Gegengewicht zur Schuld, ein Ausgleich und die Wiederherstellung von Gerechtigkeit.
»Sie sollten Mexiko vorerst meiden.«
»Und New Mexiko?«, fragte er anzüglich und angriffslustig zugleich.
Das Lächeln von Dr. Grey zeigte überlegenes Verständnis.
»New Mexiko geht in Ordnung. Grüßen Sie mir Santa Fe.«
»Sie waren bereits dort?«
Dr. Grey winkte ab.
»Ich lebte ein paar Monate dort. Hatte was mit Liebe zu tun.«
»Aha.«
Mehr sagte Jules nicht. Und auch Dr. Grey fügte nichts hinzu.
»Denken Sie in den nächsten Wochen über eines nach, Jules.«
Der Schweizer blickte seine Psychologin aufmerksam an.
»Haben Sühne und Gerechtigkeit tatsächlich etwas miteinander zu tun? Oder bilden wir uns das bloß ein? Sind die beiden vielleicht sogar Gegner, die sich ausschließen?«
»Philosophie, Dr. Grey?«, spöttelte Jules erneut.
»Erkenntnisse«, korrigierte sie, »einen intelligenten Menschen wie Sie, Jules, kann man nur über eigene Erkenntnisse heilen.«
*
»Nein, Mr. Chen, das verstehe ich doch…«
Michael Langton presste das Handy fest an seine Ohrmuschel. Er schwitzte stark und seine Augen zeigten einen Anflug von Panik, dem sich nun auch sein übriges Gesicht immer mehr anschloss.
»Doch, doch. Da haben Sie bestimmt Recht, Sir. Aber bedenken Sie doch…«
Dieser Mr. Chen schien ihn nicht ausreden zu lassen. Jedenfalls verstummte Michael Langton erneut, fuhr sich fahrig mit dem Handrücken über die feuchte Stirn. Sie glühte, als hätte er Fieber.
»Aber wir müssen uns irgendwie einigen.«
Verzweiflung war deutlich aus seiner Stimme heraus zu hören, gab seinem Gegenüber sämtliche Trümpfe in die Hand.
Michael Langton war das, was man hier in Hongkong einen freien Makler nannte. Er vermittelte Geschäftskontakte zwischen Kunden in aller Welt und chinesischen Produzenten. Mr. Chen war ein mittelgroßer Uhrenhersteller, betrieb auf dem Festland drei Fabriken, die er stolz als Manufakturen bezeichnete. Er beschäftigte mehr als tausend Mitarbeiter, wobei der überwiegende Teil weiblich war, wegen der besseren Feinmotorik, wie Chen gegenüber einer fragenden Journalistin einmal betont hatte. Auf ihre Rückfrage, warum denn in der Schweiz die meisten Uhrmacher Männer seien, schwieg er dann beleidigt.
Die Fabriken von Chen hatten letztes Jahr viertausend exklusive Armbanduhren für ein brasilianisches Modehaus produziert. Michael Langton hatte diesen Deal vermittelt und daran recht gut verdient. Doch nun hatte sich herausgestellt, dass die eingebauten Batterien in den Uhren kaum ein halbes Jahr lang hielten und danach ausgetauscht werden mussten. Selbstverständlich beklagte sich der südamerikanische Kunde sogleich bei Michael Langton, verlangte nach einer nachträglichen, happigen Rückzahlung. Immerhin musste das Modehaus die verärgerte Kundschaft mit Gutscheinen bei Laune halten. Michael hatte sich schon nach dem ersten Anruf mit der Hiobsbotschaft aus der Hauptstadt Brasilia schrecklich gefühlt. Immerhin haftete er als Intermediär für den entstanden Schaden, weil er dummerweise die Qualitätssicherung vor dem Versand der Uhren nach Südamerika persönlich übernommen hatte. Denn seine Provision betrug nur fünf Dollar und fünfzig Cent pro Uhr, wobei die Überwachung und Kontrolle der Qualität mehr als die Hälfte ausmachte. Insgesamt zweiundzwanzig tausend Dollar hatte Michael Langton eingestrichen und als Gegenleistung bloß ein paar Telefonate geführt, einen kurzen Besuch in einer der Fabrikationshallen von Mr. Chen gemacht, ein Arbeitsessen mit dem Firmeninhaber bezahlt und ein paar Stichproben der versandfertigen Waren entnommen und untersucht. Er hatte Mr. Chen zwar von Anfang an nicht hundertprozentig über den Weg getraut, die Uhren deshalb mit der Lupe genauestens geprüft, sie sogar einem befreundeten Uhrmacher gezeigt. Doch selbst der fand keine Mängel, weder am verwendeten Material noch an den eingesetzten Bauteilen oder der Sorgfalt beim Zusammensetzen. Aber er hatte Michael Langton auf den Batteriehersteller hingewiesen.
»Die Shenzhen Accumulator Ltd. produziert ab und zu in schwankender Qualität. Du solltest die Batterien zur Sicherheit noch zum Nachmessen geben.«
Und das hatte Langton leider nicht getan, hatte sich in diesem Punkt auf die Zusicherungen von Mr. Chen verlassen. Der gab nämlich an, dass in seinen Betrieben jede eintreffende Batterielieferung von seinen Leuten gewissenhaft vermessen wurde und nur erstklassige Ware, die mindestens drei Jahre hielt, an Lager genommen würde.
Verdammt, dachte Michael Langton, ich Idiot, während er seinem chinesischen Lieferanten weiter bei seinen Ausflüchten und Rechtfertigungen zuhörte.
»Wie stellen Sie sich das vor, Mr. Langton«, ereiferte sich der Chinese in diesem Moment, »fünfundzwanzig Dollar Rückerstattung? Pro Uhr? Ist Ihr Kunde wahnsinnig geworden? Er hat mir nicht mehr als fünfundsechzig Dollar pro Stück bezahlt.«
»Ja, Mr. Chen, ich verstehe. Aber sein Angebot erscheint mir trotzdem sehr fair. Immerhin hat er jedem Käufer einen Gutschein im Wert von fünfzig Dollar abgegeben. Er übernimmt also selbst fünfzig Prozent des Schadens.«
»Papperlapapp«, reklamierte der Chinese sogleich, »die Bruttomarge dieser Modehäuser liegt bestimmt bei neunzig Prozent. Da verdient er noch was an seinen Gutscheinen. Drei Dollar Preisminderung pro Uhr, das ist mein einziges und letztes Angebot. Und das mache ich nur, weil Sie ein guter Junge sind.«
Michael Langton war über die Großzügigkeit des Uhrenherstellers entsetzt und über die Entwicklung des Gesprächs verzweifelt. Doch er hatte den Vertrag, den er als Intermediär mit der Watch & Jewellerie Company Shanghai des Mr. Chen abgeschlossen hatte, bereits mehrere Male vor und zurück durchgelesen, fand darin leider auch eine gewisse Passage über den Ausschluss jeglicher Garantie bezüglich den verwendeten Batterien. Der Passus war ihm vor der Vertragsunterzeichnung entgangen, wahrscheinlich deshalb, weil er unter den kleingedruckten Terms & Conditions stand, also dort, wo sich sonst bloß allgemeine Floskeln zur Lieferung und Bezahlung tummelten. Der vielfache Millionär Chen hatte den kleinen Makler Langton damit jedoch sauber gelinkt. Und dass er ihm nun anbot, drei Dollar des Schadens zu übernehmen, war wohl eher als zusätzlicher Hohn und nicht etwa als ehrliche Wiedergutmachung gedacht.
»Ihr brasilianischer Kunde kann die Uhren auch an uns zurücksenden«, bot der Fabrikant nun an, »dann tauschen wir ihm die Batterien umsonst aus. Gut so, Mr. Langton? Sie sehen, ich bin Ihr Freund und will Ihnen helfen.«
Das war ebenso großer Nonsens wie das drei Dollar Angebot. Gequirlte Scheiße, wie Michael gerade dachte. Denn kein Käufer würde mehrere Wochen auf seine Armbanduhr verzichten, wenn er die Batterie auch für wenige Reales direkt in Brasilien austauschen lassen konnte und dafür auch noch einen Gutschein des Modehauses im Gegenwert von fünfzig Dollar erhielt.
»Teilen Sie mir also mit, für welche Variante sich Ihr Kunde entscheidet. Rufen Sie mich wieder an, Mr. Langton, ja?«
Mr. Chen hatte nach diesem Satz direkt aufgelegt und auch Michael Langton drückte ein paar Sekunden später den Knopf an seinem Handy, unterbrach die Verbindung auf seiner Seite.
Verdammt. Hunderttausend Dollar wollte sein Kunde in Rio de Janeiro von ihm zurückerhalten und damit Gutscheine über zweihunderttausend finanzieren. Auch Michael Langton war selbstverständlich klar gewesen, dass die Margen des Modehauses weit höher als bei fünfzig Prozent lagen, die Brasilianer also auf seine Kosten ein Zusatzgeschäft witterten. Doch was hätte er anderes tun sollen?
Der Halb-Chinese seufzte, nahm wieder sein Smartphone zur Hand und suchte sich aus dem Speicher eine bestimmte Nummer heraus, drückte die Anruftaste, hob das Telefon an sein Ohr.
»Ja, hallo Charley, ich bin’s, Michael. Du, ich komm aus der verdammten Brasilien-Sache nicht mehr raus. Ja, die Batterie-Geschichte, von der ich dir gestern erzählt habe. Leitest du bitte alles wie besprochen in die Wege? Ja? Ich danke dir. Nein, ich werde die Büroadresse hier sicherheitshalber noch heute aufgeben. Miete mich doch vorerst im VP an der Central Station ein. Den neuen Namen kennst du ja. Okay? Wir sehen uns morgen. Ciao.«
Charley Chase war sein Anwalt und Freund. Und was Charley nun auf den Weg brachte, das hatte er für Michael Langton bereits zweimal durchgespielt. Die Langton Trade and Export Corporation Ltd. würde in den nächsten Tagen im Handelsregister gelöscht, genauso wie die frühere Michael Langton Quotation Ltd. und die Hang Seng Trading Ltd. zuvor. Dafür würde als sein neues Unternehmen die ML Logistics Ltd. Eingetragen werden.
Neuer Name, neue Adresse, neues Leben. Die Wiedergeburt des Geschäftsmanns Michael Langton war sichergestellt. Sollten die Brasilianer ruhig toben. Immerhin war auch er, Michael Langton, von Mr. Chen hereingelegt worden. Und dass sich sein Kunde in Südamerika auch noch an ihnen beiden bereichern wollte, war zwar verständlich, aber nicht sein Problem. Fairness im Geschäftsleben hin oder her. In dieser Beziehung war Michael Langton längst zum Vollblut-Chinesen geworden. Immerhin war er vor über dreiundzwanzig Jahren in dieser Stadt geboren worden und hier aufgewachsen, sprach Mandarin und Kantonesisch ebenso fließend wie Englisch, wenn auch alle drei mit dem Akzent aller Hongkonger. Sein Vater, John Langton, und seine Mutter, Lai a-Mong, waren beide leider sehr früh verstorben und er hatte kaum Erinnerungen an sie. Denn Michael war damals erst drei gewesen und wuchs von da an im Waisenhaus auf. Er konnte in all den Jahren nie an eine andere Familie vermittelt werden. Warum das so war? Das fand er erst viel später und als Erwachsener heraus.
Niemand wollte Sie, Michael, tut mir wirklich leid, hatte die Direktorin ihm auf seine Frage hin stets versichert. Misses Chan war eine kleine, gedrungene Frau mit dem breiten Gesicht einer Bulldogge und dem schwankenden, watschelnden Gang einer Ente, ebenso bissig, wie verschlagen. Doch jedes zusätzliche Waisenkind bedeutete für ihr privat geführtes Haus eine Einnahmequelle. Und so schmierte Misses Chan über viele Jahre hinweg die lokalen Sozialbehörden, damit deren Beamten für keinen ihrer Schützlinge jemals Platz in einer anderen Familie finden konnten.
Das alles war Michael allerdings erst richtig klar geworden, als er vor drei Jahren im Internet auf einen Bericht über die katastrophal niedrige Vermittlungsrate von Waisenkindern in Hongkong stieß. Eine junge Journalistin hatte das Thema eingehend recherchiert, mit Waisenhausbetreibern und Beamten des Sozialdepartements gesprochen und daraufhin eine Reihe von Zeitungsberichten veröffentlicht. Die Antworten der Amtspersonen überraschten Michael nicht wirklich. Unisono erklärten sie, dass Waisenkinder den besonderen Schutz des Staates verdient hätten und deshalb nur bestens geeignete Familien in Betracht kamen, dass man einfach nicht riskieren durfte, diese vom Schicksal bereits stark gebeutelten Kinder an womöglich schlechte Adoptiveltern zu vermitteln und ihnen so unnötiges und zusätzliches Leid zuzufügen. Denn auf der anderen Seite waren die Waisen in den Heimen auf das Beste untergebracht und liebevoll betreut, da alle diese Häuser ständiger staatlicher Überwachung unterlagen.
Als Michael diese Aussagen las, dachte er zurück an die tränenreichen Nächte, als er mit brennendem Hinterteil, auf dem Bauch liegend, die Trostlosigkeit seines Daseins in sein Kopfkissen weinte.
Auch die vielen, von der Journalistin festgestellten Missstände in den Einrichtungen wurden in den Beiträgen thematisiert. Doch irgendwie verlief die Reportage bald einmal im Sand, löste keine politische Diskussion aus, schaffte keine Schlagzeilen. Was außerhalb der Familie, der Sippe und des Freundeskreises ablief, war in den Augen der Mehrheit der Leserschaft die Aufgabe des Staates. Darum musste man sich nicht persönlich kümmern.
Michael Langton war heute dreiundzwanzig. Mit sechzehn Jahren durfte er eine kaufmännische Ausbildung bei einem britischen Transportunternehmen starten. Zehn-Finger-Tastaturschreiben brachte er sich selbst bei, beobachtete dazu bloß die Sekretärinnen bei ihrer täglichen Arbeit, übte später auf einer selbst gezeichneten Tastatur, bis es ihm gut gelang. Auch besaß Michael ein ausgesprochenes Flair für Computer, las die Anleitungen und Trainingsbücher durch, was sonst kaum einer in der Firma tat, funktionierte bald einmal im Nebenamt als IT-Supporter, wurde deshalb von seinem Boss immer wieder gelobt, durfte nach dem erfolgreichen Abschluss seiner Ausbildung im Unternehmen bleiben.
Mit zwanzig Jahren hatte er sich das erste Mal selbstständig gemacht, wollte nach der Subprime-Krise vom erneut einsetzenden Wirtschaftsboom auf dem chinesischen Festland und in Hongkong profitieren, seinen Anteil daran absahnen. Doch aller Anfang war schwer und so ging sein erstes Maklerbüro bereits nach wenigen Wochen ein. Niemand wollte mit einem so jungen Mann zusammenarbeiten, niemand traute ihm wirklich etwas zu und schon gar nicht über den Weg. Und die Wuchermiete seines winzigen Büros am Hafen trieben seine Hoffnungen allzu rasch in den Konkurs.
Beim zweiten Versuch ging er wesentlich klüger vor und stellte einen alten Chinesen ein, Mr. Wolfgang Lee, wie der sich nannte, in Anlehnung an Wolfgang Amadeus Mozart, wie der Kerl jedem augenzwinkernd bekanntgab, dem er sich vorstellte. Langton kleidete den heruntergekommenen Mr. Wolfgang Lee auf seine Kosten neu ein, trainierte mit ihm auch Auftreten und Manieren. Fortan waren sie stets zu zweit unterwegs gewesen, hatten viele chinesische und britische Unternehmen gemeinsam besucht und Geschäftskontakte geknüpft. Sie stellten sich jeweils als Firmeninhaber und Juniorpartner vor und hatten von Beginn an Erfolg. Mr. Lee wirkte distinguiert, aber meist wenig interessiert, was einen ausgesprochen seriösen Rahmen vortäuschte, während Michael Langton als der aufgeschlossene, vitale, amerikanisch-chinesische Manager auftrat und die notwendige Dynamik für die Geschäfte einbrachte.
Doch nach etwas über einem Jahr war dann Mr. Wolfgang Lee von einem Tag auf den anderen verschwunden, hatte zuvor die Firmenkonten leergeräumt und Kommissionsware von Kunden auf dem Schwarzmarkt verhökert. Sogar die Büroräume an der Queen’s Road hatte das verdammte Schlitzohr auf drei Jahre hinaus an eine andere Firma untervermietet und das Geld in bar kassiert. Michael Langton zitterte heute noch vor Wut, wenn er sich dann und wann an diesen Morgen erinnerte, wie er gegen acht Uhr mit dem Schlüssel in der Hand vor der Bürotür stand, hinter der Milchglasscheibe der Einfassung rege Bewegungen erkannte, dazu fröhliches Geplapper und Schreibmaschinen-Geklapper, wie er dann verwundert eingetreten war und ihn die drei Mitarbeiter der frisch eingemieteten Firma erwartungsvoll angeschaut hatten, wie er zu fragen begann und sie ihm bereitwillig, aber spöttisch lächelnd Antwort gaben und ihm eine Kopie des unterschriebenen Mietvertrags zeigten.
Selbstverständlich hatte Michael den sauberen Mr. Wolfgang Lee bei den Behörden angezeigt. Und nach etwas über drei Monaten fanden sie ihn tatsächlich in der Nähe von Shanghai, bereits halbtot, mit Opium vollgepumpt, abgemagert und vollkommen blank. Man brachte Lee in ein Hospital, wo man ihn aufpäppelte, danach kam er ins Gefängnis und anschließend für den Rest seines Lebens in ein Umerziehungslager irgendwo in der Provinz. Michael Langton hingegen musste nach diesem erneuten Flop das quirlige Hafenquartier nicht nur mit seinen Unternehmungen verlassen, sondern für alle Zeiten persönlich meiden. Zu viele Leute erinnerten sich an den dunkelblonden und blauäugigen Halb-Chinesen mit seinem zweifachen, geschäftlichen Ruin. Später, als er wieder auf die Beine gekommen war, zog Michael Langton ins Happy Valley, wo er sich ein Apartment mit seiner Freundin Jin Wang teilte. Die 83 Quadratmeter waren zwar sündhaft teuer, doch das war seine Freundin ebenso.
Jin Wang, die sich selbst Gin Davis nannte, war eine Festland-Chinesin aus Kengwei, einem Provinznest nahe Guangdong. Sie war als Fünfzehnjährige illegal nach Hongkong gelangt, hatte sich hier korrekte Papiere besorgt, arbeitete, seit sie mit Michael Langton liiert war, als selbstständige Marketingberaterin. Womit sie zuvor ihr Geld verdient hatte, verriet sie ihm nicht, beantwortete seine Fragen wage und ausweichend.
Viel Geld kam bei ihrer Tätigkeit allerdings nicht zusammen, denn Gin Davis wurde nur selten für mehr als ein paar Stunden engagiert. Und so verbrachte sie die meiste Zeit in ihrem gemeinsamen Apartment, verließ es eigentlich nur, um sich mit einer ihrer zahlreichen Freundinnen zu treffen. Zumindest erzählte sie das ihrem Freund Michael.
Langton verspürte kein gutes Gefühl, als er in diesem Moment an seine Ginnie dachte. Bestimmt würde sie ihm wieder Vorhaltungen machen, dass er ein schlechter Geschäftsmann wäre, hoffnungslos vertrauensselig, viel zu naiv, ganz einfach nicht geschaffen für das harte Leben auf den Straßen von Hongkong. Und sie hatte leider Recht damit, seine Ginnie.
*
Sie flogen am nächsten Tag von London aus nach Dallas-Fort Worth. Als einzige Reisende in der ersten Klasse wurden sie vom Steward auf das Angenehmste umsorgt. Jules las die meiste Zeit über in einem Buch, nur unterbrochen von den beiden Mahlzeiten und gelegentlicher Beschäftigung mit Alina. Sein Lesestoff berichtete über Volksbräuche im Südosten von Asien. Von den meisten hatte Jules noch nie zuvor gehört, auch wenn er in früheren Jahren des Öfteren nach Vietnam und Südkorea gereist war und auch die Philippinen mehrmals besucht hatte. Der Champagner, ein 1999er Bollinger rosé, schmeckte ihm ausgezeichnet und er genehmigte sich das eine oder andere Glas zu viel, fühlte sich jedoch keineswegs angetrunken, als sie recht pünktlich gegen halb sechs in Texas landeten.
Sie wollten in der Nähe des Flughafens im Embassy Suites übernachten, hatten dort ein Zimmer für die Nacht gebucht. Zuvor mussten sie noch den Mietwagen abholen, den sie sich auf sechs Uhr abends reservieren ließen. Eilig hatten sie es also nicht und so schlenderten sie gemütlich in Richtung der Einreiseschalter, wurden von eiligeren Passagieren überholt. Doch die drei hatten die Immigration-Halle noch nicht erreicht, als zwei Männer in Uniform auf sie zukamen.
»Mr. Lederer?«, fragte der eine, ein hochgewachsener Afro-Amerikaner mit fleischigem, rundem, aber gar nicht gemütlich wirkenden Gesicht und verfetteten Hüften.
Jules nickte.
»Sie wünschen?«
»Kommen Sie bitte mit uns mit.«
Der Afro-Amerikaner drehte sich um und ging voraus. Jules und Alabima blickten sich einen Moment lang stumm und erstaunt an, folgten ihm jedoch. Alina ging zwischen ihnen, geführt an den Händen von Vater und Mutter. Auch sie hatte erkannt, dass etwas nicht stimmen konnte und blickte entsprechend kritisch auf den großen Mann in der dunkelblauen, fast schwarzen Uniform und dem schwabbeligen Hinterteil, über den sich die Hose so seltsam spannte. Auf der oberen Hälfte seines Popos saß sie straff, so als würde der Stoff gleich platzen, an der unteren schlotterte sie, so als wäre der Hintern des Beamten in der Mitte durchgeschnitten.
Der zweite Beamte, ein schlaksiger Kerl von Mitte dreißig, mit ungesund gelber Gesichtsfarbe und blondiertem, fast weißem Kopfhaar und stechenden, kleinen, dunkelgrauen Augen, ging hinter ihnen her, hielt jedoch zwei, drei Meter Abstand, als müsste er den Überblick behalten.
Sie gingen quer durch die Halle hinüber zu einer unauffälligen Seitentür. Der Afro-Amerikaner zog einen Schlüsselbund vom Gürtel und öffnete, trat ein und hielt die Türe für die Lederers und seinen Kollegen auf. Der Flur dahinter war recht lang und in einem langweiligen Ockergelb gestrichen. Links und rechts zweigten graue Türen ab. Sie gingen an einigen vorbei, bis der Beamte stehen blieb und eine davon aufschloss, aufstieß und zu Alabima meinte: »Bitte warten Sie mit Ihrer Tochter hier drin. Wir müssen mit Ihrem Ehegatten reden.«
Jules und Alabima sahen sich wiederum in stummer Zwiesprache an und Jules zuckte dann mit den Achseln. Die Äthiopierin führte Alina hinein. Der Raum war erstaunlich freundlich eingerichtet. Ein Dreiersofa lud zum Sitzen ein, ein Tisch mit zwei Stühlen stand nicht weit davon entfernt und sogar an eine Topfpflanze, eine Yucca Palmlilie, hatte man gedacht. Das breite Fenster war zur Hälfte mit einer weißen Gardine verdeckt. Da der Raum im zweiten Stockwerk des Gebäudes und somit gut fünf Meter über dem Boden lag, sah man nur die Krone eines Baumes, dessen Blätter seltsam gekräuselt waren und wie vertrocknet wirkten, als bekäme der Baum schon seit langer Zeit zu wenig Wasser.
Alabima und Alina ließen sich auf dem Sofa nieder. Der Beamte von Mitte-Dreißig war ihnen gefolgt, zog die Türe hinter sich ins Schloss, nahm sich einen Stuhl und setzte sich an den Tisch, beachtete Mutter und Kind nicht weiter, sondern begann mit seinem Smartphone zu spielen.
»Was ist mit Papa?«, fragte Alina schüchtern und flüsternd.
»Es ist nichts. Mach dir keine Sorgen. Der Mann will Papa bloß ein paar Fragen stellen. Er wird bald wieder zurück sein.«
Der Blonde verzog bei ihren tröstenden Worten seine Mundwinkel zu einem spöttischen, ja zynischen Lächeln, blickte kurz und triumphierend zur Äthiopierin hinüber, widmete sich danach wieder seinem elektronischen Spielzeug. Kurz darauf knackte das Funkgerät an seinem Gürtel und eine Stimme fragte nach Henderson. Der Beamte meldete sich leise, drehte die Lautstärke zurück und hielt sich das Gerät nah an sein Ohr. Dann nickte er, stand auf, steckte das Funkgerät an den Gürtel zurück und ging zur Tür. Er öffnete sie mit seinem Schlüsselbund und trat hinaus, zog sie hinter sich zu.
Alabima bemerkte erst jetzt, dass die Türe weder eine Falle noch einen Drehknopf aufwies und darum nur mit einem Schlüssel zu öffnen war. Man hatte Alina und sie eingesperrt. Die Äthiopierin stand auf, trat zum Fenster. Es besaß weder Scharniere noch Schiebemöglichkeiten, konnte nicht geöffnet werden.
»Was ist, Maman?«, fragte Alina auf Französisch. Sie hatte von ihrem Märchenbuch aufgeblickt und ihre Mutter beobachtet.
»Nichts, meine Kleine, nichts«, versuchte sie die Tochter nicht zu beunruhigen.
»Hat der Mann uns eingesperrt?«, wollte das aufgeweckte Kind als nächstes Wissen.
»Nein. Er musste bloß kurz weg. Und die Türen können hier halt nur mit Schlüssel geöffnet werden.«
»Also doch eingesperrt«, stellte die Kleine fest, »sind das böse Männer, Maman?«
Alabima setzte sich wieder zu ihrer Tochter, strich ihr über das Haar.
»Nein, Alina. Das sind gewöhnliche Beamte. Sie machen sich bloß ein wenig wichtig, weißt du? Sie spielen uns etwas vor. Wie im Theater.«
»Aber warum machen sie das? Und warum haben sie nur uns eingesperrt und keine anderen Leute aus dem Flugzeug?«
»Das weiß ich leider auch nicht«, gab Alabima nun ehrlich zu, »doch wir werden es bestimmt bald erfahren. Sobald Papa zurück ist.«
»Und wann kommt er zurück?«
»Das weiß ich ebenfalls nicht«, wiederholte ihre Mutter die Antwort von zuvor, »wir müssen halt etwas Geduld haben. Komm, wir vertreiben uns die Zeit.«
Sie holte das Memory-Spiel aus ihrer Handtasche und die beiden gingen hinüber zum Tisch. Alabima breitete die Karten verdeckt auf der Platte aus und sie begannen, abwechselnd die Bilder anzuschauen und Pärchen zu bilden. Irgendwann meinte Alina: »Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Maman. Papa wird schon kommen.«
Alabima blickte auf ihre Hände, deren Finger leicht zitterten. Sie zog sie zu Fäusten zusammen, rief sich innerlich zur Ruhe, lächelte ihre Tochter tapfer an.
»Ja, Alina, er wird bestimmt bald kommen.«
*
Der Verhörraum besaß kein Fenster und wurde nur von einer einzigen, immer wieder mal flackernden Neonröhre erhellt. Im kalt wirkenden, grau gestrichenen Raum standen ein einfacher Tisch und zwei billige Metallstühle. Jules hatte sich auf den einen setzen müssen. Danach hatten sie ihn allein gelassen.
Eine Kamera war in einer Ecke an der Decke angebracht, überwachte von dort oben wohl mit Hilfe eines Fischauges den gesamten Raum. Der Schweizer machte sich vorerst nur Sorgen um Alina und Alabima. Selbstverständlich würde man sie einigermaßen anständig behandeln. Doch die Ungewissheit würde den beiden mit Sicherheit zusetzen.
Man ließ ihn eine volle Dreiviertelstunde schmoren. Dann endlich hörte er die Schritte von zwei Personen zur Tür treten. Ein Schlüsselbund rasselte. Dann wurde die Türe nach innen aufgestoßen. Ein stämmiger Beamter in Uniform trat als Erster ein, fixierte ihn mit seinen hart blickenden Augen. Hinter ihm folgte ein zweiter Mann, der in einem dunkelgrauen Anzug steckte.
»Mr. Lederer«, begrüßte dieser den Schweizer recht freundlich und streckte ihm seine Hand entgegen, »was um alles in der Welt führt Sie in die USA?«
Der Mann schien keine Antwort zu erwarten, denn nach der Frage wandte er sich sogleich ab, setzte sich etwas umständlich auf den zweiten Metallstuhl, zog einen Blackberry aus der Jackentasche, legte ihn vorsichtig auf der Tischplatte ab, ruckte ihn anschließend zurecht, faltete danach seine Hände und stützte seine Unterarme ab. Eine ganze Zeit lang blickte er dem Schweizer schweigend, aber forschend ins Gesicht.
»Auf welcher Liste stehe ich denn?«, wollte Jules nun spöttisch lächelnd wissen.
»Heimatschutz«, gab der Beamte unumwunden zu.
»Als Terrorist?«, fragte Jules immer noch lächelnd nach.
»Nein. Industrie-Spion.«
»Die Sache liegt schon einige Zeit zurück«, konterte der Schweizer, »und es wurde nie Anklage gegen mich erhoben.«
Statt einer Antwort lächelte nun der Beamte im grauen Anzug kalt.
»Haben Sie Washington verständigt?«, bohrte der Schweizer nach, »am besten das Außenministerium. Die werden bestimmt ein gutes Wort für mich einlegen.«
Wieder lächelte der andere stumm, diesmal ein wenig verächtlich.
»Vorerst gehören Sie uns, Mr. Lederer. Selbst das Ministerium kann nichts dagegen unternehmen. Doch wir haben Washington über Ihre Ankunft informiert. Vielleicht haben die dort ebenfalls ein paar Fragen an Sie? Nachdem wir mit Ihnen fertig sind.«
Die Drohung war zwar offensichtlich. Trotzdem konnte Jules noch nicht abschätzen, wohin der Beamte ihn steuern wollte. Fast drei Jahre waren seit der Sache in Nevada, Kalifornien und Delaware vergangen. Und man hatte ihm von höchster Stelle Straffreiheit zugesichert. Wie sein Name trotzdem auf eine der vielen Listen von Gesuchten und Verdächtigen gelangt war, konnte er sich deshalb nicht erklären. In der Regel funktionierte die US-Administration in solch speziellen Fällen wie dem seinen zuverlässiger.
»Und wie geht es nun weiter?«
»Wir werden uns unterhalten, Mr. Lederer.«
»Zu welchem Thema?«
»Na, ist das nicht offensichtlich? Wir wollen den Grund wissen, warum Sie beabsichtigen, in die USA einzureisen.«
»Ist das nicht offensichtlich? Ich bin immerhin mit meiner Frau und meiner Tochter hier.«
»Sind das auch wirklich Ihre Frau und Ihre Tochter, Mr. Lederer?«
»Machen Sie sich nicht lächerlich. Haben Sie denn die Angaben unserer Internet-Anmeldung etwa noch nicht kontrolliert?«
Der Beamte bewegte seine Schultern vor und zurück, als wäre ihm die Frage keine Antwort wert.
»Ein Mann wie Sie, der kann sich doch leicht ein paar falsche Pässe besorgen«, stellte er dann doch noch trocken fest.
»Wir möchten zu dritt wirklich bloß ein paar Wochen Urlaub hier im Südwesten der USA verbringen. Ehrenwort.«
Jules blickte den Mann dabei fest an.
»Ich persönlich glaube Ihnen das sogar, Mr. Lederer«, gab der Beamte jovial zurück, »aber meine Vorgesetzten vermuten leider mehr hinter Ihrem Besuch.«
»Dann schieben Sie uns also wieder ab? Müssen wir mit der nächsten Maschine zurück nach London?«
Der Mann im grauen Anzug zog seine gefalteten Finger auseinander, legte seine Hände mit den Flächen nach unten auf die Platte, betrachtete seine manikürten Fingerspitzen für zwei Sekunden, bevor er wieder den Kopf hob und den Schweizer direkt ansah.
»Nicht so schnell, Mr. Leder. Erst einmal will die Heimatschutzbehörde wissen, was damals tatsächlich geschah. Vor allem die Geschichte in Delaware interessiert uns brennend. Wir wissen zwar, dass Sie in der fraglichen Zeit nie in diesem Bundesstaat weilten und trotzdem müssen Sie darin verwickelt gewesen sein. Wir wollen von Ihnen die Namen aller daran Beteiligter wissen. Und selbstverständlich auch alle Hintergründe.«
»Sie sollten sich wirklich erst einmal mit dem Außenministerium in Washington absprechen«, gab Jules zu bedenken, »ich bin sicher, die Leute dort sind alles andere als erfreut über Ihr Vorgehen.«
»Sie haben Freunde dort?«, fletschte der Beamte unwirsch.
»Sagen wir besser gute Bekannte. Auf jeden Fall Menschen, welche die Hintergründe zu den Vorfällen von damals kennen. Ich muss Sie wohl kaum warnen, Mr. ...«
»Für Sie Smith.«
»Also Mr. Smith. Gut möglich, dass Ihre Karriere in Staatsdiensten mit dem heutigen Tag zu Ende geht. Warten Sie besser auf Anweisungen aus der Hauptstadt, bevor Sie sich selbst unglücklich machen.«
Das Gesicht seines Gegenübers blickte ihn nun zornig aufbrausend an. Der Mann schien innerlich weit weniger gelassen zu sein, als er sich bislang gegeben hatte. Auch der zweite Beamte in Uniform war etwas näher an den Tisch getreten, hatte sich drohend neben Jules aufgebaut.
»Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, meine Herren«, versuchte der Schweizer zu beschwichtigen, »in Washington hat niemand ein Interesse daran, dass die damaligen Hintergründe breiter gestreut werden. Wer es trotzdem versucht, der könnte sich sehr leicht die Finger verbrennen.«
Mr. Smith gab dem Uniformierten ein Zeichen. Der trat mit einem Schritt hinter den Stuhl von Jules und packte den Schweizer oberhalb der Ellbogengelenke, zwang dessen Arme hinter den Rücken, riss ihn gleichzeitig vom Stuhl hoch und zog ihn ein paar Schritte vom Tisch weg. Mr. Smith erhob sich nun ebenfalls, kam langsam und bedrohlich auf ihn zu. Auf der Stirn des Anzugträgers war eine vor Zorn pulsierende Vene zu sehen, was dem bulligen Mann etwas Unberechenbares gab.
»Du dreckiges Arschloch«, brachte der sich selbst zusätzlich in Rage, »du verdammtes Großmaul. Ich stopf es dir am besten erst einmal.«
Jules schaute betont deutlich hoch zur Zimmerecke mit der Kamera. Mr. Smith folgte seinem Blick und lachte dann hart auf.
»Abgeschaltet«, meinte er leichthin und versenkte seine Faust in die Magengrube des Schweizers. Jules klappte nach vorne zusammen, krümmte sich vor Schmerzen. Der Uniformierte hinter ihm legte einen seiner Ellbogen um Jules Hals, zwang ihn wieder hoch. Weitere drei, vier Faustschläge folgten in den Körper, die der Schweizer nur zu einem kleinen Teil durch die Bauchmuskeln dämpfen konnte. Einmal mehr spürte er, wie schlaff sein Körper in all den Monaten und aufgrund der Chemotherapien gegen seine Krebserkrankung geworden war.
Endlich ließ Mr. Smith von ihm ab. Der Uniformierte zog Jules zurück zum Stuhl und stieß ihn auf die Sitzfläche, ließ erst dann die Arme des Schweizers los. Jules würgte immer noch, krümmte sich auch zusammen, hielt sich die beiden Unterarme vor den gequetschten Bauch.
Mr. Smith ließ sich wieder ihm gegenüber nieder. Die pulsierende Blutbahn auf der Stirn des Beamten war verschwunden, seine Wut schien verraucht.
»Also. Möchten Sie mit mir nun über Ihre Tätigkeiten und Komplizen von damals reden, Mr. Lederer?«
Jules schwieg, starrte den Anzugträger bloß an, überlegte fieberhaft, mit was er die beiden Beamten hinhalten konnte. Ihm fiel jedoch nichts Brauchbares ein. Doch alle drei horchten auf, als eilige Schritte auf dem Flur draußen zu hören waren, die rasch näherkamen. Ein Schlüssel wurde ins Schloss gesteckt und die Tür schwang auf, dahinter tauchte ein atemloser, junger Mann auf und rief Mr. Smith zu: »Washington schickt ein hohes Tier zu uns. Wir sollen ihn bis zu seiner Ankunft in Ruhe lassen.«
»Und was sagt der Chef?«, fragte Mr. Smith gespielt gelassen zurück.
»Ich komm direkt von ihm.«
Der Mann im grauen Anzug stand auf, wirkte wenig erfreut, steckte seinen Blackberry wieder zurück in die Jackentasche und blickte dann mitleidlos auf Jules hinunter.
»Nichts für Ungut, Mr. Lederer«, meinte er zum Abschied, »noch einmal Glück gehabt.«
Damit verließen ihn die drei Beamten, zogen die Türe hinter sich ins Schloss. Jules lauschte ihren Schritten, bis sie nicht mehr zu hören waren. Dann stöhnte er langgezogen auf, öffnete die Knöpfe seines Hemdes, zog es aus der Hose, blickte hinunter auf die blau und rot unterlaufene Bauchdecke.
»Mann, bist du außer Form, mein Junge«, sagte er laut zu sich selbst, stand dann stöhnend auf und tastet die Blutergüsse sanft mit seinen Fingern ab. Vorsichtig versuchte er seinen Oberkörper zu strecken, schreckte jedoch gleich wieder zusammen. Leber und Milz waren wohl gestaucht, schickten jedenfalls heiße Schmerzwellen durch seinen Körper. Der Schweizer ließ sich zurück auf den Stuhl sinken und schloss die Augen.