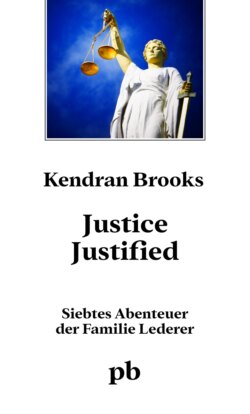Читать книгу Justice justified - Kendran Brooks - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Harmlos
ОглавлениеNach weiteren drei Stunden wurde Jules endlich frei gelassen. Zwar hatte sich niemand aus Washington beim Schweizer blicken lassen. Dafür kam Mr. Smith zurück, drohte seinem Gefangenen noch einmal, dass man ihn und seine Familie im Auge behalten würde, trotz ihres Gönners aus der Hauptstadt, ließ ihn danach aber gehen. Er drückte Jules die abgenommenen Pässe in die Hand und der Schweizer schaute nach, fand den Einreisestempel auf der Migration-Karte, war beruhigt. Die gehässigen Worte des Beamten kümmerten ihn wenig, hatte jedoch mit großer Genugtuung registriert, dass seine Vereinbarung mit der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika immer noch Gültigkeit besaß.
Alabima und Alina waren überglücklich, als sie endlich aus ihrem Gefängniszimmer befreit wurden. Jede Stunde kam zwar eine Beamtin zu ihnen hinein und fragte nach irgendwelchen Wünschen, ob sie zu Essen oder zu Trinken brauchten, ob sie das Klo aufsuchen mussten. Doch die Ungewissheit war eine arge Folter für die beiden gewesen. Jules schloss sie in seine Arme, küsste Alabima sanft, zuckte nur wenig zusammen, als sie ihn mit den Armen umfasste und an sich drückte.
»Alles halb so schlimm. Ein Missverständnis«, beruhigte er die beiden.
»Also mir sind die Vereinigten Staate bereits verleidet«, beklagte sich Alabima, während sie zur Gepäckausgabe gingen und dort ihre Koffer, weit abseits der Transportbänder, neben dem Schalter für Verlorenes und Gefundenes erblickten.
»Ach, lass es einfach an dir abprallen, Liebling. Was denkst du denn, wie es den amerikanischen Geschäftsleuten tagtäglich auf den Flughäfen ergeht? Trägst du zufällig den falschen Namen, lässt dich die Heimatschutzbehörde kein Flugzeug mehr besteigen. Sie sperren dir vielleicht sogar deine Kreditkarten, nur weil irgendein Idiot auf dieser Erde denselben Namen wie du trägst und des Terrors verdächtigt wird.«
Sie zeigten der Angestellten ihre Gepäckscheine, durften dann die Koffer auf einen Kuli laden und gehen. Die Haltestation für den Bus zum Central Rental Car Service lag direkt beim Flughafenausgang und schon wenig später stiegen sie vor dem Schaltergebäude aus, bekamen ihren Wagen zugewiesen. Todmüde erreichten sie eine Viertelstunde später das Embassy Suites, checkten ein und sanken wenig später in ihre Betten und in einen nur wenige Stunden dauernden, unruhigen Schlaf.
*
Der nächste Morgen zeigte ein hellblaues Firmament, geschmückt mit wenigen, strahlend weißen Miniwolken. Vom sechsten Stockwerk des Hotels aus sahen sie über die meisten Dächer der Vorstadt hinweg. Sie wirkte staubig, ausgedörrt und irgendwie verlebt. Man fühlte die Hitze, welche die Häuser und Straßen jeden Sommer in Gefangenschaft nahm, die trockene, heiße Luft, die das Atmen schwer machte und jede Anstrengung verdoppelte.
Das Frühstücks-Buffet ließ kaum Wünsche offen und Alabima ermahnte ihren Ehemann mehrmals, forderte ein wenig Zurückhaltung. Sie selbst begnügte sich mit einem Teller mit Früchten und zwei Tassen Tee mit ein wenig Milch und ohne Zucker, während Jules dreimal zum Stand mit den Pancakes und dem Ahornsirup lief, unter den immer strenger blickenden Augen seiner Gattin. Alina aß brav den Bagel mit Frischkäse, den ihr die Mutter geschmiert hatte, trank den Orangensaft und die Tasse mit warmer Milch, wirkte aufgedreht und trotz der kurzen Nacht erfrischt, betrachtete neugierig die anderen Leute im Frühstücksraum, fragte ihre Eltern dies und das. Das schwarz gelockte, fröhliche Mädchen erntete von einigen der Tische freundliche Blicke. Ja, Alina war in ihrer natürlichen Ungezwungenheit ein amüsanter und bunter Punkt in der sonst eher von Missmut oder Kater beherrschten Frühstückslandschaft.
Chufu und Mei flogen von Rio de Janeiro über Mexico City ein, würden kurz nach zehn Uhr vormittags in Dallas ankommen. Genug Zeit für eine weitere Tasse Kaffee, wie Jules feststellte, bevor er noch eine letzte Runde zum Stand mit den laufend frisch zubereiteten Pancakes drehte und sich danach gespielt schuldbewusst unter dem Stirnrunzeln seiner Gattin wieder an den Tisch setzte und auch noch ein aber Papa, so viel ist doch ungesund seiner fünfjährigen Tochter über sich ergehen ließ.
Sie erreichten pünktlich und voller Vorfreude die Ankunftshalle, schlossen wenig später ihre beiden Brasilianer herzlich in die Arme, begrüßten sich überschwänglich, denn das letzte Mal hatte man sich zu Weihnachten, also vor mehr als vier Monaten gesehen.
*
Ihr Dogde Grand Caravan bot ihnen neben sieben Sitzplätzen genug Stauraum für die Koffer. Als erstes steuerte Jules einen Wal-Mart an, wo sie sich mit einer elektrischen Kühlbox, Getränken und ein paar Früchten ausstatteten. Die Kühlbox wurde über den Zigarettenanzünder angeschlossen, hielt die Lebensmittel frisch. Das gesetzte Tagesziel hieß Amarillo, die größte Stadt im Panhandle von Texas. Für die 360 Meilen würden sie knapp sechs Stunden benötigen, also erst gegen Abend eintreffen. Jules hatte im Big Texan zwei Zimmer reserviert. Sie wollten auch im Saloon-Restaurant Essen gehen und dort womöglich einem der Vielfraße zusehen, die das 72 Unzen schwere T-Bone-Steak bestellten. Es kostete fünfzig Dollar, war jedoch umsonst, wenn man es auf einem erhöhten Platz und innerhalb einer Stunde mit sämtlichen Beilagen verdrückte. Jules hatte sich vor Jahren selbst einmal an diesem gewaltigen Brocken Steak versucht, war jedoch kläglich gescheitert, hatte kaum die Hälfte geschafft, hatte sich damals mit der mangelhaften Qualität des Fleisches herausgeredet. Er beschrieb es als eindeutig zu sehnig, nichts für seinen empfindlichen Gaumen und einem Feinschmecker unwürdig. Jahre später sah er im Fernsehen zu, wie der kanadische Profi-Wettesser Peter Czerwinski, besser bekannt als Furious Pete, in Las Vegas ein über 100 Unzen schweres Steak innerhalb von vierzig Minuten verdrückte, zusammen mit einer ganzen Pfanne voller Bratkartoffeln. In der Erinnerung an sein damaliges Steak im Big Texan wurde ihm beim Anblick von Furious Pete, wie er sich riesige Fleischbrocken in den Schlund schob und kaum gekaut schluckte, noch einmal übel.
Für die kleine Alina waren Hotel und Saloon des Big Texan gleichermaßen eine Show. Das Motel war wie die Mainstreet einer Westernstadt gebaut, der Saloon wirkte authentisch und die Westernmusik überspielte die vielen Touristen in T-Shirts und Flip-Flops. Der Andrang an Besuchern war an diesem Abend jedoch enorm und Jules erinnerte sich mit Wehmut an die Gemütlichkeit seines letzten Besuchs hier vor mehr als zehn Jahren. Damals gab es noch keinen Biergarten, auch noch keinen Irrgarten und bloß einen kleinen Andenkenladen. Alles war mindestens zwei Nummern kleiner gewesen, drei Nummern bescheidener, um vier Nummern weniger touristisch.
Alina trug ihren Stetson jedoch so stolz wie Nachbars Fiffi seinen neuen Poncho, erklomm selbständig die Stufen zum riesigen Schaukelstuhl, den sie hinter dem Biergarten fanden, thronte dort oben vornehm wie eine Königin, hielt Hofstatt, blickte fröhlich lachend in die Kamera ihrer Mutter. Als ihr Tisch bereit war und sie die Menükarte studiert hatten, bestellten sie sich unterschiedliche Vorspeisen, um sie alle probieren zu können, und selbstverständlich Steaks als Hauptgang, dazu Wein oder Bier oder Eistee, je nach Lebensalter. Mei und Chufu erzählten von ihrem Studium und von Ereignissen innerhalb der Familie Ling. Alabima und Jules betrieben eher Small-Talk, erzählten nicht wirklich aus ihrem Leben und von den letzten Monaten. Zu frisch waren noch gewisse Wunden, deren Heilung mit Hilfe von Dr. Grey erst begonnen hatte. Und die beiden Psychologie-Studenten bohrten auch nicht weiter nach, verstanden die Zurückhaltung der Eheleute, wussten ja, dass Jules professionelle Hilfe in Anspruch nahm und dass Alabima große Hoffnungen auf eine positive Entwicklung setzte. Nicht immer war Reden die beste Medizin, auch nicht in der Psychoanalyse. Sie verbrachten eine erholsame Nacht in den bequemen Betten des Motels und selbst Jules schlief für einmal tief und fest.
*
Am nächsten Tag fuhren sie zum nahen Paolo Duro Canyon, mieteten sich auf der Ranch vor dem Eingang zum State Park Reitpferde. Für die fünfjährige Alina wurde ein lustiges, rotbraunes Pony gesattelt, die übrigen erhielten ausgewachsene Tiere. Mei Ling war mit Abstand die beste Reiterin unter ihnen, weil sie seit Kindesbeinen an auf dem Rancho ihrer Eltern in Brasilien Umgang mit Pferden hatte und oft ausgeritten war. Aber auch Chufu stellte sich beim Aufsatteln als echte Hilfe für die Cowboys und Cowgirls der Ranch heraus. Seit er Mei vor zwei Jahren kennengelernt hatte, verbrachten die beiden manches Wochenende auf dem riesigen Anwesen der Lings, weitab der Millionen-Metropole Rio de Janeiro.
Das erste Stück Weg führte äußerst steil in die Tiefen des Canyons. Alabima und Jules, die als letzte in der Kolonne ritten, verhielten ihre Pferde und sahen sich schweigend und zweifelnd an. Wie leicht konnte doch ein Pferd auf dem unbefestigten Weg und zwischen den Steinen ausgleiten und mit seinem Reiter in die Tiefe rutschen? Doch dann zuckte der Schweizer mit den Achseln, schnalzte laut und trieb sein Pferd mit leichtem Druck der Fersen auf die Flanken des Tieres an. Dieses setzte sich gemütlich und unaufgeregt in Bewegung, kannte bestimmt jeden Fußbreit Boden und fühlte sich trotz des ungeübten Reiters auf seinem Rücken völlig sicher. Das erste Stück wurden sie von einem der Cowboys des Mietstalls noch begleitet. Er führte auch das Pony von Alina das erste, steile Stück am Zügel mit, ritt ihnen allen voraus. Als sie jedoch alle unten in der Talsohle angelangt waren und er sicher war, dass die fünf gut mit den Pferden zurechtkamen, ließ er sie allein weiter reiten, nahm von ihnen nur noch das Versprechen ab, höchstens im leichten Trab zu reiten und niemals zu galoppieren. Der Canyon wäre dafür einfach zu eng und zu unübersichtlich.
Jules hatte allerdings den lahmsten Gaul der Welt abbekommen, wie er sich schon bald beschwerte. Doch der Schweizer hing auch wie ein nasser Sack im Sattel und sein Stormy fühlte sich unter dem ungeübten Reiter zunehmend unwohl, drehte immer wieder den Kopf zu ihm um und beäugte sich den seltsamen Gast misstrauisch und auch ungehalten. Für Alabima war der Ausritt gar eine Premiere und ihre Stute Sissi schien das auch zu wissen, schritt sie doch so vorsichtig wie nur möglich aus, setzte ihre Hufe sanft und gleichmäßig ab, ließ die Reiterin im Sattel nur leicht hin und her schwanken. Alina fühlte sich im Sattel ihres Ponys dagegen vom ersten Moment an sicher und frei wie Cowboy Jim bei seinem Feierabendritt in die Stadt und zum Saloon. Sie jauchzte in einem fort, was dem kleinen Tier unter ihr zu gefallen schien. Jedenfalls drehte es immer wieder seinen klugen Kopf zum Mädchen um, schien vom fremden Gast auf seinem Rücken überaus angetan, fiel zwischendurch und ganz von allein immer wieder in einen leichten, lustigen Trab und stellte zufrieden fest, dass sich seine Reiterin problemlos oben halten konnte.
Mei ritt ständig neben oder hinter Alina her, überwachte Pony und Reiterin, musste jedoch zur Freude aller kein einziges Mal eingreifen, so sittsam und vernünftig ging das Tier unter dem kleinen Mädchen.
Der Pfad führt sachte noch tiefer hinunter und in den Canyon hinein und bald schon tauchten sie vollends zwischen den Wänden der Schlucht ein. Das Grün des Talbodens lockte mit seinen Schatten, denn die Temperatur war an diesem Mai Morgen bereits beträchtlich angestiegen. Nach etwas über einer Stunde gelangten sie an einen schmalen Creek, der bloß eine Hand tief Wasser führte. Bei einer Sandbank saßen sie ab, Mei und Chufu elegant, Jules und Alabima steifbeinig, Alina mit einem mutigen Sprung, bevor ihr Mei helfen konnte. Die Tiere banden sie unter ein paar Bäumen fest, setzten sich im Schatten einiger Felsen und Büsche nieder. Alabima begann das aus der Stadt mitgebrachte Picknick zu verteilen und wenig später biss die Familie von gebratenen Hühnerschenkeln ab, mampfte dazu Maisbrot und spülte alles mit Wasser hinunter.
Nach der Mahlzeit ging Alina sogleich wieder zu den Pferden, strich ständig um sie herum, redete mit jedem einzelnen, klopfte Schenkel und Flanken, streichelte Nüstern. Alabima warf immer wieder einen besorgten Blick zur Tochter hinüber, wirkte doch das kleine Mädchen zwischen den riesigen Tieren wie ein Gnom, der leicht übersehen und unabsichtlich getreten werden konnte.
»Mach dir keine Sorgen, Alabima.«
Mei hatte den Blick der Äthiopierin richtig gedeutet.
»Die Gäule sind lammfromm und passen zudem sehr gut auf. Schau, wie sie ihre Köpfe beständig drehen und wenden, um Alina ständig im Auge zu behalten. Und sie spitzen ihre Ohren, hören ihr aufmerksam zu. Sie schlagen noch nicht einmal mehr mit ihren Schweifen nach den Fliegen, nur um die Kleine ja nicht zu streifen.«
Alabima nickte der Chinesin verstehend und dankbar zu.
»Ist das nicht ein herrliches Leben?«, stellte Jules zufrieden fest, nachdem er den dritten Hühnerknochen in den Abfallsack geworfen, die Finger geleckt und an der Papierserviette abgewischt hatte. Danach legte er sich unter der Krone eines Baumes nieder, verschränkte die Arme hinter seinem Nacken, zupfte sich den Stetson über das Gesicht zurecht und war Sekunden später bereits eingenickt, wie seine regelmäßigen Atemzüge den anderen verrieten.
Alabima, Mei und Chufu unterhielten sich weiter im Flüsterton.
»Und wie stets mit eurem Studium? Irgendwelche anstehenden Semesterarbeiten?«
Mei seufzte und Chufu verdrehte theatralisch die Augen.
»Ja, in zwei Monaten ist ein Essay über die Psychoanalyse fällig. Es soll über die Traumdeutungen von Freud handeln und muss sie mit modernen Erkenntnissen verbinden oder von ihnen abgrenzen.«
»Der Titel der Arbeit lautet: Freud versus Hobson, Gegensätze und/oder Gemeinsamkeiten«, pflichtete Mei ihrem Freund bei und fügte seufzend an, »schon Generationen von Studenten mussten über genau dieses Thema ihre Aufsätze schreiben. Und so findest du mehrere hundert Abhandlungen in der Uni-Bibliothek. Was soll einem da noch Neues einfallen?«, schloss sie ihren Ärger mit einer hilflosen Frage ab.
»Jede Zeit kann doch aus ihrem spezifischen Blickwinkel heraus immer wieder dieselben Tatsachen und Ereignisse neu betrachten?«, meinte Alabima augenzwinkernd, »immerhin schreiten Wissenschaft und Forschung laufend voran und so verschieben sich die Ausgangspunkte ständig. Oder sehe ich da etwas falsch?«
Chufu pflichtete seiner Adoptivmutter zu.
»Ja, da liegst du bestimmt richtig. Doch wir sind achtzig Studenten im selben Kurs und jeder soll sich was Anderes aus seinen Fingern saugen.«
»Ist vielleicht nicht das Thema, sondern ihr Beiden das wirkliche Problem?«, fragte die Äthiopierin keck zurück.
»Wie meinst du das, Alabima?«
Mei schien irritiert und interessiert zugleich.
»Na, ihr zwei hockt doch beständig aufeinander und tauscht euch über alles und jedes miteinander aus. Kein Wunder, dass euch nur das einfällt, womit sich bereits der Partner beschäftigt. Ihr blockiert euch wahrscheinlich gegenseitig.«
Chufu und Mei schauten einander zwei Sekunden lang an. Dann prusteten sie beide so laut los, dass Jules aus seinem Nickerchen aufschreckte.
»Was is?«, fragte er verwirrt in die Runde.
Chufu beruhigte sich früher als Mei.
»Deine Ehefrau ist der Meinung, Mei und ich würden beständig aufeinander hocken und uns dabei austauschen.«
Noch verwirrter blickte Jules fragend zu Alabima hinüber.
»Hab ich was verpasst?«
»Nein, nein. Die Kinder reden bloß Unsinn. War dein Power-Napping erholsam?«
»Etwas gar kurz. Aber was soll’s.«
Jules setzte sich auf.
»Ist noch ein Hühnerschlegel da oder haben wir alle verputzt?«, fragte er Alabima.
»Du wirst noch zum Vielfraß, Jules«, wehrte sie erst lächelnd ab. Doch Jules deutete auf seinen nicht vorhandenen Bauch. Die überwundene Krebserkrankung, die Chemotherapien und Bestrahlungen hatten ihm über Monate den Appetit verdorben und er verlor über ein Dutzend Kilogramm an Körpergewicht. Fünfundsiebzig Kilogramm waren sein Idealgewicht. Immer noch schwankte er zwischen fünfundsechzig und siebzig.
»Da, Hasso, fass«, rief seine Ehefrau fröhlich lachend und warf ihm ein Hühnerbein zu. Geschickt fing sich Jules die Beute mit der rechten Hand aus der Luft, brachte gar das Kunststück fertig, sich den wirbelnden Schlegel mit zwei Fingern am dünnen Ende zu packen. Triumphierend hielt Jules seine Beute hoch. Mei war von dieser Geschicklichkeit sichtlich fasziniert und auch Chufu spendete verhaltenen Applaus.
»Du kannst jederzeit als Jongleur im Flohzirkus auftreten«, meinte der gebürtige Philippine betont gönnerhaft zu seinem Adoptivvater.
»Während du im selben Zirkus höchstens als Kutscher taugst«, gab Jules gespielt bissig zurück, »auch dir würde wieder etwas mehr Training der Reflexe guttun. Treibst du noch Kampfsport?«
»Nein, nicht mehr«, beeilte sich Chufu klar zu stellen, und fügte mit einem schelmischen Seitenblick auf seine Freundin hinzu »höchsten noch mit Mei. Aber Spaß beiseite. Das Surfen auf dem Meer und die Ausritte mit Mei genügen vollkommen, um fit zu bleiben. Ich will dir nicht zu nahetreten, Jules, doch schau dir einmal deine Hände an.«
Der Schweizer blickte auf seine Finger hinunter, sah die dicken, knorpeligen Gelenke, wie sie das jahrelange Teak-Wan-Do Training an den harten Holzpflöcken hinterlassen hatte. Kräftig waren sie ohne Frage, seine Hände und Finger. Aber sie sahen auch irgendwie alt und verbraucht aus. Insgeheim fürchtete sich Jules schon seit Jahren vor der immer stärker spürbaren Arthrose. Sie würde ihm mit zunehmendem Alter bestimmt zu schaffen machen, darüber war er sich spätestens seit seinem Besuch bei einem Rheuma-Spezialisten im vergangenen Jahr gewiss. Vielleicht war das der eigentliche Grund, warum der Schweizer seinem Adoptivsohn keine spitze Antwort zurückgab, sondern bloß mehr zu sich als zu ihm meinte: »Ja, vielleicht hast du Recht, Chufu.«
Alabima beobachtete ihren Ehemann während diesen Sekunden des gegenseitigen Foppens sehr genau, musterte seine Gesichtszüge, behielt auch seine Körperhaltung und seine Gestik in Erinnerung. Ja, Jules war noch immer nicht gesund, sondern erst auf dem Weg zur Genesung, erschien ihr ungewohnt verletzlich und verunsichert. Vielleicht war es aber auch einfach das Alter, das wohl jeden Menschen veränderte, ihn in seinen Gedanken langsamer machte, ihn mehr abwägen und weniger spontan handeln ließ. Sie hoffte zumindest, dass dies bei Jules so war.
*
»Der Idiot hatte uns bestohlen«, sagte Ollie Oldman McPhearsen mit kalter, harter Stimme, fügte dann in einem unversöhnlichen Ton hinzu, »uns!«, wobei er wohl eher mich meinte.
Seine beiden Söhne saßen mit ihrem alten Vater am Mittagstisch, waren aus der Hauptstadt zum Oldman geeilt, als sie heute Morgen von der Ermordung ihres Vetters Patrick aus der Zeitung erfahren mussten.
»Dann hast du...?«, meinte Silver erschüttert.
»Er hat uns bestohlen. Hast du nicht zugehört?«, blieb sein Vater bei seiner Begründung.
»Und wie hat er das angestellt?«, fragte nun Reginald kühl. Der ältere der beiden Brüder schien interessiert zu sein. Einen Moment lang sah es jedoch so aus, als ob ihm der Oldman nicht antworten wollte. Doch dann hob er kurz seine rechte Hand, ließ sie wieder auf das Tischtuch fallen.
»Er ließ aus den Büroräumen an der Regent Street alle wertvollen Bilder durch Kopien austauschen, der Drecksack, wollte die Gemälde unter der Hand verscherbeln, das verdammte Arschloch. Hätte wohl 1,5 Millionen Pfund rausschlagen können.«
»Und wie bist du dahintergekommen?«
Reginald fragte dies, weil sein Vater kaum mehr Bedfort Castle verließ und die verschiedenen Firmensitze ihrer Unternehmen in London seit mehreren Jahren nicht mehr besucht hatte. Die Frage schien den Alten zu amüsieren, denn er lachte kurz und trocken auf.
»Ha. Der Dummkopf bot eines der Bilder doch tatsächlich Edward an, Edward Healing. Der hat es erkannt und mich unverzüglich unterrichtet. Ich hab dann Patrick hierher befohlen und ihn ein wenig ausgequetscht. Er hat auch sofort alles gestanden, das Weichei, hat mich danach angefleht, ihm zu verzeihen und ihn nicht rauszuwerfen, der Idiot.«
Und dann fügte Oldman etwas an, das selbst seine beiden abgebrühten Söhne zusammenzucken ließ.
»Patrick war wie sein Vater. Derselbe Schwächling.«
Reginald und Silver wussten einigermaßen Bescheid darüber, was Rupert McPhearsen in all den Jahren für den Familienkonzern auf sein Gewissen genommen hatte, wie viele Unfälle er in die Wege leiten ließ, um Konkurrenten zu schädigen, wie viele Unglücksfälle über die Angehörigen von geschäftlichen Widersachern durch seine Hand hereinbrachen. Ollie Oldman McPhearsen saß in all der Zeit wie die Spinne in ihrem Netz und spannte weitere Fäden, wartete ab, was sich darin verfing, stürzte sich auf jede Beute. Für die eigentliche Drecksarbeit hatte er jedoch seinen jüngeren Bruder Rupert vorgesehen, hatte ihn zeitlebens benutzt und ausgenutzt, bis diesem die Nerven und die Seele vollends verbrannt waren und er sich eine Kugel in den Schädel jagte.
Als damals der Oldman vom Selbstmord seines jüngeren Bruders erfuhr, hatte er bloß kurz die Nase gerümpft, zwei Sekunden lang nachgedacht und dann die Verschleierung der Todesursache befohlen. Denn ein McPhearsen beging keinen Selbstmord. Nicht mal zur Beerdigung seines Bruders war er gegangen, hatte an diesem Nachmittag Wichtigeres zu tun.
Silver spürte einen Schauder über seinen Rücken kriechen, angesichts eines Vaters, der völlig gefühllos und unversöhnlich am Tisch hockte, ähnlich einem Geier, der auf ein verletztes Tier starrte, das sich am Boden im Todeskampf windete, sich aber bald einmal strecken musste und für ihn die nächste Mahlzeit abgab.
»Wirft der Mord nicht zu viel Staub auf?«
Reginalds nüchterne Frage bewies Silver einmal mehr, wer der härtere von ihnen beiden war.
Der Alte schüttelte verneinend den Kopf.
»Alles diskret über del Mato organisiert, so wie immer. Hat dafür einen Spezialisten aus Moskau einfliegen lassen.«
Lawrence del Mato stammte aus Frankreich, lebte jedoch seit Jahrzehnten in London, betrieb eine kleine, verschwiegene Kanzlei, organisierte für seine reichen Klienten alles, was sich diese nur wünschten und ihm angemessen bezahlten. Rupert McPhearsen war sein wichtigster Klient gewesen. Nach dessen Tod hatte ihn jedoch Ollie Oldman McPhearsen übernommen.
Reginald schien über die Antwort seines Vaters zufrieden und beruhigt, während sich Silver fragte, wie gut er den eigenen Bruder eigentlich kannte. Sie lagen bloß drei Lebensjahre auseinander, hatten in ihrer Kindheit und auch als Jugendliche jedoch wenig miteinander anzufangen gewusst, wurden von den Eltern die ersten Jahre mehrheitlich getrennt aufgezogen, Reginald vom Vater, er von der Mutter. Vielleicht war darum sein älterer Bruder skrupelloser, war vom Oldman besser auf sein künftiges Leben hin gedrillt worden.
Nicht selten bewunderte Silver den Bruder für seine augenscheinliche Gewissenlosigkeit. Dort, wo er, der jüngere, zurückschrak, übernahm Reginald die Führung ohne Zögern, sorgte für Ordnung, löste alle Probleme. Wie kürzlich bei diesem Streik in der Werft in Glasgow. Silver wollte mit der Gewerkschaft verhandeln, Reginald ließ dagegen ein paar Familienmitglieder der Anführer bedrohen und verprügeln, drohte mit weiteren Konsequenzen, machte gleichzeitig ein Angebot, mit der die Gewerkschaft ihr Gesicht wahren konnte.
»Eine Hand wäscht nicht die andere, das ist Nonsens«, hatte Reginald später lachend zu ihm gesagt, »die Hand, die härter und konsequenter zuschlägt, die gewinnt in der Regel.«
Silver bewunderte die zumindest nach außen gezeigte Sicherheit und Entschlossenheit seines Bruders. Er würde einmal die Nachfolge vom Oldman antreten, wenn der Alte nicht mehr konnte. Und das war gut so, für das Unternehmen und für die Familie.
»Und wie lautet deine Antwort?«
Die Stimme des Oldman richtete sich an Silver, wie dieser nun instinktiv spürte. Doch er hatte die eigentliche Frage gar nicht gehört oder zumindest nicht verstanden, war zu sehr in Gedanken gewesen.
»Was meinst du, …Vater?«
Das Vater hatte er nur zögerlich und nach einer Pause ausgesprochen und so biss sich Silver auf die Unterlippe, hoffte, dass der Alte nichts bemerkt hatte.
»Ich fragte dich, ob du die beiden Posten von Patrik zusätzlich übernehmen kannst? Viel hat er eh nicht gearbeitet, der faule, versoffene Hund. Das sollte für dich doch kein Problem sein?«
Silver nickte: »Nein, natürlich nicht, Vater, ich mach das.«
Diesmal kam die Anrede flüssig und sicher über seine Lippen. Doch er bemerkte den leicht spöttischen Blick seines Bruders auf sich ruhen.
»Ich leite die Übergabe heute noch in die Wege, beauftrage unsere Anwälte mit der Übertragung der Unterschriften«, warf Reginald ein, »wäre aber bestimmt gut, wenn du dich in den nächsten Tagen mal persönlich in den Büros zeigst.«
Als Leiter der Rechtsabteilung saß Reginald im eigentlichen Zentrum der Macht, erfuhr alles, was das Familienunternehmen betraf, beeinflusste oder veränderte.
Beinahe wie bei Vater und Rupert, dachte Silver mit einigem Erschrecken, Reginald sitzt im Hintergrund, spannt seine Fäden und lässt in zunehmendem Masse mich die Drecksarbeit erledigen. Auch die Idee für den Schlägertrupp in Glasgow kam von Reginald. Doch mit deren Organisation war Silver betraut worden.
Der Rest des Essens verlief schweigend oder exakter ausgedrückt brütend. Oldman McPhearsen brauchte sich nicht mit seinen Söhnen geschäftlich abzustimmen, denn er hatte vor seinem Rücktritt aus den Aufsichtsräten und Vorständen genügend Stabsstellen in all seinen Unternehmen geschaffen, die parallel zu ihrer Tätigkeit für die Firma die Arbeit seiner Söhne überwachten und ihm darüber berichteten. Manchmal wusste der Oldman sogar rascher und genauer Bescheid über ein aufkommendes Problem als seine Söhne. Und das rieb er ihnen immer wieder und noch so gerne unter die Nase, wollte ihnen so klar machen, wo sie sich noch zu verbessern hatten.
Nach dem Kaffee verabschiedeten sich Reginald und Silver wortkarg vom Vater. Der hob bloß seine rechte Hand zum Abschied, als würde er Lakaien entlassen.
Die beiden Brüder gingen den langen Flur entlang, nebeneinander, im Gleichschritt, sprachen nicht miteinander, blickten nur geradeaus und fixierten die breiten Türflügel des Portals, durch das sie endlich wieder aus dem auf Bedfort Castle überall spürbaren Zwang und eisernen Willen ihres harten Vaters entkommen konnten. Als sie die breite Sandsteintreppe hinunterstiegen, atmeten sie beide befreit auf, schüttelten sich an ihrem Ende kurz die Hände, wandten sich ihren Fahrzeugen zu.
Reginald hatte sich in einem Bentley herbringen lassen und sein Fahrer öffnete für ihn bereitwillig die Hintertür, drückte sie hinter ihm sanft ins Schloss, stieg vorne ein und fuhr sogleich los.
Silver war bei seinem Jaguar stehen geblieben, hatte sich eine Zigarette aus dem vergoldeten Etui gezogen und angezündet, sog ihren Rauch tief in seine Lungen ein, stieß ihn nur langsam, aber nicht mit sichtlichem Genuss wieder aus. Sein Rauchen wirkte eher so, als wollte er einen schlechten Geschmack aus seinem Mund, dem Rachen, der Luftröhre und seinen Lungen vertreiben, vielleicht das Fluidum von Bedfort Castle. Die Zigarette war noch nicht einmal zur Hälfte geraucht, da warf er sie zu Boden und trat ihre Glut aus, setzte sich hinters Steuer und fuhr los. Hart drückte er das Gaspedal durch und die Kieselsteine stiebten hoch in die Luft und bis zu den untersten Stufen der Steintreppe hinüber. Der Milliarden-Erbe war noch nicht durch das schmiedeeiserne Tor auf die Landstraße gelangt, als bereits ein Bediensteter mit Besen und Schaufel in der Hand aus einem der Nebengebäude eilte und mit dem Wegwischen begann.
*
»Hallo Schatz. Bist du zu Hause?«
Michael Langton hatte aufgeschlossen und war in den Flur getreten, der die einzelnen Räume des Apartments miteinander verband, rief seine Frage laut in Richtung des Wohnzimmers.
»Brüll doch nicht so herum«, kam eine recht gehässige Antwort durch die offenstehende Türe zurück.
Michael seufzte leise, hängte seine Lederjacke an einen Bügel und diesen an einem der Haken an der Garderobe auf, legte seinen Schlüsselbund in den schweren Vulkanstein-Aschenbecher auf der Ablage, ging in die kleine Küche hinüber, nahm sich eines der noch nicht gespülten Gläser vom Abtropfbrett und füllte es am Wasserhahn, trat damit zurück in den Flur und dann ins Wohnzimmer. Gin Davis lag auf der Couch und blätterte in einem Modeblatt. Sie blickte schräg an der Zeitschrift vorbei ihren Freund abwartend an, kaute dabei wie eine Kuh und blies dann einen Kaugummi zum Ballon auf, bis dieser platzte und sie die Überreste mit den Lippen und der Zunge wieder in ihren süßen Mund zurückschob.
»Erfolg gehabt?«
Ihre Stimme drückte keine Hoffnung aus, eher Häme. Michael schüttelte verneinend und resigniert den Kopf.
»Nein. Sie haben sich für einen anderen Makler entschieden, der wohl etwas günstiger war. Jedenfalls haben sie mir das in ihrer Absage geschrieben.«
Gin Davis setzte sich abrupt auf, starrte ihren Freund wütend an.
»Du Schlappschwanz. Du Niete. Wie haben sie dich denn diesmal ausgebootet? Haben sie wieder auf die Tränendrüse gedrückt? Oder was? Wie kannst du dich immer wieder von allen möglichen Leuten treten lassen, du Wurm? Du Versager. Du hast mir doch erzählt, sie hätten den Vorvertrag bereits unterzeichnet? Wie können sie dann noch abspringen? Los. Rede endlich.«
Sie war aufgesprungen, stand wie die Rachegöttin in Person vor ihm, starrte ihn zornig und aufgebracht an. Ihre Wangen hatten sich vor Wut gerötet und ihre Augen ließen Blitze in die seinen zucken. Herrlich lebendig war sie anzusehen, diese gertenschlanke Amazone, dieses wilde Weibsbild, diese Ausgeburt der himmlischen Hölle, wie Michael seine Freundin in Gedanken manchmal nannte, vor allem nach dem wilden Sex, mit dem sie ihn immer und immer wieder begeisterte, der alles von ihm forderte und ihm auch alles zurückgab.
Michael konnte die Verärgerung seiner Freundin durchaus verstehen. Denn immerhin hatte er ihr noch vor zwei Tagen versprochen, nach dem Abschluss des anstehenden Maklergeschäfts für sie die Fuchspelzjacke in der Boutique an der On Lan Street zu kaufen. Sobald der Vertrag über die Damenbinden unter Dach und Fach gewesen wäre, wollten sie zudem endlich wieder einmal groß Ausgehen, im Above & Beyond Essen gehen und dort vor all den schwerreichen Pinkeln angeben, danach im Beijing Club bis zum Morgengrauen tanzen. Doch nun kam er mit einer weiteren seiner Niederlagen zu ihr zurück. Überhaupt war sein neues Unternehmen äußerst zäh gestartet und kämpfte ums Überleben. Die Vermittlung von dreißig Millionen Damenbinden an eine große Drugstore Kette in den USA hätte ihm für das nächste halbe Jahr Miete und Essen bezahlt.
»Ach, Ginnie, sie konnten sich leider auf die Ausstiegsklausel beziehen. Ich musste nachgeben.«
»Und wie viel haben sie locker machen müssen?«
Ihre Frage klang kalt, aber auch gierig, aus ihrem sonst so süßen Mund, deren schmale Lippen in perfektes Dunkelrot getaucht waren, zugleich Sinnlichkeit wie Zügellosigkeit versprachen.
»Fünfzehnhundert US-Dollar«, gab er kleinlaut bekannt.
»Nur fünfzehnhundert? Warum nur fünfzehnhundert? Du hast gesagt, das Geschäft brächte dir mindestens Zwanzigtausend ein? Und dann speisen Sie dich mit fünfzehnhundert ab?«
»Sollte ich für ein paar Tausender mehr mit denen etwa vor Gericht ziehen?«
Das erste Mal an diesem Tag zeigte sich ein klein wenig Härte in seiner Stimme, auch wenn sie wohl weniger aus innerer Stärke, als vielmehr aus genervter Verzweiflung geboren war.
»Die sitzen letzten Endes doch eh am längeren Hebel, können den Fall über drei Instanzen ziehen und darauf warten, wie mir die Kohle ausgeht.«
Gin ließ sich auf das Sofa zurück plumpsen, beachtete ihren Freund nicht länger, starrte stattdessen auf den Fußboden, der mit einem langhaarigen, weißen Kunstfaserteppich ausgelegt war. Sie dachte angestrengt nach, war immer noch aufgebracht und wütend.
»Schau, Ginnie, wir gehen heute Abend trotzdem im Above & Beyond Essen. Ja? Wir lassen uns die Laune nicht verderben.«
Sie schaute nicht zu ihm auf, musterte weiterhin den Teppichflor zu ihren Füssen.
»Ich hab uns bereits einen Tisch reserviert. Auf acht Uhr.«
Hoffnung klang aus dem Mund von Michael Langton, die Hoffnung auf Ruhe und Frieden, auf Vergebung.
»Vergiss es, du Versager«, zischte sie ihn plötzlich an, sprang auf und eilte aus dem Wohnzimmer, verschwand im Schlafraum. Michael setzte sich seufzend auf das Sofa nieder, nahm einen Schluck aus seinem Glas, wirkte ausgebrannt und resigniert. Nach kaum einer Minute trat seine Freundin wieder in den Flur. Sie trug immer noch den enganliegenden Gymnastikanzug, hatte sich bloß einen modischen Rock darüber gezogen und trug die neuen, schwarzen High-Heels mit den Pfennigabsätzen, dazu die ultrakurze, schwarze Lederjacke.
»Wart nicht auf mich«, rief sie ihm zu, ohne ihn anzusehen, zog bereits die Haustüre auf, »ich bin bei einer Freundin.«
Sie warf die Tür hinter sich laut knallend zu.
Endlich begann Michael Langton innerlich zu kochen, nun, da seine Freundin nicht mehr in der Nähe war, er ihre starke Präsenz und Persönlichkeit nicht mehr spürte, auch nicht sein Verlangen nach ihrem Körper, ihrem Mund, den kleinen, ach so festen Brüsten mit den langen, harten Nippeln, nach ihrer nicht rasierten, jedoch kurz geschnittenen Scham mit dem glatten, drahtigen Haar, das sich frisch gestutzt wie die Borsten eines Ferkels anfühlten, das Michael vor vielen Jahren beim Besuch eines Streichelzoos auf seinen Armen tragen durfte. Bei diesem Gedanken verflog seine Wut auf die Freundin auch schon wieder. Wie schön war es doch, mit einer solch attraktiven Frau zusammen zu leben, immer wieder heißen Sex mit ihr zu haben und auf der Straße und in den Geschäften von allen Männern bestaunt und beneidet zu werden. Nein, er konnte seiner Ginnie nicht wirklich böse sein. Sie hatte im Grunde genommen auch Recht.
*
Jules wollte an diesem Abend im Stockyard Café das beinahe berühmte Fried Chicken Steak mit viel Gravy essen gehen. Doch Alabima war dagegen und schlug stattdessen das Denny’s Family Restaurant vor. Als ihr Gatte protestierte, entschied sie resolut: »Unsere Tochter braucht heute ein paar Kohlenhydrate und Vitamine, nicht bloß Eiweiß und Fett, basta«, fügte aber versöhnlicher hinzu, »wir können doch gleich Morgen dort Frühstücken gehen. Dann kannst du dein Fried Chicken Steak immer noch verputzen, okay?«
Und so saßen sie wenig später in einer der Sitzecken des Denny’s und studierten die Karte. Während der Kellner ihre Bestellung aufnahm, schoss Jules auf einmal ein Gedanke durch den Kopf, den er auch gleich aussprach: »Eigentlich könnten wir morgen ein weiteres Mal ausreiten, doch diesmal hoch zum Raton Pass. Na, wie wär’s?«
Mei, Chufu, Alabima und selbst Alina sahen den Schweizer gleichermaßen gespannt und abwartend an, wobei Chufu und Alabima eher negativ, Mei und Alina eher positiv gestimmt schienen.
»Ach, ihr kennt ja nicht all die Geschichten um diesen berühmten Pass, der zum legendären Santa Fe Trail gehört. G. F. Unger ist euch bestimmt auch keine Begriff? Nein? Also gut. G. F. Unger ist der erfolgreichste Western-Autor der deutschen Sprache. Er hat mit seinen Erzählungen über den Wilden Westen eine weit höhere Auflage erreicht als Karl May mit seinen Winnetou und Old Shatterhand-Geschichten. G.F. Unger war der Held meiner Jugend, ich meine, als Schriftsteller. Alle zwei Wochen kam ein neues Romanheft heraus und ich hab sie geradezu verschlungen.«
»Romanheft? Etwa Schundromane, Jules?«, fragte Chufu spöttisch lächelnd.
»Was sind Schundromane?«, wollte Alina sofort von ihrer Mutter wissen.
»Das sind kurze Romane, nur ein paar Dutzend Seiten lang, keine richtigen Bücher.«
»Und warum werden sie Schundromane genannt? Schund ist doch etwas Schlechtes?«
Diesmal antwortete Jules seiner Tochter.
»Weißt du, Alina, Romane werden von den Kritikern in wertvolle und wertlose Geschichten unterteilt. Die langweiligen Geschichten sind in ihren Augen die wertvollen, während die wirklich spannend erzählten die schlechten sein sollen.«
Alina sah ihren Vater aus großen Augen an, konnte als Fünfjährige mit dem Sarkasmus oder Zynismus eines Erwachsenen noch nichts anfangen. Darum ergänzte ihre Mutter erklärend: »Es kommt dabei vor allem auf die Sprache und die Tiefe der Geschichten an. Auf sechzig kurzen Seiten kannst du keine so komplexe Geschichte erzählen, wie auf fünfhundert. Und während ein Romanautor oft mehrere Jahre an einem einzigen Buch arbeitet, hat dieser G.F. Unger alle zwei Wochen eine neue Western-Story geschrieben. Diese Kurzgeschichten können darum nicht dieselbe Qualität aufweisen, wie ein langer Roman.«
Die Kleine nickte nun, halb verständig, halb zufrieden.
Ihre Vorspeisen wurden aufgetragen und so schwiegen alle für einen Moment. Doch als sie zu essen begonnen hatten, fragte Chufu doch nach.
»Und was hat es nun mit diesem Raton Pass und deinen Westerngeschichten auf sich? Erkläre dich uns, lieber Jules. Warum willst du uns bei Hitze und Staub schon wieder in die Sättel jagen?«
Jules legte die Gabel beiseite, schluckte den letzten Bissen herunter, so wichtig war ihm seine Antwort.
»Der Raton Pass verbindet New Mexiko mit Colorado. Über ihn führte lange Zeit die einzige Straße für die Postkutschen und Frachtwagen, die den Norden und damit die Goldfundgebiete mit dem Südwesten verband. Und er wurde immer wieder von Apachen besetzt und gesperrt. Der gesamte Waren- und Personenverkehr kam dann für Tage oder gar für Wochen zum Erliegen. Die Reisenden und Frachtfahrer mussten oft auf eine größere Armee-Patrouille warten, die ihnen den Pass frei kämpfen und eine Zeit lang die Verbindung offenhalten konnte, bis die nächste Indianerhorde ihn wieder sperrte.«
Das fragende Gesicht von Chufu drückte wohl das aus, was auch die beiden Frauen beschäftigte. Doch als Jules nicht von sich aus auf seinen Blick reagierte, fragte der Philippine direkt nach.
»Und warum sollen wir morgen dort hinaufreiten? Wird er immer noch von Indianern gesperrt oder was gibt es dort sonst zu schauen?«
Der Schweizer verzieh seinem Adoptivsohn die Anzüglichkeit, nickte ihm sogar lächelnd zu.
»Ich dachte bloß, es wäre schön, einmal diesen Ort mit eigenen Augen zu sehen, einen Platz, den G. F. Unger in mehreren seiner über siebenhundert Romanen beschrieben hat, wo Männer und Frauen gekämpft haben und gestorben sind.«
»Aha«, meinte Chufu völlig ruhig, »Bewältigung von Kindheitserinnerungen.«
Dabei blickte er auffordernd seine Freundin Mei an, so als bemühte er sich als Psychologe bei einer Kollegin um eine Zweitmeinung. Die Chinesin lächelte verschmitzt zurück, warf auch einen schelmischen Seitenblick auf Jules und antwortete: »Sie wissen ganz genau, wie negativ die Stimmungslage Ihres Patienten beeinflusst wird, wenn Sie ihm nicht wenigstens ein paar Schritte entgegenkommen, Professor Lederer.«
Während die beiden sich fröhlich lachend anschauten, blickte Alabima eher besorgt auf ihren Jules. Denn der lachte nicht mit, sondern schien in sich gekehrt, saß stumm da und blickte auf seine Mozzarella Cheese Sticks, die ihm nicht mehr schmeckten. Auch Alina schien zu spüren, dass etwas nicht stimmte, sah ihren Vater mit etwas verstörten Augen an, dann hinüber auf Chufu und Mei und wie fröhlich die beiden dreinschauten, während ihre Eltern recht traurig auf sie wirkten.
*
Die Vorstandssitzung dauerte über drei Stunden. Danach verabschiedete Reginald McPhearsen alle Mitglieder des Gremiums mit Händedruck und ein paar Worten. Nur Silver blieb im Sitzungsraum zurück, hatte sich an die Fensterfront gestellt, blickte hinaus und auf die Themse herab. Als alle anderen gegangen waren, drehte sich Reginald zu ihm um, ohne etwas zu sagen. Eine Sekretärin steckte ihren Kopf ins Zimmer, wollte wohl etwas von einem der beiden, sah die Brüder dort stehen, den einen nachdenklich am Fenster, den anderen dessen Rücken anblickend, spürte die Spannung und zog sich rasch zurück, schloss auch die Türe unhörbar leise.
»Alioth treibt ein falsches Spiel.«
Silver sprach die Worte in Richtung Themse, sah noch immer nicht auf seinen Bruder.
»Wie meinst du das?«
Reginald trat neben Silver, schaute nun ebenfalls hinaus, verfolgte mit seinen Augen ein Frachtschiff, wie es sich gegen die Strömung stemmte und langsam am Bürogebäude an der Canary Warf vorbeizog.
»Im Club hat mich Arthur Hicks angesprochen. Er erzählte mir, dass er Alioth vor ein paar Tagen am Hauptsitz von Hector & Clide sah.«
»Alioth?«, fragte Reginald unnötigerweise zurück, sah seinen Bruder von der Seite her an. Der nickte, schaute ihn jedoch immer noch nicht an.
»Ja, der gute Alioth will uns wahrscheinlich in die Pfanne hauen.«
Reginald blickte sich im leicht spiegelnden Fensterglas an, sah jedoch nicht sich, sondern den mittelgroßen Alioth Milkins vor sich, mit seiner Halbglatze und den pomadisierten Haarsträhnen, die er sich stets sorgfältig über die Blöße kämmte, sah auch die dickrandige, schwarze Hornbrille mit den recht kleinen Gläsern, die ihn wie einen intellektuellen Architekten ausschauen ließ, zudem seine flinken, manchmal unsteten Augen, die so gar nicht zu seiner Tüchtigkeit passten. Alioth Milkins war seit über zehn Jahren Vorstandsmitglied in zahlreichen Unternehmen ihres Familienkonzerns, hatte sich stets mit vollem Einsatz eingebracht, viele gute Ideen und Strategien entwickelt, mit denen sie Dutzende von Millionen Pfund eingespart oder verdient hatten. Besonders stark war Alioth in der Umsetzung von anspruchsvollen Turnarounds, hatte mehr als einmal ein schlingerndes Unternehmen als CEO übernommen und rasch wieder auf Kurs gebracht. Und nun sollte dieser Alioth Milkins ein falsches Spiel mit ihnen treiben, sie hintergehen und mit der ärgsten Konkurrenz im Energiesektor zusammenarbeiten?
»Das muss nichts zu bedeuten haben«, stellte Reginald deshalb erst einmal fest und blickte wieder hinüber zum Bruder.
Doch Silver schüttelte verneinend den Kopf.
»Ich hab mich weiter erkundigt und auch eine Detektei auf ihn angesetzt. Alioth hat Schulden, hohe Schulden. Er scheint finanziell am Abgrund zu stehen.«
»Wie das?«
»Was weiß ich. Wahrscheinlich verspekuliert. Er soll viel Geld mit Madoff Fonds verloren haben und zudem über Kredite zahlreiche spekulative Schiffsbeteiligungen in Deutschland besitzen, die stark an Wert verloren haben. Alioth war wohl für einmal zu gierig gewesen oder wurde auf dem falschen Fuß erwischt. Sein Schloss in Sussex ist mit Hypotheken so sehr zugedeckt, dass seine Hausbank bereits die Übernahme mit ihm verhandelt. Und seine Villa auf Gran Canaria steht zum Verkauf. Unter Preis, wie mir ein lokaler Immobilienhändler versichert hat.«
»Aber warum bittet er dann nicht uns um Hilfe?«
Silver hob seine Schultern, ließ sie wieder fallen.
»Würdest du deinen Geschäftsfreunden gegenüber eine Schwäche zugeben? Solange du irgendwelche Alternativen hast? Stolz ist vielen Menschen immer noch das Wichtigste, steht vor der Vernunft oder der Sicherheit.«
Reginald schwieg, sah einem weiteren Frachtschiff entgegen, das rasch stromab fuhr.
»Aber sich an den Feind verkaufen?«
Silver antwortete seinem Bruder nicht, meinte stattdessen bloß: »Oldman?«
»Lass den Alten bloß aus dem Spiel«, die Stimme von Reginald klirrte vor Härte. Als älterer Bruder hatte er in ihrem Zweiergespann schon immer die Führerschaft beansprucht. Doch dann fügte er seltsam sanft hinzu: »Ich regle das persönlich mit Alioth.«
Silver kannte die starken Gemütsschwankungen von Reginald. Sie begleiteten ihn seit Kindesbeinen an. Schon als Knirps war er in gewissen Dingen störrisch wie ein Esel gewesen, ließ sich weder mit Worten noch mit Strafen überzeugen. Und dann kehrte er doch plötzlich seine Meinung um, passte sich an, ordnete sich unter. Es war, als wenn er sich innerlich selbst zur Raison rufen konnte, als bestünde er aus zwei völlig verschiedenen Menschen, die immer wieder miteinander kämpften und wo einmal der jähzornige, ein andermal der kaltblütige die Oberhand behielt.
Silver blickte das erste Mal von der Themse auf und kurz zum Bruder hinüber. Reginald schaute starr hinaus und so folgte Silver seinem Blick. Denn Reginald schaute nicht etwa auf den Fluss hinunter, auch nicht auf ein gegenüberliegendes Gebäude, sondern in die tiefhängenden Wolken, die sich in stürmischen Böen immer wieder zusammen bauschten und gleich wieder zerpflückt wurden, als ein ständiger Kampf der Elemente.
Eigentlich hatte Reginald Zeit seines Lebens schlussendlich stets das bekommen, was er wollte, ob im Streit und Kampf oder im Nachgeben und Verhandeln. Irgendwie konnte sein Bruder alle Widerstände überwinden. Als Junge unterlag er zwar noch oft in einer Auseinandersetzung, musste erst lernen, wann der Trotz und wann die List zum Ziel führte. Doch schon als Teenager beherrschte er die halbe Familie, spielte die Angestellten in der Küche gegen diejenigen im Hausdienst aus, zettelte gar einen Faustkampf zwischen dem Gärtnerlehrling und dem frisch eingestellten, jungen Chauffeur an. Über Wochen redete er dem Gärtnerlehrling ein, der Chauffeur würde durch seine rücksichtslose Fahrweise immer wieder ganze Kübel voller Kieselsteine über Rasen und Blumenrabatten verteilen. Dabei war es Reginald selbst, der in unbeobachteten Momenten mehrmals und von Hand die Steine in die Beete wischte. Der Gärtner in Ausbildung wurde jedoch immer wütender, bis es zum Ausbruch und der Schlägerei kam.
Silver hatte damals seinen älteren Bruder nach seinen Gründen für die Intrige gefragt und Reginald hatte gemeint, der Chauffeur hätte ihn vor ein paar Wochen verächtlich behandelt. Zu dieser Zeit lebten noch Wachhunde auf Bedfort Castle und einer von ihnen war an diesem Morgen aus seinem Zwinger entkommen und laut bellend auf den älteren Bruder zugesprungen. Der flüchtete sich laut um Hilfe schreiend ins Haus, während er vom Chauffeur beobachtet und ausgelacht wurde.
Nach dem Faustkampf fehlten dem jungen Fahrer zwei Zähne und der Gärtnerlehrling beklagte einen gebrochenen Mittelfinger. Oldman warf beide fristlos hinaus. Als er seinen Entscheid den beiden Söhnen beiläufig mitteilte, beobachtete Silver seinen Bruder ganz genau. Reginalds Gesicht zeigte keinerlei Regung, weder Befriedigung noch Schuldgefühle. Der Ältere der McPhearsen Brüder schien keinerlei Empfindung zu kennen. Hatte er seinen Groll gegen den jungen Fahrer bereits wieder vergessen? Oder hatte er damals schon seine eigenen Regeln aufgestellt? Ein verhöhnendes Lachen gegen zwei Zähne und den Verlust der Arbeitsstelle getauscht? War das der Anspruch seines Bruders an eine ausgleichende Gerechtigkeit?
»Und wie?«
Eine Ewigkeit schien seit dem letzten Satz von Reginald vergangen zu sein und die Frage von Silver klang deshalb kläglich und ohne jeden Zusammenhang, hing darum einsam im Sitzungsraum. Doch die Antwort des Älteren folgte ohne Zögern: »Das geht dich diesmal nichts an.«
Silver war trotzdem zufrieden, auch wenn er wusste, dass dieses Gefühl eigentlich das falsche war. Doch Reginald war schon immer der Bestimmende von ihnen beiden gewesen, derjenige, der sich auch ein paar Mal großzügig den Problemen des jüngeren Bruders angenommen hatte und sie für ihn auflöste oder klärte. Wie damals, als er mit einem der McIntier Brüder ohne richtigen Grund Streit bekam. Wenig später waren während des Sportunterrichts Hose, Socken und Schuhe aus seiner Umkleidekabine verschwunden und Silver fand sie später auf dem Pausenplatz über die Büsche verteilt. Sein halbnacktes Zusammensuchen seiner Sachen wurde vom hämischen Gelächter des McIntier Anhangs begleitet und Silver fühlte sich entehrt. Reginald sorgte damals nicht nur für die Entlarvung des Missetäters Freddy. Er suchte sich auch ein paar Kollegen zusammen, mit denen er dem verdammten Kerl auf dem Nachhauseweg auflauerte und ihn windelweich prügelte. Die Eltern von Freddy beklagten sich damals bei der Schulleitung, schalteten sogar die Polizei ein. Ein Constable hatte daraufhin ihre Klasse besucht und die Schüler über den Vorfall befragt. Alle hatten geschwiegen, auch diejenigen, die etwas wussten. Und selbst Freddy blieb stumm, verweigerte jede Aussage. So tief war ihm der Schrecken ob der erhaltenen Schläge in die Knochen gefahren.
Dass sich Reginald persönlich um Alioth kümmern wollte und sein Bruder nicht ihn damit beauftragte, konnte wohl nur eines bedeuten. Sein Bruder wollte ihm nicht sämtliche Drecksarbeit aufbürden, nicht so wie ihr Vater seinem jüngeren Bruder Rupert. Silver verspürte ein warmes Gefühl in seiner Brust.