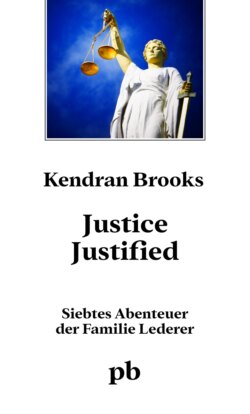Читать книгу Justice justified - Kendran Brooks - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Indianer
ОглавлениеDie V7 Ranch in Raton bot neben Jagderlebnissen auch Ausflüge zu Pferd an. Sie wurden mit dem Eigentümer rasch einig und zogen schon bald auf ihren Gäulen auf Seitenstraßen durch das ruhige, verkehrsarme Städtchen. Chufu hatte irgendwo im Internet die Beschreibung des Weges zum ursprünglichen Passaufstieg gefunden und so führte er zusammen mit Mei ihren kleinen Zug an. Nach einer halben Stunde Wegstrecke verließen sie die letzten Häuser des Ortes, stiegen die schlängelnde Straße immer höher hinauf, die sie zum Old Raton Pass bringen sollte. Bereits nach wenigen Kehren hatten sie eine ansehnliche Höhe erreicht, konnten die verschiedenen Taleinschnitte erkennen, blickten hinüber zur Interstate 25, die sich rund zwei Meilen östlich der alten Passstraße durch die Berge gepflügt hatte, sahen auch das Bahntrasse, das denselben Sattel wie die Schnellstraße benutzte. Doch wenig später verloren sie beide Verbindungslinien nach Colorado aus den Augen, gerieten immer tiefer hinein in eine noch wilde Bergwelt, die selten von Fahrzeugen besucht wurde. Längst war die geteerte Straße zum breiten Naturweg geworden, zu einer Strecke für Four Wheel Drives und High Clearance Wagen. Die Schotterstraße blieb recht breit und so konnten sie die meiste Zeit über gemütlich nebeneinander reiten und miteinander plaudern.
Jules lenkte seinen Gaul jedoch immer wieder mal an den linken Rand der Straße, suchte den Hang neben und unter ihnen nach Hinweisen auf das ursprüngliche Trasse ab, fand mögliche Spuren eines noch älteren Zugangs zur Passhöhe. Er stellte sich auch die Postkutschen und Frachtwagen vor, die sich noch vor hundert Jahren mühsam jede Kehre hatten erkämpfen müssen. Volle sieben Tag hatte damals eine Überquerung des Raton Pass gedauert und dies stets im Bewusstsein einer irgendwo möglicherweise lauernden, tödlichen Gefahr, die auf dieser Strecke jederzeit Opfer fordern konnte.
Was waren das wohl für Männer und Frauen gewesen, die ihr Leben riskierten, als Angestellte von Postunternehmen oder Transportdienstleistern, als Auswanderer und Siedler, Goldsucher und Glücksjäger? Waren die Menschen damals abgestumpfter gegenüber allen Gefahren gewesen? Hatten sie das Leben selbst als eine so große Bedrohung angesehen, dass sie keine Furcht vor dem eigenen Tod verspürten und sich darum auch allen Gefahren mutig stellen konnten? Oder war der Lebenskampf in diesem damals noch so wilden Land dermaßen hart, dass bloß fatalistisch gesinnte Menschen überhaupt bis hierher gelangten?
Selbstverständlich war Jules die Verklärung des sogenannten Wilden Westens vollauf bewusst. Um 1870 herum war beispielsweise jeder dritte Cowboy in Texas ein Afro-Amerikaner und jeder zweite mexikanischer Abstammung. Denn der Job eines Kuhjungen war körperlich sehr hart und gleichzeitig schlecht bezahlt, so dass ihn nur Menschen ausübten, die sonst kaum eine Chance auf dem Arbeitsmarkt besaßen. Schöne Western-Romantik, wenn man wegen drohendem Hunger oder fehlendem Dach über dem Kopf auf einer einsamen Ranch in den Hügeln versauerte, wo man über Wochen und Monate hinweg niemand anderen sah, außer die Arbeitskollegen und die Besitzerfamilie, wo man nebst Verpflegung, Unterkunft und Weidekleidung vielleicht noch dreihundert Dollar pro Jahr ausbezahlt erhielt und dies für vierzehn Stunden harter Arbeit sieben Tage die Woche.
Doch auch andere, gute Gedanken überkamen den Schweizer.
Erst auf dem Rücken eines Pferdes spürte man die Weite dieses Landes so richtig, empfand man den endlosen Himmel über sich als echte Freiheit, fühlte auch die wohltuende Langsamkeit. Im modernen PKW raste man an allem vorbei, legte in zwanzig Minuten so viele Meilen zurück, wie man früher an einem ganzen Tag vorwärtskam, startete man am Morgen in Dallas, um am Nachmittag in Amarillo einzutreffen, eine Wegstrecke, für die ein Frachtwagenzug vor hundertfünfzig Jahren volle drei Wochen unterwegs gewesen war.
Die Langsamkeit der Pferde, Maultiere und Ochsen war im Grunde genommen Lebensqualität pur, ein physikalisch erzwungenes Herunterfahren jeglicher Hektik. Dies galt auch im modernen Leben. Entschleunigung nannte man das wohltuende Phänomen und darauf spezialisierte Psychologen verdienten viel Geld, während jedermann dies eigentlich ohne besondere Einführung oder Anleitung, ohne teure Kurse und anmaßende Coachs völlig selbstständig und augenblicklich auf dem Rücken eines Pferdes für sich gewinnen konnte.
Jules wandte sein Pferd zu einem Hügel auf der rechten Seite der Straße hin, stieg ab und führte es am Zügel zwischen Sträuchern, Felsen und rutschender Erde hinauf. Von oben herab bot sich ihm ein weiter Blick über das gesamte Tal und die daran anschließende, weite Ebene. Er suchte die Trasse der Zugschienen, ausgehend vom Bahnhof in Raton, verlor den Strang jedoch hinter einem Hügelzug rasch aus den Augen. Eine Diesellok kam gemächlich um die Biegung herum gestapft, ließ ihr dumpfes Horn warnend und warm zugleich ertönen, fuhr mit kaum zehn Güterwagons an ihrem Rücken in Richtung Bahnstation.
Die anderen in der Gruppe hatten den Ausflug von Jules bemerkt und waren im Schritt weiter geritten, während Jules immer noch auf der Höhe träumerisch verharrte und die Landschaft weiter betrachtete. Er sah gegenüber seinem Standort einige günstig gelegene Stellen, wo sich damals Apachenkrieger verbergen und beinahe gefahrlos auf vorbeiziehende Fahrzeuge und Reisende schießen konnten. Der Berghang lag kaum hundert Meter von der alten Passstraße entfernt, wurde von ihr durch eine tiefe Schlucht getrennt, bot zahlreiche Verstecke und gute Deckung für Angreifer. Ja, hier hatten sie gelauert, die Krieger von Cochise und Geronimo, die Kämpfer für ihre Freiheit, die schlimmsten Guerillas ihrer Zeit.
Mei, Chufu, Alabima und Alina waren mittlerweile stehen geblieben, schauten zurück und warteten auf ihn, winkten ihm auffordernd zu. Jules saß auf und trat mit den Stiefelfersen seinem Reittier sanft aber auffordernd gegen die Flanken und schnalzte dazu mit der Zunge, bewegte leicht die Zügel und ruckte sein Becken auffordernd nach vorne. Das Pferd suchte sich seinen Weg selbstständig, stieg vorsichtig den Hang hinunter zur Straße, rutschte ein Stück mit steifen Beinen, fiel unten sogleich in einen leichten Trab, sorgte für raschen Anschluss an die Gruppe.
Pferde waren damals vor allem Arbeitstiere gewesen, wurden weder geschont noch besonders gepflegt. Erreichten sie gesund ein höheres Alter, so wurden sie trotzdem gegen jüngere ausgewechselt, so wie ein Handwerker sein abgenutztes Werkzeug austauschte. Bereits für dreißig Dollar, etwas mehr als einen Monatslohn eines Cowboys, bekam man damals ein durchschnittliches Reittier. Wahrscheinlich lag darin der wahre Grund, warum so viele moderne Menschen ihr Auto hegten und pflegten. Denn ihr modernes Fahrzeug hatte weit mehr als einen Monatslohn gekostet, in manchen Fällen mehr als der Verdienst eines ganzen Jahres. War das Ausdruck fürs Anbeten des Mammons? Die Zurschaustellung des wirtschaftlichen Erfolgs im Leben? Oder doch bloß ein andauernder Selbstbetrug in Form von Eigenliebe? Narzissmus im Spiegel der Technik?
Auch das Zureiten der jungen oder wild gefangenen Pferde war kein Zuckerschlecken gewesen, weder für das Tier noch für den Menschen. Hollywood verklärte auch diese Arbeit zu einer Art von Freizeitvergnügen der Cowboys, wo die Ranch-Mannschaft sich fröhlich um den Corral versammelte und dem Kandidaten auf dem Gaul zuwinkten und ihn anfeuerten. In Wahrheit wurde der Hals des Pferdes mit einem kurzen Seil an einem niedrigen Pflock festgezurrt, so dass es seinen Kopf nicht hochwerfen konnte. Zudem band man seine Vorderbeine mit einer Fessel eng zusammen. Manchmal stülpte man ihm zusätzlich eine Wolldecke über die Augen, um ihm die Orientierung zu erschweren. Erst dann wurde es aufgezäumt und gesattelt. Der Zureiter stieg auf das Tier, das aufgrund der Fesseln kaum bocken konnte, am Hochsteigen durch den Pflock, am Herumwerfen durch die Beinfesseln gehindert wurde. Und so fügten sich die meisten Tiere rasch einmal, wurden bei anhaltendem Ungehorsam auch mal in die empfindlichen Ohren gekniffen oder man bearbeitete ihre Flanken mit spitzen Sporen. Es war kein Zureiten, sondern ein Einbrechen.
Warum sollte sich der Zureiter auch einer unnötigen Gefahr aussetzen? Falls er sich etwas brach, bezahlte ihm niemand den Arbeitsausfall. Damals gab es noch keine Versicherungen und nur funktionierende Arbeiter erhielten auch Geld. Die Härte des Lebens unter den Menschen hatte sich bestimmt auf ihr übriges Umfeld ausgewirkt, mochten es Tiere, Pflanze oder Lebensraum sein. Denn wer sich nicht selbst behauptete, ging in dieser Welt ganz einfach zugrunde. Und wer auf die Mildtätigkeit der Menschen hoffte oder angewiesen war, hatte in der Regel auf Sand gebaut.
Wenn das Pferd erst einmal eingebrochen war und den Reiter auf seinem Rücken duldete, musste man es für den täglichen Arbeitseinsatz ausbilden und abhärten. Beispielsweise erschreckte der Zureiter das Tier immer wieder mit dem überraschenden Wedeln einer Decke vor seinem Kopf oder dem lauten Knallen einer Peitsche hinter seinem Rücken. Ein Cowboy-Pferd musste vor allem lernen, still stehen zu bleiben, sobald die Zügel auf den Boden wiesen. Denn mitten in der Prärie gab es meist keinen Strauch oder Baum, an dem man sein Reittier hätte anbinden können, um seine Notdurft zu verrichten. Ein weglaufendes Pferd hätte in der Wildnis den sicheren Tod des Cowboys bedeutet.
Rinderpferde lernten zudem, den weit ausladenden Hörnern der Longhorn Bullen geschickt auszuweichen und sich beim Lassowurf im richtigen Moment gegen die Masse des Rindes zu stemmen, um es auf diese Weise zu Fall zu bringen, exakt in dem Moment, wenn sich die Leine strammzog. Wagenpferde dagegen mussten andere Tiere neben, hinter und vor sich im Gespann dulden lernen. Auch war der Gleichschritt und das gleichmäßige Ziehen der Last weitere Disziplinen. Die Ausbildung dieser Tiere zog sich bestimmt über viele Tage oder gar Wochen hin. Schon aus diesem Grund konnte man keine Zeit für das erste Einbrechen eines Pferdes verschwenden. Rationierung und Optimierung im Wilden Westen und auf dem Buckel der Pferde.
Ihre kleine Schar zog nun gemeinsam weiter die Straße hoch, sollte wohl gegen Mittag auf der Passhöhe anlangen.
Wie wurden wohl die Pferde für ihre tägliche Arbeit ausgewählt? Welches Tier sollte sein Leben lang Wagen ziehen? Welches dagegen Rinder treiben helfen? Bestimmt entwickelten die Zureiter und Ausbilder rasch ein gutes Auge für die geeigneten Tiere, hatten auch ihre Tricks, um die richtigen Pferde für die künftige Tätigkeit auszusuchen.
Die freundlichen, genügsamen, sich rasch unterordnenden, landeten bestimmt im Gespann. Waren sie jedoch besonders kräftig oder ausdauernd, lag der Postdienst mit den Kutschen für sie im Bereich des Möglichen. Die eher wilden und aufsässigen wurden dagegen bestimmt zu Rinderpferden erzogen. Denn Cowboys waren es gewohnt, jedem bockenden Tier innerhalb weniger Sekunden den Meister zu zeigen. Sie ritten manchmal mehrere verschiedene Pferde am selben Tag, wechselten sie aus, wenn die Tiere vom Treiben der Viehherde nach zwei, drei Stunden ermüdet waren.
Konnte man womöglich das Verfahren der Pferde-Auswahl vom Wilden Westen auf die heutige Menschenwelt übertragen? Da gab es Fabrikarbeiter und kleine Angestellte, die brav die ihnen übertragenen Aufgaben erledigten und sich mit geringem Lohn zufriedengaben. Eine stellten sich dabei als wahre Arbeitstiere heraus, andere versuchten sich zu drücken. Und dann gab es auch noch die aufsässigen, wilden, die sich nicht so leicht einspannen ließen, die stets eine gewisse Freiheit für sich reklamierten. Auch sie verdienten kaum mehr, fühlten sich jedoch als echte Rebellen, probierten immer wieder mal zu Bocken. Künstler gehörten sicher zu dieser Kategorie, aber auch viele Unangepasste, Aussteiger und Lebenskünstler, letztendlich wohl auch die Penner und Suchtkranken.
Und dann waren da die Cowboys, die Postkutschenlenker und Frachtfahrer. Sie hielten den Betrieb am Laufen, sorgten dafür, dass die Arbeitstiere das taten, wofür man sie angeschafft hatte. In gewisser Weise war dies mit dem heutigen mittleren Management oder den höheren Beamten vergleichbar. Sie wiesen die Angestellten und Arbeiter an, überwachten, kontrollierten und musterten aus. Nicht zu vergessen das oberste Management, das im Wilden Westen in Form von Ranchern, Postlinienbesitzern oder Frachtunternehmern auftrat.
Doch wo standen in dieser Management-Pyramide die Rinder?
Sie waren genauso wie heute reines Arbeitsergebnis, das man produzierte und auf den Markt warf. Western-Romantik ade.
Der einfache Cowboy und der gewöhnliche Frachtfahrer hatten stets Tiere unter sich. War das vielleicht der Grund, warum die Menschen in diesen frühen und recht primitiven Zeiten trotzdem glücklicher lebten als die meisten modernen Menschen mit ihrem Luxus? Damals wie heute waren die Aufstiegsmöglichkeiten gering und die allermeisten mussten sich mit wenig zufriedengeben. Lag also der Grund für Eheprobleme und Scheidungen nicht auch im Umstand begraben, dass man in der modernen Welt weit weniger Umgang mit Tieren hatte, sie vor allem nicht mehr als Werkzeuge einsetzte, sie nicht mehr als Ventile für zwischenmenschliche Probleme benutzen konnte? Lag darin der Schlüssel zur Anschaffung von Hunden und Katzen? Doch im Gegensatz zu den Pferden führen kleine Haustiere kaum zu einer Entschleunigung des Lebens, sorgten eher für eine zusätzliche Belastung.
»Dieser Ausritt war eine echt gute Idee, Jules.«
Chufu hatte sich etwas zurückfallen lassen, ritt nun neben seinem Adoptivvater. Der Philippine fühlte sich pudelwohl auf seinem Gaul. In Brasilien hatte er gelernt, mit echten Rinderpferden umzugehen und sie auch für Viehtriebe einzusetzen. Die Tiere wurden in der heutigen Zeit jedoch weit behutsamer als früher an ihre Arbeit herangeführt. Sie reagierten auf jede noch so leichte Bewegung der Zügel, ja selbst die richtige Gewichtsverlagerung eines guten Reiters zeigte den Tieren exakt an, was er von ihnen verlangte. Pferd und Mensch verschmolzen zu einer Einheit, die auch ohne bösartigen Druck tadellos funktionierte.
Ähnlich dem Prozess der Teambildung in modernen Unternehmen. Man schweißte das mittlere Management mit ihren Untergebenen zu einer echten Einheit zusammen, belohnte und bestrafte sie gemeinsam, sorgte damit für gehörigen Gruppendruck und holte so mehr aus jedem Individuum heraus.
Jules schüttelte über diesen Gedanken unwillig den Kopf, so als wollte er ihn gleich wieder wegwischen. Doch Chufu hatte die Übersprunghandlung von Jules beobachtet.
»Was ist?«, fragte er ein wenig besorgt.
»Ach nichts. Nur ein dummer Gedanke, der mir gerade kam. Aber ich gebe dir Recht. Einen schöneren Ausritt wie heute kann man sich kaum vorstellen. Der blaue Himmel, die kleinen, weißen und doch so dichten Wolken, dazu dieses malerische Tal mit dem Grau der Felsen und Gelb der Erde, dem Grün der Pflanzen. Herrlich. Und alles ohne störenden Motorenlärm.«
Wie als Entgegnung hörten sie in diesem Moment ein Fahrzeug weiter oben aufheulen. Wenig später kam es die Straße hinunter gebraust. Es war ein weißer Pickup mit Firmenaufschrift. Der Lenker musste die unbefestigte Straße recht genau kennen, denn er zeigte wenig Respekt vor dem rutschigen Schotter. Wenigstens bremste er angesichts der Pferdekarawane ein wenig ab, wich ihnen auch soweit als ihm möglich nach rechts aus. Hinter dem Steuer konnte man das stoische Gesicht eines Mannes erkennen, der vielleicht froh darüber war, von diesem einsamen Ort endlich wegzukommen, dies jedoch nicht offen zeigte, weil er häufiger hier oben zu tun hatte und er ihn deshalb gewohnt war.
Eine ganze Weile lang ritten Chufu und Jules stumm nebeneinander, blickten voraus und auf die Rücken der anderen vor ihnen. Wiederum hatte sich Mei der kleinen Alina angenommen, die diesmal auf einem ausgewachsenen Pferd reiten durfte, da im Mietstall kein Pony zur Verfügung gestanden war. So hoch oben fühlte sich die Kleine noch weit wichtiger, schaute sich von Mei beständig ab, wie diese mit ihrem Tier umging, versuchte sie in allem zu kopieren. Die Chinesin zeigte ihr geduldig die Tricks, mit denen man seinem Reittier entsprechende Hilfen gab, damit es leichter verstand, was man von ihm erwartete.
»Wenn du nach rechts abbiegen willst, solltest du nicht an den Zügeln ziehen. Das ist gar nicht nötig und dein Pferd ist das wahrscheinlich auch nicht gewohnt. Schau mir zu. Ich verlagere bloß mein Gewicht etwas nach rechts und führe auch die Hand mit den Zügeln in diese Richtung. Das Tier spürt nun das Lederband leicht auf der linken Seite seines empfindlichen Halses und weiß darum, wohin du willst. Und nun geht’s entsprechend wieder zurück nach links. Probiere das ruhig selbst ein paar Mal aus und reite ein wenig im Slalom.«
Auch bei Alina klappte das Manöver auf Anhieb ausgezeichnet und sie freute sich riesig, tätschelte dem Tier liebevoll den Hals.
»Weißt du, Alina, das Maul eines Pferdes ist äußerst empfindlich. Früher quälte man viele Tiere mit der sogenannten spanischen Kandare. Das waren Gebissstangen, die dem Tier sehr weh im Maul taten, wenn man am Zügel riss. Man zwang das Pferd im Grund genommen zum Gehorsam, machte es zu seinem Sklaven. Heute dagegen versuchen wir, eher der Freund und Partner der Tiere zu sein. Solange das Pferd tut, was wir von ihm erwarten, wenden wir keinen Druck an.«
»Aber warum hat man früher denn die Pferde so gequält? Man hätte sie doch auch damals als Freunde behandeln können?«
Mei überlegte eine Sekunde, bevor sie der Kleinen antwortete.
»Vielleicht war das Leben damals ganz einfach zu hart für die Menschen. Und so übertrugen sie ihre Mühsal auch auf den Umgang mit den Tieren. Heute sind wir in dieser Hinsicht einfach klüger geworden.«
Oder verweichlicht und schwach, dachte Jules zynisch, als er den Erklärungsversuch von Mei vernahm.
Wie geplant kamen sie gegen Mittag auf der Passhöhe an, ritten vom Schotterweg ein Stück weit weg, fanden einen schönen Rastplatz zwischen Felsen und Bäumen, die für Mensch und Tier Schatten spendeten. Wiederum hatten sie sich einen Imbiss mitgebracht, verzehrten die Sandwichs aus dem Tankstellenshop mit großem Genuss.
»Das höchste Glück auf Erden, liegt auf dem Rücken der Pferde«, fasste Mei ihre ausgezeichnete Stimmung und das kameradschaftliche Gefühl zusammen.
»Pferde fliegen ohne Flügel und Siegen ohne Schwert«, doppelte Chufu philosophisch nach.
»Männer und Pferde, beide sind teuer. Doch wähle die Pferde, denn sie sind treuer!«, meinte Mei nun augenzwinkernd zu ihrem Freund hinüber und lachte ihn über das ganze Gesicht an. Chufu war aber um eine Erwiderung alles andere als verlegen: »Einem Wallach kannst du befehlen. Einen Hengst musst du bitten. Mit einer Stute musst du jedoch ständig diskutieren!«
Mei zog eine beleidigte Schnute, die übrigen Erwachsenen lachten und Alina hörte und schaute ihnen staunend zu, hatte nicht verstanden, was an diesem Wortgefecht lustig war.
»Das größte Glück der Pferde, ist der Reiter auf der Erde«, gab Jules nun auch noch seinen Senf dazu. Diesmal lachte auch Alina mit.
*
Wie fast jeden Sonntag waren Reginald und Silver auch an diesem Tag kurz vor Mittag vorgefahren, hatten sich im Speisesaal von Bedfort Castle eingefunden und ihre üblichen Plätze an der langen Tafel eingenommen, mussten diesmal jedoch auf das Erscheinen von Oldman McPhearsen warten. Butler Jeremy hatte ihnen geöffnet, war ihnen in den Saal voraus geschritten, hielt ihnen dort die Türe auf, hatte sich dann mit einer Entschuldigung entfernt und dafür einen livrierten Diener zu ihnen geschickt, der ihnen nun die bestellten Drinks servierte, einen Dry Martini ohne Olive für Reginald, einen Americano für Silver. Reginald griff gierig nach dem Kelchglas, stürzte den Drink mit einem einzigen Schluck in den Rachen und streckte dem Bediensteten gleich wieder auffordernd das leere Glas entgegen.
»Noch so einen, Shaggy.«
Der junge, etwas verschüchtert wirkende Mann von Mitte zwanzig hieß nicht Shaggy, sondern Francesco. Doch mit seinem dunkelbraunen, dichten Haar und dem langgezogenen Gesicht mit dem etwas eigenwillig wuchtigen Kinn erinnerte er Reginald an Norville „Shaggy“ Rogers, eine der Hauptfiguren aus der Comicreihe Scooby Doo. Reginald war verheiratet und seine Frau Brook hatte ihm vor vielen Jahren zwei Söhne geboren. Darum hatte sich Reginald fast zwangsläufig im Alter von gut fünfundvierzig Jahren mit der für seine Generation recht fremden Welt des Zeichentricks beschäftigen müssen. Einiges war trotz Desinteresse bei ihm hängen geblieben und dieses unnütze Wissen wandte er seitdem dort an, wo es keine Rolle spielte, zum Beispiel für Scherznamen der Dienstboten.
Reginald war seit fast dreißig Jahren verheiratet, lebte jedoch die letzten fünf glücklich getrennt von seiner Ehefrau Brook. Die Cambridge Studentin hatte sich damals Hals über Kopf in den Milliarden-Erben verliebt und ihn noch vor ihrem Uni-Abschluss geheiratet, hatte ihm wie im Ehevertrag vereinbart zwei Kinder geschenkt, hatte sich nie über die zahlreichen Affären ihres Ehemannes aufgeregt, war stattdessen ihren eigenen Neigungen nachgegangen. Wie viele Paare warteten auch Reginald und Brook die Volljährigkeit ihres Jüngsten ab, bevor sie sich auch offiziell trennten. Eine Scheidung kam jedoch für beide nicht in Frage. Brook wollte den Namen behalten, Reginald die Abfindung einsparen. Auch seine beiden Söhne traf Reginald nicht mehr oft. Die Kinder lebten irgendwo in London, schimpften sich Künstler, bekamen monatlich ihre Schecks aus Papas Büro zugesandt, konnten auf dieser Grundlage ihre Lebensillusion weiterhin träumen, mussten nicht aus ihnen herauswachsen und Eigenverantwortung übernehmen.
Als Francesco, der junge Diener aus Malta, den zweiten Drink serviert und den Speisesaal verlassen hatte, ging er leise fluchend den Flur entlang in Richtung Küche davon. Butler Jeremy sah ihm tadelnd nach, ermahnte ihn jedoch nicht. Er kannte den Spleen von Reginald, allen Untergebenen irgendwelche meist beleidigenden Spitznamen zu geben. Jeremy beispielsweise musste sich vom älteren McPhearsen Sprössling seit dreißig Jahren immer wieder mal mit Gaston anreden lassen, nur weil Reginald als Jugendlicher einen Comic mit Gaston Lagaffe, dem liebenswürdigen Tollpatsch des Zeichners Franquin, in die Finger bekommen hatte und sich beim Anblick des Major Domus aus Malta an diesen erinnert sah.
Der Butler hatte sich allerdings nie Gedanken darüber gemacht, warum Reginald sich so verhielt, warum er grundlos Mitarbeitende beleidigte, warum er nicht fair zu den Hausangestellten sein konnte. Jeremy hatte stets alles erduldet, alles geschluckt. Denn als Gegenleistung zu seiner gespielten Demut den Angehörigen des McPhearsen Clans gegenüber, war er, Jeremy, der eigentliche Herr über Bedfort Castle. Nur er besaß alle Schlüssel zum riesigen Anwesen, kannte jeden einzelnen Raum, organisierte den Haushalt und den Unterhalt des Schlosses, war im nahen Dorf ein gern gesehener Auftraggeber und für die Einheimischen eine echte Persönlichkeit.
Ja, als Halbwüchsiger kannte er noch andere Pläne, schmiedete sich sein eigenes Leben zusammen, wollte wie viele Jungen erst Lokomotivführer, später Architekt werden. Doch nach dem Studium misslang ihm der Berufseinstieg, verlor er aufgrund seines angeblich fehlenden Esprit gleich drei Stellen kurz hintereinander, wandte sich enttäuscht und aufgrund eines Inserats dem Beruf eines Butlers zu, ließ sich an einer renommierten Schule in London ausbilden und nahm den Frack als seine letzte Uniform und endgültige Lebenseinstellung an, schlüpfte nicht etwa in eine Rolle, sondern lebte die Figur.
Als der zweite Martini ausgetrunken war, trat endlich Ollie Oldman McPhearsen in den Speisesaal, watschelte etwas unbeholfen zu seinem Stuhl am Kopfende der Tafel, setzte sich umständlich, begrüßte dann erst seine Söhne, jedoch mit denselben Worten, wie er es jeden Sonntag tat.
»Hallo Reginald, ... Silver?«
»Hallo Vater«, gab Reginald seltsam sanft zurück, worauf ihn der Alte überrascht anblickte, ihn streng und abschätzend fixierte.
»Hi, Paps.«
Die flapsige Anrede von Silver blieb vom Oldman unbeachtet, denn der behielt seine Augen scharf auf seinen älteren Sohn gerichtet.
»Alioth ist von all seinen Ämtern zurückgetreten, wie ich erfahren habe.«
Das war keine Frage des Alten, sondern eine Feststellung. Und die Worte von Oldman klangen wie eine Drohung, ließen die breiten Schultern von Reginald ein Stück weit einsinken, wie Silver amüsiert feststellte.
»Ja, ab sofort«, gab sein Bruder zu.
»Und warum?«
Die Stimme des Oldman blieb drohend und Unheil verkündend.
»Was weiß ich. Vielleicht das Alter? Er sprach unbestimmt, von irgendwelchen persönlichen Gründen.«
Ollie Oldman McPhearsen starrte sein Kind weiterhin an, mit verkniffenem, störrischem Mund und stechenden Augen, drohend und unversöhnlich. Seine lange und spitze Hakennase, die grau-gelbe, ungesund wirkende Gesichtsfarbe, die weißen buschigen Augenbrauen und das grau-weiße, leicht gewellte und viel zu lange Haupthaar, all das wirkte auf Silver in diesem Moment wie die Verkörperung allen Unheils. Sein Vater hätte den perfekten bösen Zauberer im Märchen abgegeben, ein personifizierter Kinderschreck, ein Scrooge für hartgesottene Fünfjährige.
Alioth und der Oldman waren langjährige Gefährten und Weggenossen gewesen, hatten den Familienkonzern im Grunde genommen zusammen mit Rupert über die letzten vier Jahrzehnte zu dem gemacht, was er heute war. Während Ollie die Ideen einbrachte und Rupert die Drecksarbeit verrichtete, setzte Alioth die Pläne um, fand die richtigen Leute, bandelte mit den Entscheidungsträgern an, schuf viel Goodwill oder schmierte die richtigen Stellen. Ollie war stets der mächtige Geldgeber und Drahtzieher, blieb meistens im Hintergrund, trat nur manchmal in die Öffentlichkeit. Vor dieser alten Seilschaft zwischen Alioth und seinem Vater mochte sich Reginald insgeheim fürchten, weshalb er den Alten belog. So jedenfalls stellte es sich Silver vor, während er das stumme Ringen von Vater und Bruder interessiert beobachtete.
Doch auf einmal hellten sich die strengen Augen des alten Patriarchen auf, verloren jede Schärfe, ja sprühten über vor innerer Fröhlichkeit. Ollie McPhearsen schlug sich mit der Hand auf seinen mageren Oberschenkel und stieß dazu ein meckerndes, unangenehm klingendes Lachen aus.
»Reingelegt…«, freute er sich wie ein Kind, »…, das mit Alioth hast du großartig hinbekommen, mein Junge, Respekt.«
Vergnügt und mit sichtlichem Wohlgefallen betrachtete der Oldman seinen älteren Sohn. Der straffte nach dem Kompliment seinen Oberkörper, richtete sich gerader auf, sah seinen Vater wieder fester in die Augen. Sein Gesicht war allerdings die ganze Zeit über genauso kalt und unbeweglich geblieben, wie er es eigentlich immer nach außen zeigte. Nichts und niemand schien den Älteren McPhearsen Erben wirklich aus der Reserve locken zu können. Zu abgebrüht schien er. Oder ganz und gar unempfindlich?
»Musstest du ihm eine Abfindung bezahlen?«
Reginald schüttelte verneinend den Kopf.
»Nein, das war nicht nötig.«
»Und bei was hast du ihn erwischt? Freiwillig wäre der alte Alioth doch niemals zurückgetreten. Unter keinen Umständen. Hast du ihn mit seinen schleimigen Fingern etwa in der Firmenkasse erwischt? Oder was? Alioth muss doch längst bankrott gewesen sein?«
Einmal mehr bewunderte Silver seinen Vater, wie der seit vielen Jahren und die meiste Zeit über auf seinem Schloss in der Provinz hockte und trotzdem über jeden und alles Bescheid zu wissen schien, den Draht nach Draußen nie verloren hatte.
Das Gesicht des Oldman zeigte bei seinen letzten Fragen eine wollüstige und gierige Fratze. Silver dachte unwillkürlich zurück an eine Begebenheit in seiner Jugend hier auf Bedfort Castle. Er hatte unten in der Halle gespielt, als von oben aus einem der Zimmer ein kurzer, spitzer Schrei ertönt war. Er schlich damals die Treppe hoch, getrieben von Neugierde und einem gruseligen Gefühl. Die Tür zu einem der Schlafzimmer stand eine Handbreit offen und dahinter war ein unterdrücktes Keuchen und manchmal leises Stöhnen zu vernehmen. Er spähte durch den Spalt hinein, sah seinen Vater, wie er mit heruntergelassener Hose über einem der Dienstmädchen auf dem Bett lag. Ihr Rock war weit nach oben geschoben, zeigte schlanke, weiße Beine. Sein Vater hielt ihr den Mund mit einer Hand verschlossen, während er wie ein Gummiball auf ihr herum hüpfte. Damals erschrak sich Silver sehr über das Gesicht, das sein Vater zeigte, diese Fratze voller Gier und grenzenloser Wollust. Er hatte es damals nur von der Seite her erblickt, hatte bange Sekunden dagestanden, wohl mit offenem Mund, hatte nicht wirklich begriffen und sich trotzdem rasch abgewandt und war wieder hinunter in die Halle gerannt, hatte das Gesehene versucht zu verdrängen. Katrina, das Zimmermädchen, war wenige Tage später aus dem Haushalt entlassen und aus Bedfort Castle entfernt worden. Sie hatte ihm leidgetan, auch wenn er erst Jahre später begriffen hatte, was in diesem Zimmer tatsächlich vorgefallen war.
Reginald ließ seinen Vater lange auf eine Antwort warten. Der blickte seinen Sohn immer noch auffordernd an, wollte auf jeden Fall Gewissheit erlangen.
»Reginald ist finanziell tatsächlich so ziemlich am Ende. Er wollte sich wohl mit Hector & Clide zusammentun. Silver hat das herausgefunden.«
Der Kopf des Vaters ruckte für einmal hinüber zum jüngeren Sohn und die Geieraugen des Alten fingen den Blick von Silver ein.
»Und wie?«
Silver wehrte bescheiden ab.
»War reiner Zufall. Ein Tipp von einem meiner Bekannten. Eine Detektei hat den Rest erledigt.«
Das Gesicht des Alten zeigte Unwillen. Es passte ihm wohl nicht, dass bloß ein glücklicher Zufall dahintersteckte.
»Und um was ging es ihm? Was wollte Alioth den Dreckskerlen von Hector & Clide verkaufen?«
Silver hob bedauernd seine Schultern an und so blickte Oldman wieder zu Reginald hinüber.
»Das wissen wir nicht so genau. Doch Hector & Clide scheinen sich in letzter Zeit für die Fracking Technologie zu interessieren. Wir besitzen einige wichtige Patente in diesem Bereich. Und da Alioth für den Bereich Erdöl und Erdgas zuständig war, hatte er Zugriff auf diese Patente, verfügte auch über die notwendigen Vollmachten, um sie an jemand anderen zu übertragen.«
Der Alte stierte seinen Sohn dumpf an, dachte nach.
»Ja, das ist möglich«, entschied er dann, schien jedoch gleichzeitig unzufrieden über seine Feststellung.
Die Suppe wurde aufgetragen. Reginald und Silver wünschten guten Appetit, während der Oldman uninteressiert und geistesabwesend abwinkte. Er begann jedoch sogleich mit Appetit zu löffeln und zu schlürfen, dachte stumm über dem Teller brütend weiter über Alioth und dessen Verrat nach. Auf einmal hielt er mit Essen inne, blickte wiederum Reginald mit stieren Augen an und streckte seinen Löffel fast wie ein Messer gegen den Sohn aus. Ein Tropf der Suppe löste sich dabei und fiel direkt in den Teller von Reginald, der dies mitbekam und der sein Missfallen und seine Abscheu durch ein leichtes Rümpfen der Nase auch zeigte.
»Und was machst du nun mit dem alten Alioth?«
Bevor Reginald darauf antwortete, schob er mit Daumen und Zeigefinger seinen Suppenteller erst ein Stück weit zur Mitte der Tafel, als Zeichen, dass er nicht mehr weiter essen würde. Dann erst schaute er seinem Vater tief in die wässrig-blauen Augen, so als suchte er dort nach der Antwort.
»Alioth ist für immer weg. Er ist bereits Geschichte.«
Das Gesicht des Alten wurde hart und zeigte Angriffslust, ähnlich einem Terrier kurz bevor er nach dem Genick der Ratte schnappte, um sie mit einem Biss zu töten. Genau vor diesem Blick, vor diesem Gesicht hatte sich Silver zeitlebens gefürchtet. Der Oldman hatte schon immer alles von seinen Söhnen verlangt und keine Ausreden gelten lassen. Scheiterten sie an einer zu schwierigen Aufgabe, dann bestrafte er sie unerbittlich, kannte keine Gnade, zeigte keine Gefühle. Die Schläge mit dem Rohrstock waren dabei nicht etwa der Ausdruck von Wut und auch nicht aus Hilflosigkeit als alleinerziehender Vater geboren. Für den Oldman waren sie einfach nötig. Das war das Grausame an den väterlichen Strafen, dass sie in den Augen des Alten eine zwingende Notwendigkeit darstellten, als wären sie von Gott befohlen.
»Wer uns bestiehlt, bezahlt dafür.«
Die Stimme des Alten ließ keinen Zweifel aufkommen. Doch Reginald schüttelte ablehnend den Kopf. »Alioth ist bestraft genug. Und es gab auch keinen Diebstahl.«
Die Stimme des älteren Sohnes war klar, fest und ungewohnt präzise. Seine Äußerung erhielt dadurch ein besonderes Gewicht, sollte dem Oldman wohl klar machen, dass nun er, der Sohn, die Führung des Familienkonzerns ganz und gar übernommen hatte und dass sein Vater, der Alte McPhearsen, nicht mehr der Bestimmende sein konnte, nie mehr sein würde.
Ollie Oldman McPhearsen sagte nichts darauf, schluckte nur hart und sein Kehlkopf hüpfte dabei kurz über den Rand seines viel zu weiten Hemdkragens. Er stierte den Älteren noch schärfer an, kniff dabei die Augenlider zu schmalen Schlitzen zusammen, fixierte Reginald, als wollte er ihn mit diesem Blick töten. Und dann wiederholte er mit schwerer Stimme, langsam und keuchend, jedes einzelne Wort betonend: »Wer … uns … bestiehlt, … bezahlt … dafür.«
Reginald hielt dem Blick des Alten diesmal stand. Kein Muskel zuckte in seinem Gesicht, kein Augenlid blinzelte. Sekunden vergingen, während Silver fasziniert das gegenseitige Messen der beiden beobachtete. Und auf einmal stellte er verwundert fest, dass ihm der Ausgang dieses Kampfes völlig kalt ließ. Sollte doch Reginald den Alten in die Schranken weisen und die Macht vollends an sich reißen oder der Oldman ein vielleicht letztes Mal über den älteren Bruder triumphieren. Was spielte das für ihn schon für eine Rolle?
»Ich hab Alioth genug Angst eingejagt, Vater. Alioth mag früher einmal ein scharfer Hund gewesen sein. Doch seine beste Zeit ist längst vorbei und er wurde ängstlich und vorsichtig. Seine Gläubiger werden ihn vollends auseinandernehmen. Ich vergreif mich nicht an ihm. Lass doch die Ratten den Rest besorgen.«
Die Worte des älteren Bruders wirkten auf Silver wie eine Grabrede auf den eigenen Vater und selbst der Oldman starrte Reginald verwundert an. Dass sich der ältere Sohn nicht mehr seinem Wunsch beugen wollte, hatte er nicht erwartet. Doch nun zeigte sich die ganze Gefährlichkeit des Alten. Denn er zog seinen vorgebeugten Oberkörper ein Stück zurück und setzte sich wortlos wieder gerade vor seinen Suppenteller, schob auch den Löffel wieder hinein und begann erneut zu Schlürfen und zu schlucken, so als wäre nichts gewesen.
Silver und Reginald tauschten einen brüderlichen Blick aus, verstanden sich wie die meiste Zeit über ohne Worte zu tauschen. Ja, Reginald würde in Zukunft wachsam bleiben müssen. Der Alte hatte mit Sicherheit noch längst nicht aufgegeben, verließ bloß dieses eine Schlachtfeld, um seine Kräfte neu zu sammeln, eine neue Strategie zu entwerfen, um dann umso furchtbarer zurückzuschlagen.
Silver wusste allerdings noch nicht, auf wessen Seite er dann stehen würde.
*
Jules musste vor dem zu Bett gehen seiner Tochter alles erzählen, was er aus Büchern und Romanen über die Westernwelt kannte, zumindest das, was er davon noch in Erinnerung behalten hatte. Vor allem die Indianer und im Besonderen die Apachen schienen es der Kleinen angetan zu haben, dieses wilde, kriegerische und irgendwie geheimnisvolle Volk. Im 14. und 15. Jahrhundert waren sie von Norden kommend in die Gebiete der Pueblo Indianer vorgedrungen. Sie selbst nannten sich Enju, was schlicht Volk bedeutete und eigentlich bereits viel über ihre Sicht der Welt aussagte. Für die Zuni Indianer waren sie jedoch Apachus, also Feinde. Und diesen Namen behielten sie bis heute. Denn sie kamen als Eroberer, lebten vor allem vom Plündern und Rauben, terrorisierten bis zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts ein Gebiet, das größer als Deutschland und Frankreich zusammen war. Und dabei zählten die Apachen nie mehr als 8’000 Seelen, besaßen kaum 3’000 Krieger.
Die spanischen Eroberer lernten die Apachen im sechzehnten Jahrhundert ebenso fürchten, wie später die Mexikaner und die US-Amerikaner. Denn es gab wohl niemals genügsamere, härtere und brutalere Kämpfer. Noch vor hundertfünfzig Jahren unterbrachen Apachen immer wieder die Handels- und Transportwege im Südwesten der USA, überfielen Ranches, Stationen der Postlinien und Minen, verbreiteten Angst und Schrecken unter den Menschen, ließen die Siedler aus dem Umland in die Städte fliehen, die von der Außenwelt abgeschnittenen Inseln glichen, die über Wochen ohne Verbindung nach Außen blieben.
Mexikanische wie amerikanische Städte begannen Prämien für jeden getöteten Apachen zu bezahlen, selbst für Kinder. Tucson bezahlte noch im Jahre 1870 für den Skalp eines Kriegers einhundert Dollar, was drei Monatslöhnen eines Cowboys entsprach, in heutiger Währung etwa sechstausend Euro. Der Skalp einer Frau war den christlichen Bürgern der Stadt noch fünfzig Dollar wert und für den Haarschopf eines Kindes bezahlten sie immerhin noch dreißig. Wie sehr mussten doch Hass und Angst zusammengewirkt haben, um solch barbarische Prämien einzuführen?
Auf beiden Seiten der mexikanisch-amerikanischen Grenze war ein Vernichtungskrieg gegen die Apachen in Gang gekommen, der sich jedoch über Jahrzehnte hinweg zog. Dabei fochten die zuvor so erfolgreichen Eroberer, die Apachen, einen verzweifelten und darum brutalen Kampf um ihre Freiheit und ihre Privilegien, später dann auch gegen ihr Aussterben. Auf der Gegenseite standen die neuen Eroberer, Mexikaner und Amerikaner. Sie betrachteten die Apachen nicht etwa als Menschen, sondern als eine Art von Raubtier, das sich mit Überfällen auf zivilisierte Menschen ernährte und darum ausgemerzt gehörte. Doch durfte man Diebstähle und Raubüberfälle tatsächlich so vergelten? Heute hätte man wohl andere, ethische Grundsätze angewandt.
Doch die Apachen waren geborene Guerillakämpfer und das trockene und weite Land half ihnen in ihrem Widerstand gegen die neue Zeit. Ihre Pferde waren genügsam, kamen mit einem Drittel des Wassers aus, das man den großen und schweren Pferden der Kavallerie zugestehen musste. Und wurde eine Kriegerhorde allzu sehr von Soldaten oder nach Beute gierenden Skalp Jägern bedrängt, dann töteten sie ihre Tiere und gingen sie zu Fuß noch tiefer in die Wüste hinein, an Orte, wo nur sie ein paar unterirdische Quellen kannten, die man zuerst ausgraben musste und die erst nach Stunden wenige Schluck Wasser spendeten, viel zu wenig für eine größere Gruppe von Verfolgern mit ihren Pferden.
Geronimo wurde zu einem ihrer wichtigsten Anführer. Mehr als zehn Jahre lang leistete er erfolgreichen Widerstand gegen die Vereinigten Staaten von Amerika und gegen die Republik Mexiko. Manches Mal schloss er Frieden mit beiden und ging für ein paar Wochen oder Monate gar in eines der Indianerreservate, die man auf amerikanischer Seite eingerichtet hatte, brach jedoch immer wieder mit einer Handvoll Kriegern aus und verbreitete erneut Gewalt und noch grässlicheren Schrecken. Einmal setzte die US-Armee einen richtigen Feldzug mit eintausend fünfhundert Soldaten in Gang, wollten Geronimo mit seinen damals achtzig Kriegern einkesseln. Doch dies gelang der Armee trotz aller Mühen über viele Monate hinweg nicht. Erst als die US-Armee die Erlaubnis von Mexiko erhielt, die Indianer auch über die Landesgrenze hinaus zu verfolgen, wurden Geronimo und seine Kämpfer in echte Bedrängnis gebracht.
Jules erzählte Alina auch die Geschichte von Jimmy McKinn, genannt Santiago. Er war ein Farmerjunge aus der Gegend von Deming, einer Stadt im Südosten von New Mexiko. Als die Horde von Geronimo eines Tages an den Feldern der Familie vorbeikam und ihn und seinen älteren Bruder Martin erspähten, überfielen sie die beiden Jugendlichen, töteten den siebzehnjährigen Martin, entführten den dreizehnjährigen Jimmy. Denn er schien ihnen noch jung genug, um seine weiße Abstammung im Laufe der Zeit zu vergessen und zu einem echten Apachenkrieger zu werden. Dies war in jener Zeit recht beliebt unter den Apachen. Durch die Entführung von weißen Kindern schwächten sie den Feind nicht nur um einen späteren Kämpfer, sie erhöhte gleichzeitig die eigene Zahl ihrer Krieger. Viele Siedler tätowierten deshalb die Anfangsbuchstaben der Namen der Kinder auf deren Unterarme, um sie später und selbst nach einer jahrelangen Entfremdung noch als Weiße identifizieren zu können.
Die Entführung und spätere Befreiung des jungen Jimmy Santiago McKinn wurde damals zu einer Zeitungssensation. Später wurden sogar Bücher darüber veröffentlicht. Jules hatte eines davon in der Bibliothek des Knaben-Internats in Montreux gefunden und geradezu verschlungen. Und so schilderte er Alina aus dem Gedächtnis heraus und in möglichst blumigen Worten, wie es Jimmy Santiago McKinn bei den Apachen ergangen sein mochte, wie hart ihn die Krieger behandelt hatten, nämlich genauso hart, wie jeden ihrer eigenen Knaben. Doch Jimmy gefiel das freie Leben der Indianer ungemein gut und er lernte ihre Sprache überraschend schnell, fühlte sich schon bald in ihrer Mitte geborgen und als Teil ihrer Gruppe. Als Geronimo ein paar Monate später wieder einmal kapituliert hatte und man die Indianer in die Reservate zurückbrachte, erkannte man den weißen Jungen. Jimmy weigerte sich jedoch, zurück zu seiner Familie zu gehen, wollte lieber bei den Apachen bleiben. Sein älterer, getöteter Bruder Martin hatte er ebenso vergessen oder verdrängt, wie die immer noch um sein Leben bangenden Eltern.
Alina hörte staunend zu, fragte immer wieder nach, wollte von Jules mehr über diese Western-Geschichte aus dem echten Leben wissen. Und so musste Jules für seine Antworten immer öfter spekulieren oder auch Begründungen erfinden, fühlte sich dabei zunehmend unwohl. Auch Alabima hörte dem Gespräch der beiden zu, amüsierte sich über die oft haarsträubenden Erklärungsversuche und Ausflüchte ihres Ehegatten.
»Vielleicht solltest du das Buch besser noch einmal lesen, Jules, wenn wir wieder zu Hause sind«, griff sie irgendwann ein. Jules fühlte sich sogleich in seiner Ehre gekränkt, denn selbst Alina schaute ihn nun mit einem ähnlich süßen Blick an, zeigte ihm deutlich ihre längst erwachte Skepsis gegenüber den Antworten ihres Vaters.
»Es ist auch schon lange her, seit ich es gelesen habe. Gebt mir ein paar Minuten.«
Mit diesen Worten setzte er sich mit dem Laptop an den Tisch im Motelzimmer und begann zu recherchieren. Schon wenig später meldete er sich bei den beiden.
»In Truth or Consequences, das ist eine kleine Stadt im Süden von New Mexico, gibt es ein Museum über Geronimo und die Apachen. Jedenfalls heißt es Geronimo-Springs-Museum. Dort finden wir vielleicht weitere Antworten, Alina.«
Seine Tochter zeigte sich begeistert, Alabima zuckte gleichgültig mit den Schultern.
»Ob Chufu und Mei wohl Lust auf einen Museumsbesuch haben?«, mutmaßte sie.
»Mach dir um die beiden keine Gedanken. Die können den Tag auch problemlos im Bett verbringen und ...«
Der strafende Blick seiner Frau ließ Jules verstummen. Doch Alina blickte ihren Vater aus großen Augen an.
»Und was?«, fragte sie neugierig.
»Und frühstücken«, redete sich Jules heraus.
»Den ganzen Tag lang frühstücken?«, meldete seine Tochter ihre erwachte Skepsis an.
»Oder Fernsehen«, wich ihr Vater weiter aus, womit sich die Kleine nach kurzem Nachdenken dann doch zufriedengab.
Jules und Alabima schauten sich schmunzelnd an. Was doch eine Fünfjährige alles schon mitbekam? Und mit welch dürftigen Erklärungen man sie Gott-sei-Dank noch zufrieden stellen konnte?
*
»Verdammt.«
Reginald McPhearsen senkte die Times und starrte mit in sich gekehrtem Blick einen Moment lang geradeaus und an die gegenüberliegende Wand, ohne den dort hängenden Monet wirklich zu sehen. Auf Seite elf hatte er einen kurzen Artikel über den Industriellen Alioth Milkins gefunden. Er war von seiner Haushälterin am gestrigen Morgen tot in seiner Stadtwohnung in London aufgefunden worden. Herzversagen, lautete die Diagnose des Gerichtsmediziners. Ein kurzer Nachruf gab dem Leser einen Überblick über das Leben des einflussreichen Wirtschaftsführers, zählte auch seine beiden Ehen und Scheidungen auf, verwies auf drei erwachsene Kinder, davon zwei Ärzte und eine Historikerin, und erwähnte gewisse Gerüchte über eine bevorstehende Zahlungsunfähigkeit. Selbstmord wurde jedoch ausgeschlossen.
»Verdammt.«
Noch einmal murmelte Reginald dieses eine Wort, bevor er zum Blackberry griff und die Nummer seines Bruders Silver anrief.
»Ja«, meldete der sich wie gewöhnlich ohne Nennung seines Namens.
»Ich bin’s. Hast du’s schon gelesen?«
»Was denn?«
»Das mit Alioth.«
Das Zögern von Silver am anderen Ende der Verbindung gab Reginald die Antwort und so fuhr er mit einer Erklären fort: »Seine Haushälterin hat ihn gestern tot in seiner Wohnung hier in London gefunden. Herzversagen, wie die Ärzte meinen.«
Weiterhin blieb es auf der Gegenseite still.
»Bist du noch dran?«, fragte deshalb der ältere Bruder nach.
»Ja, ja, … schon …«, kam die zögerliche Antwort von Silver, »sollen wir uns treffen?«
Reginald war klar, dass man übers Telefon keine Unterhaltung über den Tod eines langjährigen Geschäftspartners führen sollte.
»Heute Morgen bin ich voll. Wir könnten uns aber zum Lunch treffen. Um eins. Bei mir im Büro.«
Silver stimmte zu und sie unterbrachen die Verbindung.
War sein Vater vollkommen durchgedreht? Hatte er innerhalb einer Monatsfrist tatsächlich einen zweiten Mord in Auftrag gegeben? Gegen den ausdrücklichen Willen und den Entscheid seines ältesten Sohnes und Nachfolgers?
Reginald war sich sicher, dass Oldman McPhearsen kaum mehr um die Macht im Familienkonzern kämpfen konnte. Dazu war er nicht mehr rüstig genug. Doch der störrische alte Mann hatte sich vielleicht in eine fixe Idee verrannt. Was hatte er noch mal gefaselt? Etwas wie, niemand bestiehlt uns, ohne dass er dafür bezahlt. War der Alte also auch für den Tod von Alioth verantwortlich? Hatte dabei wieder dieser verdammte Lawrence del Mato die Finger drinstecken, war einmal mehr zum verlängerten Arm des zunehmend paranoiden Alten geworden?
Reginald kannte den windigen Anwalt mit französischer Abstammung. Im Auftrag des Oldman, aber auch von Alioth, musste er mindestens ein Dutzend Mal in der Vergangenheit sehr unbequeme Dinge für den Familien-Konzern erledigt haben. Nachdem Reginald die Konzernspitze offiziell übernommen hatte, ließ er sich alle Zahlungen an den Anwalt del Mato zusammenstellen. Insgesamt waren über all die Jahre mehr als dreiundzwanzig Millionen Pfund an den Franzose geflossen, das meiste unter dem allgemeinen Titel Beratungsaufwand und mit einer schlampigen Auflistung irgendwelcher Arbeitsstunden zu irgendwelchen erfundenen Themen.
Bislang hatte Reginald den Mann nur ein einziges Mal persönlich getroffen, ihn eingeschätzt und abgewogen. Dieser Lawrence del Mato war ein skrupelloses, geldgieriges Ungeheuer. Ihm fehlte jegliches Unrechtsbewusstsein. Dieser Anwalt teilte die Welt ein in wenige Tüchtige und viele Opfer, war wahrscheinlich weit zynischer und abgebrühter als er selbst oder Silver. Um diesen Anwalt auszuschalten, musste Reginald dem Alten erst den Geldhahn zudrehen. Doch Ollie McPhearsen hatte vorgesorgt und eine Anzahl privater Bankkonten stets vor seinen beiden Söhnen geheim gehalten. Wie viel Geld dort lag, konnte Reginald kaum abschätzen. Doch fünfzig bis einhundert Millionen Pfund waren es bestimmt.
Reginald dachte ein paar Monate zurück, als Silver und er versucht hatten, den Oldman mit einem Trick zu entmündigen und ihn in ihre bedingungslose Obhut zu überführen. Doch irgendwie hatte der Alte den Braten gerochen, hatte ihnen an einem der Sonntage höhnisch lächelnd die Berichte zweier anerkannter Psychologen vorgelegt. Sie bestätigten dem alten McPhearsen die volle geistige Leistungsfähigkeit. Die Untersuchungsberichte wollte der Oldman, wie er ihnen genüsslich mitteilte, von nun an jedes Quartal erneuern lassen, als eine Vorbeugung, meinte er grinsend, führte ihren Zweck gegenüber seinen Söhnen jedoch nicht weiter aus.
Dieser verbohrte, paranoide und senile Schwachkopf bringt uns alle noch in Schwierigkeiten, prophezeite sich Reginald. Und das erste Mal dachte er darüber nach, auf welche Weise man den eigenen Vater gefahrlos beseitigen konnte.
*
Alabima und Jules mussten an diesem Morgen mit Alina zu einem Kinderarzt. Die Kleine beklagte sich nach dem Aufwachen über Ohrenschmerzen. Die Abklärungen ergaben eine harmlose Entzündung, die der Arzt mit rezeptfreien Tropfen behandeln wollte. Chufu und Mei waren nicht mit zur Klinik gefahren, schlenderten stattdessen durch die Straßen von Old Santa Fe, besuchten die zahlreichen Kunstgalerien und Boutiquen. Mei fand für sich einen wunderschönen Fleece Schal mit indianischen Mustern. Sie wurden in Handarbeit in einem nahen Indianerreservat von den Mädchen und jungen Frauen hergestellt, wie die Verkäuferin ihnen freundlich lächelnd versicherte. Chufu hegte zwar Zweifel, doch Mei war begeistert. Nach dem Kauf traten sie wieder auf den Gehsteig hinaus, der rund um die Plaza lief. Nicht weit entfernt saß ein junger Mann auf dem erhöhten Betonboden, hatte seinen Rücken an einen der Pfosten des Vordachs gelehnt und blickte träge und unbestimmt in ihre Richtung. Neben ihm stand ein Pappschild und ein Becher, wohl um das Kleingeld spendierfreudiger Mitmenschen aufzusammeln. Als sie nähertraten, sahen sie, dass der Becher bereits reichlich gefüllt war, obwohl der Kerl noch nicht dagesessen war, als sie die Boutique betreten hatten. Sogar eine zehn Dollar Note schaute keck und lockend aus dem Becher heraus, entweder als ein Beispiel christlicher Nächstenliebe oder als reiner Werbetrick des Bettlers. Auf dem Schild daneben stand: Doch dient mein Wort zum Samen, draus dem frechen Verräter Schande sprießt, den ich hier speise.
Chufu schüttelte den Kopf über diesen wirren Spruch. Mei dagegen zuckte erkennend zusammen. Denn die Worte stammten aus der Göttlichen Komödie von Dante, einem der bedeutendsten Werke der Weltliteratur und einem ihrer Lieblingsbücher.
Im Teil Inferno legte der größte italienische Dichter diesen Satz den Seelen im Fegefeuer in den Mund. Die Lebenden sollten dank ihnen die Wahrheit erfahren und für sich selbst Fürbitte oder Abbitte tun.
Ob jedoch tatsächlich der kaum verständliche Spruch auf dem Schild oder nicht doch eher das freundlich-fröhliche Gesicht des Bettlers für den Geldsegen der Passanten sorgte, mochten weder Chufu noch Mei entscheiden. Der junge Mann besaß jedenfalls ein sehr fein geschnittenes Antlitz, fast perfekt oval, jedoch mit einem zierlichen, spitzen Kinn, das von einem dunkelblonden, dünnen Bartflaum umflossen wurde. Auch das schulterlange, leicht gewellte Haupthaar besaß dieselbe Farbe. Seine Augen strahlten dagegen in einem intensiven blau, wirkten beinahe suggestiv, vielleicht auch, weil sie ein ganz klein wenig zu eng beieinanderstanden. Die wohlgeformte, nicht zu große Nase rundete den äußerst erfreulichen Gesamteindruck ab. Ja, man konnte den Kerl durchaus als hübsch bezeichnen. Zudem ging von seinem Blick eine gewisse Verwegenheit aus. Der ideale Jesus Christ Darsteller im gleichnamigen Musical, fasste Chufu die gewonnenen Eindrücke in einem einzigen Bild zusammen.
»Ein netter Spruch«, meinte Mei im Vorbeischlendern und lächelte dem Bettler zu.
»Ja, Dante hatte es echt drauf«, kam die saloppe Antwort von unten. Die Chinesin blieb stehen, blickte noch einmal in das intensive Blau der Augen.
»Sie mögen Dante?«, fragte sie, ohne eigentlich zu wissen, weshalb.
»Nein, nicht nur Dante, sondern alle großen italienischen Künstler der Renaissance, ob Raffael, Bramante oder Michelangelo.«
»Aha, ein Kunstliebhaber«, stellte Chufu trocken und doch etwas spöttisch fest, lächelte auch ein wenig verächtlich auf den jungen Mann herab.
»Wer die Museen von Florenz und Rom gesehen hat, der muss einfach von all den klassischen Meistern begeistert sein«, kam die etwas überraschende Antwort.
»Sie waren schon in Italien?«
Der Dunkelblonde nickte.
»Selbstverständlich. Viele Male. Meine Eltern schleppten mich jeweils mit. Im Sommerurlaub und als Kind.«
Der Mann sprach das Englisch ein wenig hart aus und deshalb fragte Chufu nach: »Dann stammen Sie aus Europa?«
Der Blauäugige nickte: »Aus Deutschland.«
»Oh, und ich komm aus der Schweiz«, entschlüpfte es dem Philippinen, worauf der andere seine Lippen etwas spöttisch schürzte und meinte: »Ja, ja, die Globalisierung. Sie versprengt die Völker bis in die hintersten Flecken der Erde.«
Und als Chufu nicht sogleich etwas zu erwidern wusste, fügte er schelmisch lächelnd hinzu: »Nicht, dass ich die Schweiz als diesen Ort bezeichnen möchte.«
»Aha. Ein Philosoph und Weltbürger«, mutmaßte Chufu anzüglich.
»Nein, mein Herr. Eher ein Soziologe und Erdbewohner.«
»Sie haben studiert? Soziologie? In Deutschland?«
Der Dunkelblonde nickte.
»Ja. Zuerst ein paar Semester Kunstgeschichte. Doch danach hab ich mich doch dem Teufel verschrieben.«
»Dem Teufel?«
»Ja, dem Teufel der Bildungszertifikate.«
Chufu und Mei blickten einander an, ohne zu verstehen. Doch statt das Thema zu vertiefen, wollten sie etwas ganz anderes vom Deutschen erfahren.
»Und was hat Sie nach Santa Fe verschlagen?«
»Nichts und alles«, orakelte dieser, »ich lass mich dorthin treiben, wohin mich der Wind bläst.«
»Und Sie betteln.«
Die Stimme von Chufu drückte einen Tadel aus.
»Ehrlich gesagt, nein«, gab der junge Mann offen lächelnd zurück, »ich setz mich bloß in die Sonne, stell ein Pappschild und einen Becher neben mir auf, denke nach, beobachte die Menschen, freue mich des Lebens. Und nach zwei oder drei Stunden stehe ich wieder auf, leere den Becher und mach mir einen schönen Tag.«
Das Lächeln des Deutschen hatte sich während seiner Erklärung in ein spöttisches Grinsen verwandelt, das ihm jedoch umwerfend gutstand. In diesem Moment war er das Ideal eines Sonnyboys, eines Lichtgottes, der das Leben und die Menschen liebte, dem niemand wirklich böse sein konnte, weil er ganz einfach zu sehr strahlte, beinahe überirdisch, den täglichen Sorgen und Nöten als einer der Wenigen längst entrückt war.
»Aber wie sagten Sie vorhin? Ich meine, das mit dem Teufel und den Bildungszertifikaten?«, wollte der Philippine nun doch von ihm wissen.
»Möchtet Ihr wirklich einen langweiligen Vortrag über ein leidiges Thema von mir hören?«, gab der Deutsche gespielt unwillig zurück, worauf Mei sogleich zu nicken begann.
»Na gut. Aber setzt euch doch bitte zu mir. Solange ihr vor meinem Becher steht, wirft nämlich niemand was rein.«
Längst wurden die drei jungen Leute von anderen Passanten argwöhnisch gemustert oder belächelt. Und als sich die beiden Asiaten auch noch neben dem Bettler auf dem Gehsteig niederließen, gab es einige erstaunte Blicke und leichtes Kopfschütteln.
»Also, wo fange ich an«, dachte der Dunkelblonde kurz nach, »ah, ja, ich hab’s. Ich weiß nicht, wie das bei euch zu Hause so ist, doch in Deutschland erzählt man den Kindern seit dreißig Jahren dieselbe Lüge über Bildung und ihre Wichtigkeit. Bildung sei der Schlüssel zum Glück. Wer sich viel Wissen aneignet, schafft für sich ein Sprungbrett für die Karriere. Zeige Leistung in der Schule und du machst deinen Weg im Leben, und so weiter und so fort.«
Die beiden Asiaten nickten zu seinen Worten, denn er drückte im Prinzip das aus, woran sie selbst glaubten.
»Aber das ist eine einzige Verarsche. Zumindest, wenn man zu Ende zu denken vermag«, fügte der Deutsche ärgerlich an, »überlegt doch mal. Nachdem alle Menschen die tollste Ausbildung und die höchsten Fähigkeiten erworben haben, wer putzt dann das Gemüse für die Kantinenküche? Oder kehrt den Dreck von der Straße? Oder verdingt sich als Anstreicher gesichtsloser Wohnsilos? Höchstens zwanzig Prozent aller Arbeitsstellen auf dieser Welt sind abwechslungsreich, täglich fordernd und darum inspirierend, besitzen zudem einen schöpferischen Anteil. Achtzig Prozent dagegen sind entweder körperliche Zuarbeiten, repetitive Tätigkeiten oder sterbenslangweilig und gedankentötend.«
»Ja, da geben wir dir Recht«, meinte Mei vorsichtig und duzte den jungen Mann das erste Mal, »nicht jeder eignet sich zum Erfinder, Arzt oder Manager in der Wirtschaft. So wird der Weg der Schule und der Ausbildung, der Bildung ganz allgemein, zu einem Ausleseverfahren, in dem sich jeder bewähren muss, aber auch bewähren kann. Jeder hat dieselben Chancen, falls der Staat für ausreichend Gerechtigkeit besorgt ist.«
Der deutsche Lichtgott lächelte die Chinesin spöttisch an.
»Wenn 80 % der Menschen auf jeden Fall auf der Strecke bleiben müssen, was, bitte schön, ist bei diesem Ausleseverfahren dann noch gerecht? Mag sein, dass jeder Fünfte seinen gewünschten Weg einschlagen kann. Doch er tut es auf dem Buckel von vier anderen, gescheiterten Menschen, die möglicherweise bloß ein wenig Pech hatten oder zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort waren. Wenn wir uns die heutigen Politiker und Wirtschaftsführer etwas genauer betrachten, aber auch viele der Wissenschaftler, dann gewinnen in diesem Verfahren nicht wirklich die besten, die klügsten oder gar edelsten Menschen, sondern vor allem die Drecksäcke, die Skrupellosen, die Brutalen und diejenigen ohne Gewissen. Denn selbst das Bildungssystem in Deutschland, ja überhaupt in Europa, ist so aufgebaut, dass stets ein ähnlicher Menschenschlag zum Gewinner wird. Wer über genügend Geld verfügt, kauft sich Hilfslehrer. Und falls das noch nicht genügt, dann wird der Zögling in ein Internat gesteckt. Versagt er auch dort, dann kauft man ihm einen Studienplatz irgendwo auf der Welt, besorgt für ihn Ghostwriter für die Facharbeiten, lässt irgendjemanden die Doktorarbeit schreiben und verschafft ihm anschließend über Beziehungen eine ansprechende Arbeitsstelle. Wer bereits oben steht, kann in diesem System gar nicht fallen.«
»Das sind aber sehr verbitterte Worte«, meinte Chufu und wollte sich erheben, denn ihm wurde diese Anklage eines freien Wettbewerbs nun doch zu viel. Aber der Deutsche reagierte sogleich auf seine Körpersprache, fügte rasch und im versöhnlichen Tonfall an: »Wisst Ihr, ich bin nicht gegen die Auslese, überhaupt nicht. Auch akzeptiere ich, dass nicht jeder Mensch dieselbe Ausgangslage besitzen kann und es darum bereits nach der Geburt Unterschiede gibt, die auch ein langes Leben oder ein aufmerksamer Staat niemals vollständig beseitigen kann. Was mich jedoch zornig macht, ist dieses andauernde Belügen der Kinder und Eltern durch die Politiker und die Wirtschaftsführer. Man verspricht ihnen, strengt euch an, dann wird was aus euch. Aber letztendlich geht es doch bloß darum, möglichst viel Energie aus jedem Individuum heraus zu pressen, zuerst in der Schule, dann in der Lehre oder dem Studium und danach im Arbeitsalltag.«
»Aber das muss doch nicht die Regel sein…«, warf Mei ein, erntete jedoch einen verächtlichen Blick des Deutschen und verstummte deshalb.
»Schaut doch genau hin. Nehmen wir als Beispiel eine Unternehmensberatung. Sie stellt die besten Absolventen der besten Universitäten an, formt sie in internen Seminaren für ihr Aufgabengebiet, setzt sie auf Projekte an, ähnlich wie Spürhunde, die jeder Fährte bis zu ihrem Ende folgen und die Opfer ohne Skrupel zerfleischen können. Und sie haben durchaus Erfolg in ihren Bestrebungen, denn die Studienabgänger sind ja höchst motiviert und außerordentlich leistungsfähig. Zudem winkt ihnen ein rascher Aufstieg innerhalb des Unternehmens, vom Junior zum Consultant, danach zum Senior und wenig später, faktisch als Olymp, die Partnerschaft. Jeder engagierte Mitarbeitende soll dies innerhalb von zehn Jahren erreichen können, so jedenfalls versichert man es all den armen Hunden.«
Der Dunkelblonde unterbracht seine Ausführungen für einen Moment, weil eine Frau neben ihnen stehen geblieben war, in ihrer Brieftasche eine 5-Dollar-Note hervorkramte und vorsichtig in den Kunststoffbecher stopfte, ja darauf bedacht, ihn nicht etwa umzustoßen oder mit ihren Fingerspitzen in die unmittelbare Nähe der 10-Dollar-Note zu gelangen.
Der Deutsche schenkte ihr ein strahlendes Lächeln, das auf ihren Wangen eine zarte Rötung hinterließ. Mei hätte beinahe laut aufgelacht.
»Doch nach sechs harten Jahren und längst zum Senior-Berater geworden, eigentlich auf dem Sprung in die höchste Liga, wird das Unternehmen verkauft oder mit einem anderen fusioniert. In der Folge gibt es viel zu viele Partner, viel zu viele Seniors, viel zu viel von allem. Wenn dazu noch durch Rezession einige erwartete Großprojekte ausbleiben, wird gnadenlos ausgedünnt. Die Teuersten, die zuvor hochgelobten Besten, ja die am meisten Gehegten, müssen als Erste gehen, denn die Kosteneinsparung hilft den verbleibenden Partnern ihr hohes Einkommen trotz Wirtschaftsflaute und Fusion beizubehalten. Gerechtigkeit? Nicht in einem System der gegenseitigen Ausbeutung, der Übervorteilung und des Egoismus.«
»Karl Marx scheint auferstanden zu sein«, frotzelte Chufu nun, erntete vom Deutschen jedoch nur ein müdes Lächeln.
»Was Marx veröffentlicht hatte, das haben griechische Philosophen mehr als zweitausend Jahre zuvor bereits zu ihren Themen gemacht. Ob Platon oder Epikur. Ja selbst bei Sokrates, wenn man ihn richtig zu lesen vermag.«
»Und wie sieht denn dein System einer gerechteren Welt aus?«, wollte nun Mei vom Bettler wissen.
Der Dunkelblonde blickte sie erst nachdenklich an, entweder, weil er wirklich über seine Antwort noch brütete oder aber, weil er sich fragte, ob er der Chinesin offen und ehrlich Auskunft geben sollte.
»Zuerst einmal kann es gar keine Gerechtigkeit geben, denn jeder Mensch versteht darunter etwas anderes, entsprechend seiner persönlichen Situation, seinem Umfeld, seinen Ansichten über die Welt. Wir sollten uns deshalb vom Gedanken einer gerechten oder gerechteren Welt lösen und den Tatsachen ins Auge blicken. Doch unsere Politiker streuen auch in diesem Punkt den Völkern weiterhin Sand in die Augen, machen nicht einlösbare Versprechen, reden von Gerechtigkeit, verkaufen jedoch bloß ihre Wähler für dumm. Und die Leute lassen sich stets bereitwillig darauf ein, weil sie glauben, ihnen wird eine Last abgenommen, nämlich die Last, für sich selbst zu sorgen. Ein überaus gerechter Staat soll sie stattdessen schützen und hegen. Dabei wird jedoch stets mehr Macht in noch weniger Hände gelegt. Niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit verfügten die Staaten und ihre Repräsentanten über eine so flächendeckende und allgegenwärtige Machtfülle wie heute. Ist es da Zufall, dass auch noch nie in der Geschichte der Menschheit so wenige Menschen einen solch immensen Reichtum anhäufen konnten? Glauben wir noch an einen starken, gerechten Staat? Ist es nicht vielmehr so, dass die Politiker in unserem heutigen System bloß der bisherigen Oberschicht noch leichter und intensiver zuarbeiten können? Uns alle zu Gunsten weniger Bonzen faktisch versklaven?«
Mei und Chufu blickten sich zweifelnd an.
»Schaut doch genauer hin. Nehmen wir als weiteres Beispiel die neue Verordnung des europäischen Parlaments zur den Boni der Banken.«
Die beiden Asiaten schauten den Deutschen erstaunt fragend an.
»Das EU-Parlament hat beschlossen, dass die Banken nur noch Boni in Höhe eines Jahresgehalts ausrichten dürfen oder von höchstens zwei Jahresgehältern, wenn die Aktionäre ausdrücklich zustimmen. Dies schien auch ein riesiges Anliegen der Bevölkerung in der EU zu sein, wenn man den Journalisten Glauben schenken wollte. Die EU hat in diesem Sinne die gierigen Banker endlich in die Schranken gewiesen.«
Als er sah, dass die Beiden verstanden hatten, fuhr er fort.
»Spinnen wir diesen Faden einmal weiter und sehen, was als Konsequenz daraus entsteht«, meinte er geheimnisvoll, um ihre Neugierde anzustacheln, »falls die Bonuszahlungen ans Management tatsächlich sinken sollten, sparen die Banken im Gegenzug einen Haufen Geld. Dieses Geld wird zum größten Teil an die Aktionäre als zusätzliche Dividenden ausbezahlt. Doch der kleine Mann von der Straße ist kein Aktionär. Die Banken gehören bereits den Großkapitalisten, den reichen Erben der seit Generationen wohlhabenden Familien. Sie bekommen die bislang als Einkommen ausbezahlten Boni ihrer Bankangestellten dank großzügiger Hilfe aus Bruxelles als Sonderzahlung zugeteilt.«
Chufu wiegte seinen Kopf hin und her, gab dem Deutschen damit zu verstehen, dass er die Aussage zumindest abwägen wollte, ihr jedoch nicht sogleich zustimmen konnte.
»Aber auf den ausbezahlten Boni wurden bislang Sozialabgaben und Versicherungsprämien abgeführt und selbstverständlich auch noch hohe Einkommenssteuern. Dagegen werden Dividenden von den meisten Staaten privilegiert besteuert, können zum Beispiel mit Anlageverlusten verrechnet werden oder weisen einen geringen Höchststeuersatz auf. Doch die Völker in der EU nehmen diese weitere Ungerechtigkeit ihrer Staaten tatsächlich ohne Aufruhr und Widerstand hin. Letztendlich entzieht die neue EU-Verordnung den Rentensystemen der Gliedstaaten wichtige Sozialbeiträge und Steuereinnahmen, drückt diese Gelder den Reichsten auf Erden zusätzlich in die Hand. Und da redet noch jemand von Gerechtigkeit? Doch woher werden sich die Staaten die künftig fehlenden Einnahmen holen? Etwa bei den Milliardären dieser Welt? Mit Sicherheit nicht, wie uns die Erfahrung lehrt. Nein, diese Lücke wird man einmal mehr über noch höhere Mehrwertsteuersätze und noch geringeren Leistungen des Staates abgegolten, also auf dem Rücken der bereits heute gebeutelten Menschen.«
Er hatte sich nun in Rage geredet, fuhr sich mit der Zungenspitze nervös über die trocken gewordenen Lippen.
»Ich habe keine Lösung für eine gerechtere Welt. Doch der Einfluss des Staates auf die Gesellschaft sorgt auf keinen Fall für mehr Gerechtigkeit, sondern beschleunigt bloß den Geldtransfer von unten nach oben, wie die Statistiken über die Armut und den Reichtum in der Welt uns jedes Jahr von neuem vorrechnen und beweisen. Darum sehe ich persönlich nur eine Lösung. Wir müssen die Macht des Staates zurückbinden, müssen einen großen Teil seines Einflusses wieder aus unserem Leben entfernen. Erst in einer nicht mehr zwangsweise nivellierten Welt, die uns auf den ersten Blick ungerecht erscheint, hat die Mehrzahl der Individuen wieder echte Chancen für einen Aufstieg, die Reichen die tatsächliche Chance auf einen Abstieg. Ja, ihr müsst mich gar nicht so ungläubig anschauen. Alles, was ein Staat tatsächlich erreicht, ist doch die Nivellierung der Chancen der Chancenlosen, jedoch niemals Gerechtigkeit für alle. Der Staat zwingt die Masse der Menschen auf einen ähnlichen Nenner und nennt dies Gerechtigkeit, lässt dagegen die Oberschicht völlig unangetastet. Damit schafft er die besten Voraussetzungen, damit sich niemals etwas an der seit Jahrtausenden geltenden Ordnung ändert. Die eigentlichen Hüter und Bewahrer der Ungerechtigkeit sind exakt diejenigen Politiker, die vorgeben, sich für mehr Gerechtigkeit einzusetzen.«
Mit diesem Schlusswort blickte er die beiden Asiaten abwechselnd an, wartete auf ihre Zustimmung oder auf Ablehnung. Mei wirkte über den sichtbar gewordenen Hass des Deutschen auf alle Staaten und Politiker dieser Welt erschüttert und erschrocken zugleich, während Chufu skeptisch dreinblickte, sich jedoch als erster fasste.
»Ich denke, du siehst das zu eng und zu schwarz.«
»Ja, ich weiß, alles ist grau. Doch Grau kann nicht die Farbe der Gerechtigkeit sein. Denkt mal darüber nach.«
Sie blickten einander an. Dann schüttelten sie sich zum Abschied die Hände. Mei steckte noch eine 20-Dollar-Note in den Becher, dann standen sie auf.
»Und aus diesen Gründen lebst du als moderner Dionysos?«, fragte Chufu den Deutschen noch.
»Nur wer die Fesseln der Ungerechtigkeit sprengt, kann für sich persönliches Glück erlangen«, philosophierte der blauäugige Deutsche, blinzelte zu ihnen hoch und verkniff seinen Mund zu einem schrägen Grinsen, »das ist übrigens auf meinem Mist gewachsen.«
*
Seine Geschäfte hatten sich an diesem Morgen zuerst ein wenig aufgehellt, denn in seiner Mailbox fand er zwei Aufträge aus Deutschland. Sie würden Michael Langton für die nächsten paar Wochen ein mäßiges Einkommen garantieren. Gin Davis war nach ihrer Flucht erst am frühen Morgen in ihr Apartment zurückgekehrt, verkatert und zerknittert, war noch in ihren Kleidern erschöpft aufs Bett gefallen und sogleich eingeschlafen. Michael hatte ihr die Stiefeletten von ihren niedlichen, kleinen Füssen gestreift, ihr den Rock vom Becken und über die schlanken Schenkel gezogen, auch den Reißverschluss ihres Trainingsanzugs geöffnet und die flauschige Pfulmendecke über sie ausgebreitet. Dann war er so leise wie er das Zimmer betreten hatte, wieder gegangen, hatte vom Flurboden die achtlos fallen gelassene, schmale Handtasche aufgehoben, die vielleicht auch nur von der Ablage herunter gekippt war, hatte sie wieder drauf gestellt und zurechtgerückt.
Auf einmal war er jedoch erstarrt und hatte sich mit einem Ruck aufgerichtet. Sein Blick hatte Erstaunen und Erkennen zugleich gezeigt. Auf Zehenspitzen war er zurück ins Schlafzimmer und zum Bett geschlichen, sich auf seiner Schlafseite auf die Matratze gekniet, sich über Gin Davis gebeugt und hatte an ihrem schulterlangen, dunkelbraunen Haar geschnüffelt. Ja, er hatte sich nicht geirrt. Neben Tabakrauch und Marzipan hatte er Rum und Cola, ihr Lieblingsgetränk gerochen, dazu Grapefruit und Moschus. Die süßen Mandeln und die Zitrusfrucht konnte er guten Gewissens seiner Ginnie zuordnen, denn er kannte alle ihre Parfüms. Doch Moschus? Er wusste, dass Gin keinen Moschusduft an sich mochte. Noch einmal hatte er sich deshalb über seine Freundin gebeugt, fand die Quelle des Duftes am Kragen und an der Schulter ihres Trainingsanzugs.
Michael hatte gefühlt, wie ihn die Eifersucht überkam und verbrennen wollte. Wo war seine Ginnie gewesen? Mit wem hatte sie sich getroffen? Ihn vielleicht gar betrogen?
Doch er hatte sich sogleich wieder zur Ordnung gerufen. Er kannte doch gar nicht alle Freundinnen von Ginnie. Eine davon mochte vielleicht nach Moschus riechen. Oder sie war tanzen und der DJ hatte einen Wange an Wange Song gespielt. Denn warum sollte ihm seine Ginnie auf einmal untreu werden? Sie hatte hier doch alles? Eine schicke Wohnung, genügend Taschengeld, ihre Freiräume und keine Sorgen. Michael vermochte seine Eifersucht trotzdem nicht völlig zu unterdrücken. Aber wie konnte er sich Gewissheit über die letzte Nacht verschaffen? Sollte er einen Privatdetektiv mit der Beschattung seiner Freundin beauftragen? Ihr vielleicht selbst nachspionieren? Das war doch Unsinn.
Er hatte auf die Armbanduhr geschaut, war aufgestanden und hatte das Schlafzimmer verlassen. Um neun Uhr fand die Telefonkonferenz mit einem Lieferanten in Guangdong statt. Er hatte sich beeilen müssen. Die Fahrt mit der MTR war allerdings kurz gewesen und so erreichte er sein Büro eine gute Viertelstunde vor neun, genügend Zeit für letzte Vorbereitungen.
Seit er die Wohnung verlassen hatte, drehten sich fast alle seine Gedanken um Gin Davis und ihre letzte Nacht, die sie irgendwo mit irgendwem verbracht hatte. Schübe von Eifersucht wechselten sich ab mit Phasen der Selbstberuhigung. Es war nicht das erste Mal, dass Ginnie mit einer Freundin den Abend oder die ganze Nacht verbracht hatte und erst am nächsten Morgen zurückgekehrt war. Doch bislang waren sie nie nach einem Streit auseinandergegangen, hatte ihm ihre Frauen-Abende jeweils ein paar Tage zuvor angekündigt.
Er musste sich zusammenreißen und sich konzentrieren. Gleich rief ihn Hun Hian an, der Entwicklungschef von Meekong Industries für den Bereich Haushaltsgeräte. Dem musste er klar machen, dass sein Kunde in Europa ein Kunststoffgehäuse in der Farbe Robin Egg Blue verlangt hatte und damit ganz bestimmt nicht die Farbe Eggplant gemeint war. Zudem hatten sie ein schwarzes, statt dem verlangten weißen Stromkabel verwendet. Die beiden Muster des neuen Mixers fanden darum keinen Anklang in Frankreich, sorgten dort stattdessen für heftige Vorwürfe an die Adresse von Michael Langton als den für alles verantwortlichen Vermittler. Hundertdreißig Dollar würde der Kunde von der versprochenen Provision abziehen, die Auslagen für den sinnlosen Transport nach und die Zollgebühren in Frankreich. Das war zwar bloß ein kleiner Rückschlag für Langton, doch das würde er nicht auf sich sitzen lassen. Diesmal nicht. Für diesen Fehler musste Meekong Industries geradestehen und die korrekten Muster so rasch als möglich und auf ihre Kosten ausliefern.
Das Telefonat verlief dann allerdings wenig zufriedenstellend. Der Fehler mit dem Kabel wurde zwar eingeräumt, die Farbe des Gehäuses jedoch vehement bestritten.
»Schauen Sie sich doch die technische Beschreibung an, Mr. Langton«, flötete Hun Hian in den Hörer, »da steht klipp und klar Eigelb.«
Michael blätterte seine Akten durch.
»Nein, Eischalen«, widersprach er dem Chinesen, »denn auf Seite drei steht ganz klar Egg blue.«
Einen Moment lang blieb es ruhig auf der anderen Seite, dann meldete sich der Entwicklungschef von Meekong Industries mit einem meckernden Lachen.
»Ja, Sie haben durchaus Recht, Mr. Langton. Auf Englisch steht da tatsächlich Egg blue. Doch weiter unten, in der chinesischen Übersetzung, was steht da?«
Michael suchte sich die entsprechende Passage mit den Augen heraus und erstarrte. Denn hier standen klipp und klar die Schriftzeichen für Eigelb. Das war ein grober Schnitzer des Übersetzers von Meekong, der die englisch gestellten Anforderungen des Kunden falsch in die Landessprache und damit in ihren Vorvertrag für die Bemusterung übertragen hatte.
Verdammt, dachte Langton, nicht schon wieder.
»Gemäß unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt bei Abweichungen in den sprachabhängigen Texten die chinesische Übersetzung, Mr. Langton, das wissen Sie doch?«
»Ja, ich verstehe, Mr. Hian«, knirschte Langton nach einem stillen Fluch in den Hörer, »können Sie trotzdem so rasch als möglich zwei neue Muster für meinen Kunden produzieren und ihm zusenden?«
»Zweihundertfünfzig Dollar«, war die trocken gestellte Forderung des Chinesen, »so viel kosten die neuen Muster.«
»Ja, geht in Ordnung«, lenkte Michael ergeben ein, »wenn es nur schnell geht.«
»Zwei Tage, Mr. Langton, zwei Tage«, hörte er noch, bevor die Verbindung unterbrochen wurde.
*
Sie verließen Santa Fe erst gegen Mittag und in Richtung Süden, planten ihre Ankunft in Truth or Consequences für den späteren Nachmittag. Wie von Alabima vermutet besuchten die Eltern mit Kind das Museum allein, denn Chufu und Mei verspürten keinerlei Lust auf Vergangenheitsbewältigung à la USA, wie die beiden abfällig meinten. Sie wollten stattdessen lieber ein wenig im Städtchen herum schlendern und herausfinden, warum die Stadt diesen seltsamen, beinahe martialischen Namen trug. Wahrheit oder Konsequenzen?
Gleich beim Betreten des Gebäudes wurden Tochter und Eltern von einer älteren Frau warmherzig und mit einem freundlichen Lächeln begrüßt: »Welcome to the Geronimo-Springs-Museum. How are you today, folks?«
»Thanks, we’re fine«, meinte Jules, »how are you?«
Die Frau stellte sich als Nancy Woodbridge vor, beglückwünschte sie zum Besuch ihres überaus interessanten Museums, zählte ihnen dann die verschiedenen Räume auf, beschrieb sie kurz, während sie den geringen Eintrittspreis kassierte, wies die Besucher auch auf die vielen interessanten Bücher zum Wilden Westen und zur Geschichte Amerikas im kleinen Shop hin und dass sie auf jeden Fall auch nach hinten raus gehen sollten, wo sie weitere Exponate im Freien finden konnten, für die sich der Abstecher lohnen sollten.
Zu dritt schlenderten sie gemütlich durch die Ausstellung, hatten sich dabei für den Uhrzeigersinn entschieden, betrachteten sich die ausgestellten Stücke aber mit mäßigem Interesse. Bereits im zweiten Raum fanden sie allerdings in einem Holzständer ein paar Kartontafeln mit den Fotos aller Schulabgänger der Stadt seit 1935. Alabima und Jules suchten spaßeshalber nach einem Sprössling mit dem Namen McKinn, wurden jedoch nicht fündig. So gingen sie weiter, schauten sich die Sammlungen mit Stücken aus der Gründerzeit an, hunderte von Pfeilspitzen und dutzende von indianischen Tonwaren, aber auch Gewehre und Gebrauchsgegenstände der Siedler und Rancher. Endlich gelangten sie zu einem recht kleinen Raum, der den Apachen gewidmet war, aber vor allem über das Leben von Geronimo berichtete. Sogar eine lebensgroße Wachsfigur war aufgestellt, zeigte einen lederhäutigen, gedrungenen Indianer mit verbitterten Gesichtszügen und einem überaus grausamen Mund. Alina stand lange Zeit still vor dieser Plastik und ihre Eltern konnten die Gedanken und Gefühle der Fünfjährigen in ihrem Gesicht ablesen. Da waren zuerst eine gewisse Scheu und auch ein Unbehagen zu erkennen. Sie wurden wenig später durch eine tiefe Nachdenklichkeit abgelöst, die stille Fragen stellte. Alabima und auch Jules wurde bewusst, dass ihre noch so junge Tochter viel zu wenig vom Leben wusste, um diesen furchtlosen und gleichzeitig so furchteinflößenden Krieger in ihre bisherige Welt einzuordnen. Und doch war da auch ein erwachendes Verständnis in der Mimik der Kleinen zu erkennen.
Auf einmal löste sich ihre Starre und sie ging beinahe ehrfürchtig zum ersten Schaukasten, suchte darin wohl nach dem berühmten Foto von Jimmy Santiago McKinn, welches ihn in zerlumpter, westlicher Kleidung in einer Gruppe von Apachenkindern zeigte, ein unglücklich dreinschauender Fremdkörper in der ihm kaum verständlichen Welt der Indianer. Jules und Alabima blickten über ihren Kopf hinweg in dieselbe Vitrine. Doch sie fanden darin bloß alte Zeitungsausschnitte und längere, erklärende Texte zu Geronimo. Alabima las sie für Alina laut vor und so erfuhren die drei, dass der Apachen-Anführer acht oder neunmal verheiratet gewesen war, dass er seine erste Frau und seine Kinder bei einem Überfall mexikanischer Soldaten verloren hatte, dass auch weitere seiner Ehefrauen im Kampf gegen die fremden Eindringlinge starben, dass Geronimo selbst als über achtzig Jähriger noch einmal geheiratet hatte, seine letzte Partnerin jedoch nach kurzer Zeit fort schickte und die Frau zu ihrem Stamm ins Reservat zurückging.
Alina hörte zu, nickte verständig. Jules beobachtete seine Tochter sehr genau, überwachte ihre Reaktionen auf das beschriebene harte, wilde und gewalttätige Leben eines Mannes, der sich nicht in eine neue Zeit einpassen konnte oder wollte. Als die Kleine hörte, wie man diesen berühmten, blutrünstigen Wilden im hohen Alter gar zur Weltausstellung nach St. Louis schleppte und ihn dort als gruseliges Schauobjekt einer vergangenen Epoche der lüsternen Menge sogenannter zivilisierter Menschen vorführte, da zog sie ihre Stirn in arge Runzeln und ihr Mund zeigte großen Unwillen und Abscheu.
Leider fanden sie keinen einzigen Hinweis auf die Entführung des jungen McKinn, weder ein Foto noch einen Zeitungsbericht oder auch nur einen erklärenden Texthinweis. Sehr enttäuscht gingen sie weiter, gelangten wenig später in einen Raum zur Geschichte der Namensgebung der Stadt. Truth or Consequences war eine landesweit berühmte Radio- und spätere Fernseh-Show gewesen, deren Moderator Ralph Edwards 1950 versprach, aus derjenigen Stadt, die sich für einen einzigen Tag den Namen der Show gab, die nächste Sendung zu moderieren. Das damalige Hot Springs in New Mexico meldete sich als erste Gemeinde. Doch die Ortschaft benannte sich nicht bloß für einen einzigen Tag um, sondern blieb beim Namen der Spielshow. Selbst drei Abstimmungen unter den Einwohnern der Stadt konnten daran nichts ändern am früheren spontan gefällten Entscheid. Der Showmaster Ralph Edwards blieb dem Ort darum auch später treu, besuchte ihn jedes Jahr zur selben Zeit. Truth or Consequences veranstaltete viele Jahre lang eine Parade und der berühmte Moderator war stets ihr Ehrengast. Selbst der Sattel, auf dem Edwards den Umzug jeweils per Pferd anführte, war im Museum ausgestellt. Und an den Wänden hingen die Fotos früherer Hollywood Berühmtheiten, die im Gefolge von Ralph Edwards an den Festlichkeiten teilgenommen hatten.
Weitere Räume zeigten dann für die Besucher aus der Schweiz wenig Interessantes und eher Lächerliches aus dem Leben alteingesessener Familien der Umgebung. Fotos, Kleidungsstücke und Gebrauchsgegenstände, manche fünfzig, manche hundert Jahre alt. Kaum etwas davon war museumswürdig. Doch die Sachen gehörten zur Geschichte dieser Stadt und waren darum am richtigen Ort.
Die Ausstellung im Freien zeigte ein nicht funktionstüchtiges Windrad mit Wasserpumpe und ein paar verrostete Pflüge. Dahinter lag noch ein einzelnes Blockhaus, das vor allem Proben von Mineralien und Metallen aus der Umgebung zeigte. Einige der Stücke waren durchaus ein paar Dollar wert und Jules wunderte sich, dass man sie so offen und nicht etwa in abgeschlossenen Vitrinen ausstellte. Selbst eine Videokamera fehlte wohl, wie sein prüfender Rundblick bewies.
Glücklicher Südwesten, dachte er bei sich, hier war die Welt wirklich noch in Ordnung.
Sie gingen zurück zum Eingangsbereich und fragten Nancy direkt nach Jimmy Santiago McKinn. Die ältere Frau hörte ihnen geduldig zu und schüttelte dann verneinend den Kopf.
»Selbstverständlich kennt fast jeder im Südwesten die Geschichte über den entführten Siedlerjungen. Aber hier im Museum werden Sie nichts darüber finden. Doch in etwa einer halben Stunde kommt Dorothe Allistor vorbei. Sie und ihr Mann Mike haben weite Teile unserer Ausstellung gestaltet, vor allem den Teil über die Apachen und über Geronimo. Vielleicht weiß sie mehr?«
Damit mussten sie sich vorerst zufriedengeben, schauten sich im Shop die zum Kauf angebotenen Bücher über den Wilden Westen durch. Darunter war ein gutes halbes Dutzend über die Apachen oder über Geronimo. Jules und Alabima sahen in den Inhaltsverzeichnissen nach, blätterten sie auch durch. Doch selbst hier wurden sie nirgendwo fündig. Jimmy Santiago McKinn schien keinerlei Raum in diesen Geschichten über den Wilden Westens einzunehmen und die fragenden Augen von Alina wurden immer betrübter.
Pünktlich um elf Uhr trat eine ältere Frau ein, begrüßte erst Nancy herzlich, wurde von ihr sogleich an die wartenden Lederers verwiesen. Man schüttelte die Hände und Jules erklärte Dorothe, was sie sich vom Museumsbesuch erhofft hatten.
Die Frau zeigte ein sanftes, hintergründiges, aber auch wissendes Lächeln.
»Mein Mike ist leider schon 1995 verstorben. Doch er hat in seinen letzten Jahren an der Geschichte des jungen Jimmy gearbeitet. Leider konnte er seine Forschung nicht mehr beenden. Lungenkrebs.«
Das letzte Wort sprach sie hart aus, als eine Anklage an die Welt, an ein ungerechtes Schicksal, vielleicht auch an ihre letzten achtzehn Jahre, die sie seit dem Tod ihres Mikes allein verbringen musste. Alabima und Jules kondolierten der älteren Frau, während Alina sie nur stumm ansah. Dorothe setzte wieder ihr Lächeln von zuvor auf, diesmal freundlich und tapfer.
»Das Leben gibt und nimmt und nur der Liebe Gott im Himmel kennt die Gründe dafür.«
Nancy mischte sich nun ein und fragte ihre Kollegin, ob denn noch etwas von Mikes Arbeit über Jimmy McKinn hier im Museum vorhanden wäre. Wie viele ältere Frauen wusste Nancy sehr genau, wie man mit alter Trauer am besten umging und Dorothe fasste sich tatsächlich wieder, hatte zwar feuchte Augen bekommen, aber nicht Weinen müssen.
»Bestimmt findet sich noch etwas davon im Archiv. Mike hatte bis zuletzt gehofft, dass jemand anderer nach ihm die Geschichte aufgreifen und zu Ende führen würde. Bitte warten Sie, ich sehe nach.«
Auch Alina hatte die feuchten Augen der Frau gesehen, wie sie sich rasch mit der Hand darübergewischt war und sie dann eilig verließ.
»Mike und Dorothe waren ein wunderbares Paar und sie liebt ihn immer noch«, erklärte ihnen Nancy leise. Dann musste sie allerdings zur ihrer Theke am Eingang zurück, denn vier neue Besucher waren eingetreten. Sie begrüßte auch diese warm und herzlich, verkaufte ihnen Tickets, erklärte die Anordnung der Räume im kleinen Museum und wies auf die Bücher im Shop hin.
Dorothe kam nach wenigen Minuten zurück, hielt eine dünne Aktenkladde in ihren Händen, zeigte ein zufriedenes Lächeln. Ihre Nase war noch etwas gerötet, ebenso ihre Augen. Sie hatte während der Suche im Archiv bestimmt ein wenig geweint und danach ihre Fassung wiedergefunden.
»Es ist leider wesentlich weniger, als ich gehofft habe«, teilte sie den Lederers mit, »was genau möchten Sie denn über Jimmy McKinn erfahren?«
»Eigentlich möchte vor allem Alina hier wissen, wie es Jimmy nach seiner Befreiung ergangen ist? Wie lebte er nach den traumatischen Erlebnissen bei den Apachen? Hatte er später noch mit Indianern zu tun? Wurde er glücklich? Wissen Sie etwas darüber?«
Dorothe hob ihre Augenbrauen und blickte die Fünfjährige das erste Mal direkt und erstaunt an.
»Ja, kennst du denn schon die Geschichte der Entführung?«
Alina nickte stumm, blickte die Frau mit ernsten Augen unverwandt an.
»Dann wollen wir doch einmal nachsehen, was mein Mike alles herausfinden konnte.«
Sie schlug die dünne Kartonmappe auf. Darin lagen ein paar handgeschriebene A4-Seiten, gelbliches Linienpapier aus einem einfachen Schreibblock. Dorothe las stumm, blätterte um, las still weiter, begann den Inhalt dann zu kommentieren.
»Mein Mike hat ein paar alte Zeitungsausschnitte gesammelt. Sie alle beschreiben jedoch nur die Entführung und spätere Befreiung des Jungen. Doch er hat hier notiert, dass Jimmy Santiago McKinn später eine Victoria Villanueva geheiratet habe. Das Ehepaar ließ sich in Silver City nieder, wo Jimmy Santiago als Schmied bei einer Transportfirma arbeitete. Jahre später zog die Familie nach Phoenix in Arizona um, wo Jimmy McKinn wohl auch verstarb. Der Ehe entsprossen sechs Kinder, drei Töchter und drei Söhne.«
»Was heißt entsprossen?«, wollte Alina sogleich von Dorothe wissen.
Die blickte die Kleine einen Moment lang ein wenig perplex, aber auch wohlwollend an, bevor sie antwortete.
»Damit meine ich geboren.«
Alina nickte verständig.
»Kennen Sie denn die Namen der sechs Kinder?«, fragte Jules nach.
Dorothe überflog mit den Augen die unteren Zeilen auf dem Blatt.
»Nein, leider nicht. Die waren Mike wohl nicht so wichtig.«
Jules und Alabima zeigten ein enttäuschtes Gesicht, während Alina offensichtlich auf zusätzliche Informationen wartete, ihre Hände hinter ihrem Rücken verschränkt hielt und erwartungsvoll zur älteren Frau hochsah.
»Die alte McKinn Farm gibt es immer noch. Sie liegt in der Nähe von Deming und gehört heute Wanda und Wayne Spitzer. Ich weiß das, weil die beiden vor ein paar Monaten auch mal hier waren und sich vorstellten. Möchten Sie vielleicht ihre Adresse haben?«
Jules zuckte unschlüssig mit den Schultern.
»Mit den McKinn verwandt sind die neuen Besitzer wohl nicht?«
»Nein, das nicht. Doch Sie könnten sich die Umgebung der Farm ansehen, wo Jimmy Santiago aufwuchs. Das wäre doch bestimmt interessant für Ihre Tochter?«
Sie lächelte die Lederers dabei an und Jules notierte sich unter dem strengen Blick von Alina die Adresse der Spitzers.
»Die McKinns? Stammen die eigentlich aus Schottland?«, fragte Jules noch.
»Sie meinen wegen des Namens? Nein, hier steht, dass der Vater von Jimmy Santiago, John McKinn, aus Irland eingewandert ist. Mein Mike hat weiter notiert, dass er 1994 und noch einmal 1995 die Behörden in Dublin angeschrieben habe und um Auskunft über die Wurzeln der Familie McKinn gebeten habe, jedoch leider nie eine Antwort von dort erhielt.«
Netterweise kopierte Dorothe die handgeschriebenen Aufzeichnungen ihres Ehemannes für sie. Die Lederers bedankten sich herzlich bei den beiden älteren Damen, verließen das Museum und gingen zurück zu ihrem Wagen.
»Und was nun?«, fragte Alabima ihren Ehemann und ihre Stimme drückte Missmut aus.
»Nichts«, gab dieser etwas schuldbewusst zurück.
»Du willst doch nicht etwa zu dieser Farm in Deming rausfahren?«
Jules zuckte mit den Schultern.
»Nein, eigentlich nicht.«
Seine Antwort entsprach nicht seinem Herzen, das hörte man aus seiner Stimme heraus. Alina hingegen meldete ihren Anspruch sogleich an: »Aber warum denn nicht, Maman? Auf der Farm erfahren wir vielleicht, wie es Jimmy Santiago weiter ergangen ist?«
»Aber die heutigen Besitzer kennen Jimmy doch gar nicht, mein Schatz«, versuchte sie ihre kleine Tochter zu trösten, »sie können dir deshalb auch nichts über ihn erzählen. Genügt es denn nicht, dass du weißt, dass er glücklich verheiratet war und Kinder besaß?«
Die Kleine schüttelte sofort ihren Kopf.
»Nein, das genügt nicht. Ich will wissen, ob er später noch einmal mit Apachen zu tun hatte und ob er vielleicht doch insgeheim unglücklich war, weil er nicht mehr mit ihnen zusammenleben durfte.«
Die Tochter blickte ihre Eltern nun mit einem derart ernsten und traurigen Ausdruck in ihrem kleinen Gesicht an, dass beide gleichzeitig losprusteten.
»Du solltest dich selbst sehen, Alina. Oder soll ich sagen, Frau Professor Alina, weil du so furchtbar ernst Dreinblicken kannst?«, zog Alabima sie auf.
»Wenn schon, dann Frau Professor Lederer, bitte schön«, gab ihre Tochter keck zurück und fügte altklug hinzu, »Professorinnen werden immer mit dem Familiennamen angeredet, Maman, nie mit dem Vornamen. Das solltest du wissen.«
Jules war sich unschlüssig. Ihre Suche nach dem Schicksal von Jimmy Santiago hatte sie zwar hierhergeführt, doch nicht viel Neues erbracht. Aber warum sollten sie auch weiter an dieser alten Geschichte herum forschen? Das brachte doch nichts ein, verdarb ihnen höchsten die paar Urlaubstage.
Bloß ein einziger Punkt beschäftigte den früheren Problemlöser und Geheimnisjäger Jules. Warum nur hatte der Ehemann von Dorothe nie eine Antwort aus Irland erhalten? Die dortigen Behörden mussten doch über ausgewanderte Familien Bescheid wissen? Weshalb ließen sie seine beiden Anfragen unbeachtet? Doch gegenüber Alabima oder Alina erwähnte er diese für ihn noch offene Frage nicht. Er nahm sich jedoch vor, am Abend im Motel das Internet nach einem John McKinn aus Irland zu durchforsten.
*
Sie gingen wieder einmal Tanzen, Ginnie und Michael, wie meistens im Dragon-i. Zuvor waren sie in die Chesa Essen gegangen. Denn Ginnie fühlte sich in diesem im Chalet-Stil erbauten Restaurant ganz besonders wohl. Nicht etwa wegen der warmen Holztäfelung oder den freundlichen Kellnern oder gar dem exotischen Essen aus der Schweiz, sondern einzig wegen den illustren Gästen dort. Denn wer im Peninsula abstieg und in seinen Restaurants speisen konnte, der besaß mehr Geld als er in seinem restlichen Leben ausgeben konnte.
Gegen halb zwölf trafen sie im Tanzpalast ein. Michael hatte sich für seinen traditionellen Smoking entschieden, seine Freundin trug ein enganliegendes Abendkleid aus Seide, das wie Perlmutt schimmerte. Es würde wohl erneut eine spektakulär teure Nacht für Michael werden. Doch im Moment fühlte er sich flüssig genug dafür und er wusste, seine Ginnie brauchte ab und zu den Glamour der Stadt wie die Luft zum Atmen.
Die beiden Türsteher hatten seiner Freundin allerdings nicht nur freundlich zugelächelt, sondern sie anzüglich angestarrt. Eifersüchtiger Zorn schoss in Michael hoch. Doch Ginnie schritt unnahbar und stolz wie eine Filmdiva an den beiden Idioten vorbei, würdigte sie mit keinem Blick. Bereits an der Kasse war seine Eifersucht darum wieder verflogen. Diese bulligen Schlägertypen schauten eh jede hübsche Frau schräg an, als wäre sie Beute und nicht etwa Gast.
Drinnen war es ungeheuer laut, denn heute Abend hämmerte ein wahrer Meister die Beats und Rhythmen auf seine Gäste herab, ließ die Tanzfläche mit den zuckenden Leibern wie die Oberfläche eines Hexenkessels brodeln. Sie fanden eine freie Sitznische, allerdings erst in der vierten Tischreihe und damit weit oberhalb des Tanzgeschehens und vor allem außerhalb all der neugierigen Blicke der Kiebitze und der herumstolzierenden Dreiviertel-Prominenz. Gin Davis spitzte ihre süßen Lippen zu einer Schnute, denn dieser Sitzplatz behagte ihr immer weniger, je länger sie sich umblickte. Sie kannte keinen der Gäste in ihrer Nähe und es kamen kaum neugierige Leute an ihrem Tisch vorbei. Selbst die Bedienung ließ sie länger als erträglich warten. Entsprechend spitz bestellte sie bei der hübschen, kleinen Chinesin ihren Daikiwi classic. Michael hingegen entschied sich für eine Frozen Margarita, denn er mochte den Geschmack von Tequila und Lime Juice sehr. Die Getränke kamen überraschend schnell, wurden auch gleich kassiert. Michaels schaute der fünfhundert Hongkong-Dollar-Note etwas wehmütig nach, wie sie in der dicken Servier-Brieftasche der Bedienung verschwand. Zweihundert pro Drink plus Tip. Und es würden noch manche Gläser in dieser Nacht folgen müssen.
Ginnie wollte tanzen und so nippte Michael nur kurz am Strohhalm seiner Frozen Margarita, nahm galant ihre Hand auf und führte sie stolz wie eine Königin die Treppe hinunter und in den Hexenkessel hinein. Dort wiegten sich die schwitzenden Leiber immer noch dicht an dicht. Doch seine Freundin drängte forsch hinein in den Pulk, hatte sich ihm dabei zugewandt und benutzte ihren Rücken und ihr Hinterteil als Wellenbrecher. Bald standen sie Face to Face aneinandergepresst, fühlten die Körper anderer Tänzer auf ihrem, wurden von Armen und Händen berührt, manchmal sogar gestreichelt, schmeckten das Salz in der Luft und den Alkohol, spürten die feucht-schwüle Atmosphäre und fielen wie all die anderen in den Rausch der Sinne. Die Bass-Töne aus den Lautsprechern ließen die Bauchdecke vibrieren, stießen den harten Sound hinein in ihre Eingeweide, brachten sie zum Kochen. Irgendein Spinner ganz in ihrer Nähe wirbelte auf einmal wild herum, reckte dabei immer wieder seine Arme in die Höhe, stieß dazu spitze Schreie aus, als tanzte er auf glühenden Kohlen. Als er seine Arme wieder in die Menge senkte, passierte es. Mit seinem Ellbogen traf er mit viel Schwung Mitten in das Gesicht einer jungen Frau, stieß ihr den Kopf fast von den Schultern. Einen Moment lang taumelte die Angeschlagene, fiel dann bewusstlos oder im Schock in sich zusammen. Die Tänzer um sie herum versuchten, sie nicht zu treten und einige der Männer bildeten rasch einen Schutzwall um die Frau herum. Zwei von ihnen knieten sich neben sie nieder, einer hielt ihre Hand, der andere wollte sie an der Schulter aufrichten oder aufziehen.
Auch Ginnie hatte nun die Veränderung in der bisherigen Konsistenz der recht homogen wirbelnden Masse erkannt und schaute interessiert hinüber. Vier Security Leute drängten heran, stießen die Gäste recht grob aus ihrem Weg, wiesen die hilfsbereiten Männer weg. Zwei hoben die junge Frau fast spielerisch hoch, stellte sie auf ihre Beine und führten sie weg. Blut tropfte ihr aus der Nase und ruinierte das silbern glitzernde, enganliegende, knielange Abendkleid, färbte es im Brustbereich hässlich rot. Die beiden anderen Angestellten hatten sich dem wilden Tänzer zugewandt. Der stand immer noch betroffen da, unfähig seinem Opfer zu helfen, aber auch zu unerfahren, um sich aus dem Staub zu machen. Sie packten ihn links und rechts, riefen ihm irgendeinen Befehl ins Ohr. Er versuchte ihren Fäusten zu entkommen und so drückten sie seine Arme brutal auf seinen Rücken, führten ihn durch die glotzende Menge wie einen Straftäter ab.
Michael schaute seine Ginnie an. Doch die hatte sich längst wieder vom Schauspiel abgewandt, starrte mit fiebrigen, leicht verdrehten Augen zum flimmernden, mit Licht überfluteten Himmelszelt hoch, wand sich wie eine sich aus der eigenen Haut schälenden Schlange. Das kannte Michael leider schon. Gin hatte sich bestimmt wieder irgendein Dreckzeug eingeworfen, Speed oder Ecstasy. Er hasste sämtliche Drogen, ob sie die Leute anfeuerten oder sie vergessen machten, ihnen eine falsche Sicherheit eintrichterten oder ihnen für kurze Zeit das Gefühl überragender Größe vorgaukelten. Doch für seine Ginnie waren die Pillen bloß ein wenig Spaß und er die große Bremse. Sie habe die Sache voll im Griff, wie sie ihm erklärte, nie mehr als drei oder vier pro Nacht, hatte sie ihm gepredigt, nur um ein wenig lockerer zu werden. Und lustig. Seine eigenen Beobachtungen zählten weit mehr Pillen, was sie jedoch stets wie ein kleines Kind abstritt.
»Du kannst doch die kleinen Muntermacher nicht in denselben Topf wie echte Drogen werfen?«, beklagte sie sich bei ihm, »denn sie machen nicht abhängig, sondern nur fröhlich.«
Mit ihr darüber zu streiten hatte keinen Sinn, denn dann verflog die Wirkung der Pillen noch rascher, was sie wütend machte. Also sagte Michaels auch in dieser Nacht nichts zu ihr, tanzte weiter, gab sich lustig, als wäre es ihm egal oder hätte er nichts bemerkt.
Der Einpeitscher auf der Kanzel über ihnen rief irgendetwas Anfeuerndes ins Mikrophon, das wohl er selbst in all diesem Lärm nicht verstehen konnte. Trotzdem antwortete ihm die Menge begeistert, grölte und kreischte irgendetwas, heulte und lachte. Die übliche hirnlose Erwiderung eines entfesselten und enthemmten Mobs.
»Das ist nicht meine Welt«, sagte Michael laut vor sicher her, ohne dass es jemand in diesem Tumult hätte verstehen können, »und doch bin ich Teil von ihr.«
Dank meiner Ginnie, fügte er in Gedanken und etwas bissig hinzu, bevor er sich wieder seiner Freundin widmete. Die hielt den Blick wieder auf den Boden gerichtet, verdrehte nur noch ihren Oberkörper wie zuvor. Die Droge schien bereits nachzulassen.
»Genug getanzt?«, schrie er ihr fragend ins rechte Ohr. Sie nickte und so ging er diesmal voraus, bahnte ihnen den Weg aus der Masse der zuckenden Leiber.
Wie ein betrunkener Haufen Ameisen, dachte Michaels angewidert, oder wie ein riesiges Tier, das im Sterben liegt.
Als sie wieder oben bei ihrer Nische angekommen waren, saßen andere Leute dort. Ihre noch fast vollen Gläser hatte man längst abgeräumt.
»Setzen wir uns an die Bar?«, fragte ihn seine Ginnie und wirkte dabei weder ärgerlich über den Verlust des Sitzplatzes noch über die teuer bezahlten Drinks. Michaels nickte etwas wehmütig und sie hängte sich wieder in seine Armbeuge.
Mit einer solch aufregenden, von allen Männern beachteten und beobachteten Frau, fühlte man sich als ihr Begleiter irgendwie erhaben, dachte Michael, als sie zur Bar schritten. In seinem Nacken spürte er einmal mehr den brennenden Neid all der anderen Kerle, ähnlich einem leichten Regenschauer in schwüler Nacht. Willkommen, wenn auch nicht ehrlich erfrischend.
Er registrierte jedoch auch den starren Blick seiner Ginnie, als sie an einer aufgedonnerten Blondine vorbeikamen, die sich wichtigtuerisch in Pose geworfen hatte und deren Brillantcollier wie die Schätze aus Tausend und einer Nacht funkelten und keinen Zweifel über ihre Echtheit ließen.
Ja, der Erfolg war niemals gerecht verteilt.
*
Seine Suche im Internet über die Ehefrau von Jimmy Santiago ergab nichts. Victoria Villanueva war bestimmt im Norden von Mexiko, in Texas oder in New Mexiko geboren worden. Doch aus dieser Zeit fand er keine Aufzeichnungen, die im Internet zugänglich standen. Als nächstes forschte Jules nach John McKinn, dem Vater von Jimmy. Auf Anhieb fand er in den Einwanderungslisten von Ellis Island zwei Einträge unter diesem Namen. Ein Sechsjähriger John McKinn war am 28. Juni 1848 auf der Memnon angereist. Ein anderer John McKinn, weniger als ein Jahr alt, kam am 17. Februar 1851 auf der Columbus an. Beide McKinn stammten aus Irland und der Abfahrtshafen beider Schiffe war Liverpool gewesen.
Jules suchte nach weiteren Informationen zu den damaligen Ankömmlingen in der Neuen Welt, gab zum jeweiligen Jahr nur noch den Familiennamen ein. Mit der Memnon reisten insgesamt sieben McKinn ein. Als Älteste war eine Jane McKinn von fünfzig Jahren aufgeführt. Der Zweitälteste der 1848er Gruppe war ein James von zwanzig Jahren, die anderen fünf waren allesamt noch Kinder gewesen. Konnte diese Martha McKinn die Mutter der anderen sechs gewesen sein? Auch diejenige der zweijährigen Isabella McKinn? Oder war sie eher eine ältere Tante? Aus dem Internet war nicht mehr heraus zu bekommen, außer, dass sie im Zwischendeck der Memnon gereist waren. Sie mussten entweder arme Auswanderer gewesen sein oder ihr Geld für ihre neue Heimat in Amerika gespart haben.
Mit der Columbus reisten 1851 drei McKinn ein. Die Älteste war eine Rose McKinn, fünfunddreißig Jahre alt. Sie war wohl mit ihrer siebenjährigen Tochter Biddy und dem Neugeborenen John unterwegs gewesen. Jules schluckte hart, als er weiterlas und so erfuhr, dass die Mutter noch an Bord verstorben sein musste. Bei den Kindern fand er keine Angaben über ihren späteren Aufenthaltsort oder über irgendwelche Verwandten in den USA. Was für eine Ankunft im sogenannten Gelobten Land? Als minderjährige Waisen und ohne einen bekannten Angehörigen?
Zumindest war nun sichergestellt, dass die McKinn wirklich irischer Abstammung waren. Viele Iren führten ihren Familiennamen mit einem O’ an, wie O’Neill. Und es gab auch viele Mac, wie Mac Intire. Das O’ stand dabei für Enkel, ein Mac oder Mc für Sohn, wie Jules wusste.
Da Jimmy Santiago um 1874 herum geboren war, kam als sein Vater eher der sechsjährige John McKinn in Frage, der 1848 auf der Memnon eingereist war. Allerdings deckte sich diese Annahme wiederum nicht mit den Aufzeichnungen von Mike Allistor. Denn der hatte einen Zeitungsbericht aus dem Jahre 1885 gefunden, in dem das Alter des Vaters des entführten Jungen mit 49 Jahren angegeben war. John McKinn musste also 1836 geboren worden sein und nicht 1842. Allerdings bezweifelte Jules dieses ältere Geburtsjahr. Denn der getötete Bruder von Jimmy, Martin McKinn, war 1885 erst siebzehnjährig. Ein 1836 geborener John McKinn wäre bei der Geburt seines ersten Kindes also bereits zweiunddreißig Jahre alt gewesen, was in jener Zeit, als man früh heiratete, sehr spät war. Konnte es sein, dass die amerikanischen Einwanderungsbehörden ein falsches Alter bei John McKinn notiert hatten? Oder hatte der Journalist damals vielleicht eine unleserliche 43 notiert und sie später in der Redaktion beim Schreiben seines Zeitungsberichts als 49 interpretiert?
Jules wechselte zur Irish Emigration Database, fand dort jedoch keine 1848 ausgewanderten McKinn aufgeführt. Enttäuscht suchte er nach weiteren Online Datenbanken über die Bevölkerung Irlands, gab jedoch nach einer Weile auf. Denn keine der zugänglichen Registrierungen reichte bei den Geburten weiter zurück als 1864. Selbst www.familysearch.org kannte keinen John McKinn aus Irland im fraglichen Zeitpunkt.
Jules suchte nun nach mehr Informationen über das Schiff, die Memnon, mit der damals der Vater von Jimmy Santiago in Amerika ankam. Doch er fand nur Daten zu einem Klipper mit diesem Namen, der jedoch erst am 6. November 1848 vom Stapel lief, also vier Monat nach der Ankunft der McKinn in der neuen Welt.
Über Jimmy Santiago konnte Jules dagegen weitere Informationen im Netz finden. Sie deckten sich mit den Aufzeichnungen von Mike Allistor. Heirat mit Victoria Villanueva, Schmied in Silver, Umzug nach Phoenix, wo er starb. Über den Verbleib seiner angeblich sechs Kinder fand Jules allerdings nichts heraus. Doch die Stadt Silver City lag bloß fünfzig Meilen nördlich der Interstate 10 und sie konnten die Ortschaft über einen kleinen Umweg auf ihrem Weg nach Westen erreichen und sich dort vielleicht nach den McKinns und ihrer weiteren Geschichte erkundigen?
Jules suchte sich noch die Online-Services des irischen Staates heraus und fand dort den Hinweis, dass die Civil Registration Offices zum Health Service Executive Department gehörten. Von deren Webseite aus gelangte er auf die Liste aller Registrierungsämter des Landes, fein säuberlich aufgeführt, nach Regionen und unter Angabe der jeweiligen Öffnungszeiten und der Telefonnummern.
Jules kopierte sich die Liste heraus und sah auf seine Armbanduhr. In drei Stunden konnte er hoffen, dass die Dienststellen in Irland telefonisch wieder erreichbar waren. Bestimmt konnten sie ihm eine E-Mail-Adresse nennen, an die er seine Anfrage schriftlich einreichen konnte.
Endlich spürte er einen Blick in seinem Nacken, wandte sich vom Laptop ab und drehte seinen Kopf herum. Alabima stand hinter ihm und schaute mitleidig drein.
»Was willst du dir eigentlich beweisen?«
Jules antwortet nicht, fragte sich selbst nach seinen Gründen.
»Deine Jagd nach Jimmy Santiago führt doch zu nichts, oder?«
Er zuckte mit den Schultern.
»Aber … Alina …?«
»Ach, für Alina war bloß der von Indianern entführte Junge interessant, der nicht mehr in die Welt der Weißen zurückkehren wollte. Du jedoch scheinst einem Phantom nachzujagen.«
»Ich wollte doch bloß wissen, warum Will Allistor nie Antwort aus Irland erhalten hatte.«
»Und? Hast du es herausgefunden?«
Die Kopfbewegung von Jules sagte Ja und Nein.
»Ich hab im Internet den Zugriff auf die Einwanderungslisten von Ellis Island gefunden. Dort sind zwei John McKinn erwähnt, wobei nur einer von ihnen vom Alter her als Vater von Jimmy hinkommt. Er stammt wie bereits von Dorothe Allistor erwähnt tatsächlich aus Irland und ist 1848 in die USA ausgewandert. Ich will mich mit den Behörden in Dublin in Verbindung setzen, um mehr über die Familie McKinn herauszufinden.«
»Und wozu? Glaubst du, Alina interessiert sich für den Stammbaum von Jimmy Santiago?«
Wieder das Achselzucken.
»Du kannst es wohl nicht sein lassen, mein Lieber?«
»Wir könnten nach unserem geplanten Besuch von El Paso nicht direkt nach Tucson weiterfahren, sondern erst noch einen kurzen Abstecher nach Silver City machen. Schau hier die Karte. Die Stadt liegt bloß eine Stunde von der Interstate 10 weg. Die Behörden dort wissen bestimmt mehr über das Leben von Jimmy McKinn und seinen Kindern, wenn er dort ein paar Jahre lang gelebt und gearbeitet hat.«
Alabima verdrehte ergeben die Augen.
»Wenn mal ein Bluthund auf eine Spur gesetzt ist…«, gab sie theatralisch seufzend ihre Meinung kund.
»Du meinst eine Fährte, Liebling, nicht eine Spur, und einen Schweißhund, nicht Bluthund. Eine Spur besteht aus Fußabdrücken oder anderen, visuellen Hinweisen. Eine Fährte ist dagegen verbunden mit einem Geruch. Bluthunde sind jedoch eine bestimmte Hunderasse, wogegen man mit Schweißhund eine spezielle Ausbildung bezeichnet, in diesem Fall die Fähigkeit, einem verletzten Tier anhand seiner Geruchsspur zu folgen.«
»Ja, von mir aus, mein kleiner Erklärbär, aber lenke nicht ab.«
»Lass mir doch meinen Spaß.«
Sie legte ihren Kopf schräg und betrachtete ihn prüfend und zweifelnd.
»Ist doch völlig harmlos«, ergänzte er seine Bitte.
Sein bekümmerter, gleichzeitig auch treuherziger Blick brachte sie zum Lachen.
»Ist ja gut, Sherlock, mach was du willst. Aber nicht mehr als noch ein paar Stunden während unseres Urlaubs, versprochen?«
Jules nickte zustimmend und meinte es auch beinahe so.
Sie gingen zu Bett, doch der Schweizer konnte nicht einschlafen, stand gegen sechs Uhr morgens wieder auf, rief eine der Behörden in Irland an und erhielt eine E-Mail-Adresse, an die er seine Fragen zu John McKinn senden konnte.