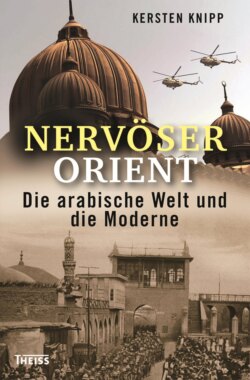Читать книгу Nervöser Orient - Kersten Knipp - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung
ОглавлениеKeine Rolle spielte ich in meinem Leben
Nur als es mich seine Psalmen lehrte sagte ich:
Ich will noch mehr davon
Und um das Leben zu verändern entzündete ich in mir
Des Lebens Licht
Mahmoud Darwish, Der Würfelspieler1
Lang war der Weg nicht, gerade einmal sechzig Kilometer. Eine Strecke aber, die zwei verschiedene Welten verband, aus der lärmenden Metropole hinaus in die Stille des Landes, von der Hektik der Vielen zur Ruhe der Wenigen führte. Felder, Wälder und der Fluss: eine idyllische, fast schon bukolische Landschaft, ganz anders als die dröhnende Hauptstadt. Ein Refugium für die Zivilisationsflüchtlinge des frühen 20. Jahrhunderts, all jene, die genug hatten vom Drängen der Moderne, ihrem Lärm, ihrer Unruhe und Nervosität. Ideen, immer neue Ideen, zirkulierten durch die große Stadt, ausformuliert in Büchern, Zeitungen, dem aufkommenden Radio. Und kaum ein Gedanke war darunter, über den nicht gestritten wurde, oft laut, schrill und polemisch. Alles stand zur Debatte. Aber über kaum etwas bestand Einvernehmen.
Hier, in der Metropole konnte er darum nicht weiterkommen, davon war der junge Mann überzeugt: „Ich bin froh, die hektische Atmosphäre von Paris hinter mir zu lassen, wo mich das ständige Durcheinander der künstlerischen Theorien noch in den Wahnsinn treibt“, notierte er im Sommer 1918. Der Erste Weltkrieg war gerade vorbei, der Kontinent leckte sich die Wunden. Die militärische Mobilmachung war vorüber, aber die politische, gesellschaftliche und kulturelle ging weiter, entschiedener als je zuvor. Denn alles, ausnahmslos alles stand nach der Katastrophe zur Debatte. Die sensibleren Beobachter waren sich klar: Fortan würde man anders leben müssen als bisher, in einem weltanschaulichen Provisorium nämlich, in dem die Dinge immer nur zeitweilig ihren Ort hätten. „Den kühnsten und verwegensten Werken der Gegenwart“ will der junge Künstler sich aussetzen, ist aber unsicher, inwiefern die stilistischen Formen der neuen Zeit auch wirklich zu ihm passen. „Ich kann mich zwar nicht dazu durchringen, mich ihnen anzuschließen. Ebenso wenig kann ich sie aber ignorieren und zur traditionellen Kunst zurückkehren.“2 So hofft Mohamed Naghi, 1888 in Alexandria geboren, auf den Rat von Claude Monet. Der große Schrittmacher des französischen Impressionismus hatte sich seit den 1880er-Jahren in das kleine Örtchen Giverny, nordwestlich von Paris, zurückgezogen. Dort malte er vor allem Seerosen, in einem eigens dafür arrangierten Teich. Davor hatte Monet sich immer auch für die technischen Veränderungen der angehenden Moderne interessiert. 1874 malte er etwa die auf einer massiven Stein- und Beton-Konstruktion ruhende Seinebrücke bei Argenteuil, 1877 den Bahnhof von Saint-Lazare, den zwei Lokomotiven mit ihren qualmenden Schornsteinen mächtig unter Dampf setzten. Welchen Rat würde Monet, der künstlerische Chronist der Moderne, ihm, dem jungen ägyptischen Maler, geben können?
Vielleicht spiegelt niemand den dramatischen Anschluss der arabischen Welt an die – damals noch hauptsächlich westlich inspirierte – Moderne deutlicher als jene Maler und Bildhauer des Nahens Ostens, die an der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert in die Hauptstädte Europas reisten, um die dort vorangetriebenen künstlerischen Experimente auch für ihre Herkunftsländer fruchtbar zu machen. Dramatisch waren diese Versuche, weil die arabischen Künstler sich einer Schwierigkeit gegenübersahen, die ihren europäischen Kollegen völlig unbekannt war. Denn die waren mit jahrhundertealten künstlerischen Traditionen aufgewachsen, waren zutiefst mit dem Erbe vorhergehender Generationen vertraut. Ganz anders die arabischen Künstler: Sie sahen sich in Paris, Rom, London oder Berlin den avanciertesten westlichen Kunstformen ihrer Zeit gegenüber, die schockierend neu für sie waren. Zugleich wussten sie – wie alle Künstler jener Epoche – dass sie hinter diesen Stand der Entwicklung nicht mehr zurückkonnten. Die arabischen Maler kamen aus einer Region, die aufgrund des islamischen Bilderverbots so gut wie keine darstellerischen Traditionen kannte. Am nördlichen Ufer des Mittelmeers stießen sie auf Stile und Formen, die selbst für das an künstlerische Umwälzungen halbwegs gewohnte europäische Publikum revolutionär waren. Mit anderen Worten: Jene Entwicklung, die sich in Europa über Jahrhunderte entwickelt und schließlich zur modernen Kunst – etwa Impressionismus, Fauvismus, Kubismus – geführt hatte, mussten sie in wenigen Jahren durchlaufen.
Die zwischen 1870 und 1890 geborenen arabischen Maler, Zeichner und Bildhauer machten einen Sprung, wie ihn kaum eine andere Künstlergeneration jemals getan hatte. In wenigen Jahren ließen sie ein Zeitalter strenger Bilderfeindlichkeit hinter sich und stießen in eine Welt, in der künstlerisch alles möglich war. Sie fanden sich wieder in einer ungeheuren Spannung, nämlich der zwischen raffihniertesten stilistischen und formalen Experimenten und dem Erbe einer Religion, die alle darstellende Kunst in die Nähe der Sünde gerückt hatte. Und als wäre das nicht schon genug, standen die arabischen Maler und Bildhauer noch vor einer anderen Frage: Wie sollen sie die europäischen Traditionen mit den spezifischen Gegebenheiten der osmanischen Provinzen verbinden? Wie sollten sie europäische Stilformen nutzen und zugleich eine dem heimischen Publikum verständliche und es überzeugende künstlerische Sprache finden? Dessen Vorstellungen über Rolle und Aufgaben der bildenden Kunst waren so ganz anders als jene, die in Europa geläufig waren. Umso mehr kam es darauf an, die westlichen und östlichen Erfahrungen zu verbinden und daraus etwas ganz Neues zu schaffen.
Das war eine gewaltige Aufgabe, die nicht nur Naghi beschäftigte. 1906 war er nach Frankreich aufgebrochen und hatte ein Jurastudium in Lyon begonnen. Doch die Rechtswissenschaften, bemerkte der junge Mann bald, waren nichts für ihn. So hängte er das Fach an den Nagel, um sich fortan seiner größten Leidenschaft zu widmen: der Malerei. 1910 schrieb er sich an der Accademia di Belle Arti di Firenze, der Akademie der schönen Künste in Florenz, ein. Später ging er nach Paris. „Der Gedanke, mit dem Erbe meines Heimatlandes zu brechen, erschreckt mich“, notiert er dort. „Ich fürchte, mich in einen Strom künstlerischer Ausdrucksmittel zu begeben, die mir bis dahin nicht vertraut waren, die mich aufgrund ihrer Kühnheit aber faszinieren. Ich fürchte, allzu sehr unter ihren Einfluss zu geraten und mich immer weiter von Ägypten und seiner Kunst zu entfernen – einer Kunst, von der ich im Laufe der Zeit immer stärker spüre, welch mächtige Bande sie an mich binden.“3
Dies sind die Sorgen, die Naghi von Paris auf den Weg nach Giverny treiben, um Rat bei dem bald achtzigjährigen Claude Monet zu holen. Einige Monate verbringt er in der Nähe des Meisters, aber ganz mag er sich ihm nicht anvertrauen: Die Idee, das ägyptische Erbe mit den modernen Kunstformen Europas zu verbinden, behält er für sich. Das Ergebnis aber beeindruckt Monet ganz offenbar: „Als ich ihm meine Bilder zeigte, kam er auf deren ständig wechselnden Farben zu sprechen, die ihn an den Schimmer von Perlen erinnerten. Er hat mich ermutigt, in dieser Weise fortzufahren. Er schätzte einige meiner Arbeiten, forderte aber weitere künstlerische Eigenständigkeit und einen kühneren Umgang mit den Farben.“4
Tatsächlich wurde Naghi ein Meister der Farben, und ein Klassiker der ägyptischen Malerei. In warmen Tönen malte er nach seiner Rückkehr die Heimat, ihre Landschaften und ihre Städte – unverkennbar impressionistisch inspiriert, sanft in der Formgebung, zugleich aber mit scharfem Blick für die Eigenheiten des Landes. Mit seinen Werken steht Naghi ganz am Anfang der darstellenden Kunst seines Landes wie des Nahen Ostens überhaupt. Von Anbeginn orientierte sich diese Kunst am Westen – musste sich an ihm orientieren. Mangels eigener Traditionen griffen die arabischen Künstler die europäischen Modelle begierig auf, um im Umgang mit ihnen immer souveräner zu werden und sie schließlich auf ganz eigene, höchst originelle Weisen zu verwenden. Man schaue sich – um nur ein paar Namen zu nennen – die Arbeiten einer Inji Eflatoun, eines Chant Avedissian, eines Suad al-Attar oder des libanesischen Künstlerpaares Joana Hadjithomas und Khalil Joreige an: Man sieht, wie meisterhaft arabische Künstler sich die europäischen (später auch amerikanischen) Vorlagen aneigneten und auf dieser Grundlage ganz neue Wege gingen.