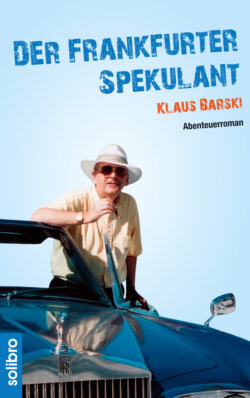Читать книгу Der Frankfurter Spekulant - Klaus Barski - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
FRANKFURT
ОглавлениеMitten in der Nacht kamen wir 1967 auf einem Möbelwagen in Frankfurt am Main an. Ich, Adolf Bartels, 25 Jahre alt, Pleite-Kaufmann, und meine Frau Jean, ferner unsere Sammlung antiker Bauernmöbel aus besseren Zeiten und ein Aktenkoffer voll offener Rechnungen. Das war eine beschissene Situation, denn unsere Schulden betrugen zu diesem Zeitpunkt mehr als 30.000 Mark. Aber es war nicht das erste Mal, daß ich ganz unten war. Es hatte in meinem Leben zahlreiche Höhen und Tiefen gegeben.
Ein paar Tage vorher hatte ich mittels Sozialhilfe unsere neue Bleibe, eine heruntergekommene Altbauwohnung in Frankfurt-Bornheim, gemietet. Unser Wagen, ein klappriges, feuerrotes Sunbeam-Cabrio, war dort schon vor längerem abgestellt worden, weil wir Angst vor einer Pfändung hatten und keiner diese neue Adresse kannte. Um ein Uhr nachts waren wir dann, völlig durchgeschwitzt, eingezogen. Wir hatten es geschafft! Der Versuch, uns selbständig zu machen, war zwar gescheitert, aber der Ort mit unserer Pleite gegangenen Werbeagentur lag hinter uns. Wir waren wieder in Frankfurt, der Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten für Deutschlands Habenichtse.
Die Wohnung war deprimierend. Sie befand sich im dritten Hinterhof, im Erdgeschoß. Direkt vor dem Wohnzimmerfenster prangte eine hohe Mauer aus Ziegelsteinen. Es war so dunkel in der Wohnung, daß wir sogar am Tag das Licht einschalten mußten. Aufgrund der schlechten Wohnverhältnisse wurde das Haus sonst nur von Türken bewohnt. Aber bei den überall üblichen hohen Kautionen blieb uns keine andere Wahl. Trotzdem waren wir gut gelaunt; wir hatten den jugendlichen Glauben an eine bessere Zukunft – von jetzt an konnte es nur noch aufwärts gehen.
Als wir am nächsten Morgen aufstanden und unsere besten Klamotten anzogen, waren wir in Hochstimmung. Nach dem ruhigen Leben auf dem Dorf freuten wir uns auf die Großstadt. Kaufhausbummel, Cafés, Kinos, Kneipen, Antiquitätengeschäfte und Museen – das alles hatten wir vermißt und jetzt endlich wiedergewonnen.
„Wie bezahlen wir die 30.000 Mark Schulden?“ fragte mich Jean, als wir durch Bornheim bummelten.
„Weiß der Henker“, erwiderte ich und dachte einen Moment über unsere triste Lage nach.
„Das schaukeln wir schon. In einer internationalen Geschäftsstadt wie Frankfurt läßt sich immer irgendwie Geld auftreiben.“
Als wir in die Berger Straße einbogen, hörten wir jemanden „He Adi!“ rufen. Vor uns stand Heinz Dreckmann, ein Bekannter aus früheren Tagen. „Heinz! Immer noch in Frankfurt?“ fragte ich lächelnd, als wir uns gegenseitig auf die Schultern klopften.
„Was machen die Geschäfte?“
Er war von Beruf Grafiker, Dekorateur, Schriftenmaler und Anstreicher, je nach Auftragseingang. Ein kleiner, aber drahtiger Körper, überdimensionierte getönte Brille und immer ein weißes Hemd mit Fliege – das war Heinz, der große Schaumschläger. „Ich lade Euch zum Essen ein“, sagte er großspurig.
Gerade das hatten wir nötig.
„Gehen wir ins Bilka. Die haben heute den 99-Pfennig-Erbseneintopf“, ergänzte er.
Wir bummelten zu dritt zum Kaufhaus. Während wir aßen, erzählte jeder dem anderen von seiner beschissenen Lage. Großzügig zahlte Heinz die Zeche, obwohl er, wie wir jetzt wußten, ebenfalls pleite war.
„Habt Ihr heute frei?“ fragte Heinz.
„Ja. Komm, fahren wir in die City und trinken einen Kaffee bei Schwille“, schlug ich vor.
Es war Freitag. Im Café Schwille, dem bekannten Tagestreffpunkt, wartete ich auf das Erscheinen der Abendausgabe der Frankfurter Rundschau, um die Stellenangebote zu studieren und nach meiner Kfz-Verkaufsanzeige zu suchen. Mit dem Geld vom Verkauf unseres Sunbeams hoffte ich unsere Finanzen zu regeln.
Wir unterhielten uns über die alten Zeiten und fühlten uns großartig in der langentbehrten Großstadtatmosphäre.
Dann fuhren wir mit der Straßenbahn zur Wohnung zurück; dort wartete bereits ein Kaufinteressent. In einer Viertelstunde hatten wir den Wagen verkauft.
Am folgenden Montag eröffneten wir ein Konto und zahlten das Geld ein. Dann machten wir uns an die Arbeit und schrieben all unseren Gläubigern den gleichen herzzerreißenden Brief. Jeder bekam einen kleinen Scheck und das Angebot, daß wir den Rest in Monatsraten zahlen würden. Tatsächlich erhielten wir in den folgenden Tagen von allen Gläubigern eine positive Antwort. Wir hatten Zeit gewonnen.
Das Jahr ging langsam zu Ende und seit drei Wochen schon studierte ich die Stellenanzeigen. Mein Arbeitslosengeld reichte nicht aus, und ich mußte endlich handeln. Ich träumte von einer ruhmvollen Karriere als Manager in Handel oder Industrie.
Dann sah ich die Anzeige. Kanadas größter Nähmaschinenhersteller Ontario Sewing Machine Company suchte einen Schulungsleiter. Das war etwas für mich!
Dr. Hoffmann, der Vertriebsdirektor der Firma, war ein gemütlicher, dickbäuchiger Mann. Er empfing mich mit Begeisterung, weil ich ihm am Telefon ein kreatives Verkaufsgespräch hingelegt hatte, nach dem er schon glaubte, nicht mehr ohne mich auskommen zu können.
„Dem neuen Schulungsleiter sind drei Bereiche unterstellt: Verkaufsförderung, Verkäuferschulung und das Schulgeschäft“, fing er an. „Das bedeutet die Erstellung von verkaufsförderndem Material, zum Beispiel Gebrauchsanweisungen, Verkaufstrainingsunterlagen und Verkäuferwettbewerbe.“ Er nahm einen Schluck aus seiner Kaffeetasse, faltete die Hände zusammen und fuhr fort: „Die Schulung der Verkäufer erfolgt durch Schulungsinfos und zwei Verkaufstrainer, die laufend mit neuen Unterlagen ausgerüstet werden müssen. Dazu gehören …“ – dann redete er fast eine Stunde ohne Pause.
Mir schwirrte der Schädel von den vielen Marketingphrasen, aber ich nickte begeistert.
Dann zeigte er mir die Unterlagen, die bisher von der Schulungsabteilung erarbeitet worden waren und sagte: „Auf dem deutschen Markt ist die Singer-Nähmaschine zur Zeit die Nummer eins. Aber das wird sich bald ändern.“
Feierlich schloß er einen Schrank auf und holte eine Nähmaschine heraus.
„Unser Kampfmodell, die neue SuperSew 2000. Vergleichbare Maschinen der Konkurrenz kosten das Doppelte“, sagte er so stolz, als hätte er sie persönlich erfunden. „In zwei Monaten kommt sie auf den Markt.“
Noch einmal mimte ich Begeisterung und wurde eingestellt.
An meinem ersten Arbeitstag betrat ich erwartungsvoll das Marketingbüro. Ja, ich wollte den Erfolg, den totalen Erfolg! Als Grundlage sollte mir die Erfahrung dienen, die ich hier in dieser Weltfirma sammeln würde. Dr. Hoffmann übergab mir mein Büro.
„Ein angenehmes Arbeitszimmer mit Blick auf die Allee“, sagte er.
„Sehr schick“, dachte ich, als ich es betrat. Es war mit einem beigefarbenen Teppichboden, einem Schreibtisch aus Edelholz und einem weichen Sessel mit Armlehnen und Rädern eingerichtet. Der Sessel gefiel mir besonders, weil er für mich der Inbegriff eines Topmanager-Sessels war.
Dann machte Dr. Hoffmann mich mit meiner Sekretärin Fräulein Heine sowie den mir unterstellten Angestellten und den zwei Verkaufstrainern bekannt. Das waren clevere Jungs, die es galt in Schach zu halten.
Ich stürzte mich in die Arbeit, entwickelte Verkaufsförderungsprogramme und einen Jahreseinsatzplan, sichtete Aktionen der vergangenen Jahre und sprach meine neuen Ideen mit den Mitarbeitern durch.
Ehe ich mich versah, war ich ein stinknormaler 8-Stunden-Arbeitstag-Mann geworden. Die Monate vergingen, und ich wurde immer unzufriedener. Ein Grund war das Monatseinkommen. Für eine schöne Zweizimmerwohnung in der City, einen Mittelklassewagen, zweimal Urlaub im Jahr, gepflegte Kleidung und einmal pro Woche gut Essengehen reichte das Einkommen vorne und hinten nicht.
Hinzu kam, daß ich mit 25 Jahren relativ jung für meinen Job war. Die nächst höhere Position eines Marketingdirektors hätte noch einige Jahre harte, sehr harte Arbeit und eine Portion Glück bedeutet.
In unserer Freizeit verkehrten Jean und ich im Viertel rund um die Freßgaß'. Hier gab es damals viele interessante Kneipen, die heutigen Schickerialäden existierten noch nicht. Wir verbrachten unsere Abende im Jazzhaus, im Club Voltaire oder in Weils Bodega, um Frikas mit Knoblauchcreme zu essen. Unseren Kaffee aber tranken wir immer im Schwille.
Hier traf sich alles, was bunt und schillernd war: Geschäftemacher, Hochstapler, Hasardeure, Protzer, Tagträumer – und auch ganz normale Leute, um den guten Kaffee und die köstlichen Kuchen zu genießen.
Die Stammgäste saßen immer vorn am großen Fenster. Viele trugen modische Klamotten und teure Uhren. Sie parkten ihre Angeberwagen mit Vorliebe direkt vor dem Caféhaus.
Diese in meinen Augen erfolgreichen Leute zogen mich an wie ein Magnet. Ich bewunderte sie! Sie schmissen mit dem Geld nur so herum, sprachen von gewinnträchtigen Geschäften, starken Frauen und schnellen Autos. Während ich mich nur eine Viertelstunde aus dem Büro davonstehlen konnte, saßen sie den ganzen Tag gemütlich an den Cafétischen und taten gar nichts.
Als ich einmal wagte, mich zu ihnen zu setzen, schaute mich einer von ihnen, ein VW-Cabrio-Fahrer im taubengrauen Anzug, entrüstet an. Dann deutete er nach hinten und sagte arrogant: „Hier ist alles reserviert. Mach die Mücke!“
Die anderen unterbrachen eine Sekunde lang ihre Unterhaltung. Man musterte mich verächtlich, als ob ich das letzte Arschloch sei, und diskutierte dann weiter.
Verdattert ging ich nach hinten, wo ich das bekannte Gesicht von Heinz Dreckmann erblickte. Er saß allein an einem Tisch und stocherte in einer Sahnetorte herum.
„Da vorne sitzt nur die Prominenz“, scherzte er und zog mich auf den Nebenstuhl.
„Ganz unangenehme Burschen“, sagte ich verärgert.
„Bei denen zählt nur die Kohle“, sagte er. „Da mußte mit 'nem Porsche vorfahren und einen Dreikaräter am kleinen Finger tragen.“
„Was sind das für Leute?“
„Der, der Dich weggeekelt hat, ist Meier, ein mittlerer Versicherungsangestellter.“ Er lächelte mit saurer Miene. „Links neben ihm, der kräftige Typ, ist Wilhelm Weich. War mal Boxer, ist nun Makler. Wenn Du dem die Hand gibst, dann mußte anschließend Deine Finger nachzählen, so 'ne Type ist das. Macht viel Geld und fährt ein neues Mercedes Coupé.“
Beeindruckt nickte ich mit dem Kopf.
„Der mit der Hornbrille ist Telly Goldstein, ein Architekt aus Tel Aviv und von Beruf Sohn. Er fährt 'nen roten Alfa und sein Vater besitzt Häuser im Bahnhofsviertel.“
Eine Kellnerin kam. Ich bestellte mir ein Kännchen Kaffee und hörte weiter interessiert zu.
„Der Blonde am Tisch, mit dem Rücken zu uns, ist der Baron von Bauerberg. Ein netter Typ, ein echter Baron. Sie nennen ihn Money, weil er nie Geld hat und davon träumt, durch Mauschelgeschäfte reich zu werden.“
Während Heinz sprach, hielt ein roter Jaguar vor dem Schwille. Ein schlanker Mann mit langen, gepflegten Haaren und einem blasierten Gesichtszug stieg aus. Er kam ins Café und setzte sich zur Prominenz, die ihn respektvoll begrüßte.
„Das ist Schulz, der Sklavenhändler aus Bremen“, flüsterte Heinz.“ Der macht jede Menge Kies mit Leiharbeitern, die er schwarz beschäftigt. Offiziell hat er eine richtige Zeitarbeitsfirma am Hauptbahnhof.“
Schulz setzte sich ans Ende der Gruppe, direkt unter die freischwebende Elementtreppe.
Heinz grinste wissend.
„Das ist ein Genießer. Da gehen immer die Schnallen zum Damenklo hoch.“
„Bei den Miniröcken heutzutage ist das eh egal“, bemerkte ich.
„Haste auch wieder recht.“
Er deutete nach vorn. Ein gut aussehender Dressmantyp kam herein und begrüßte die Prominenz.
„Mike von Habenberg, der Sprudelautomatenvertreter“, sagte er.
„Der will ganz nach oben und mit den großen Hunden pinkeln gehen. Dafür ist er bereit, seine Seele zu verkaufen. Trotzdem, er ist in Ordnung. Er hat es eigentlich nicht nötig, das Äffchen zu machen.“
„Heinz, Du kennst dich hier aus wie kein anderer!“
Er zuckte mit den Schultern.
„Na, ich gehöre auch zu den vielen hier, die es denen da vorne einmal zeigen möchten. Ich hab' ja auch 'ne Spitzenidee. Ich brauche nur noch den Finanzier, der bei mir einsteigt.“
„Was willst Du machen?“
„Eine Fernsehzeitschrift.“
„Aber es gibt jede Menge, Hörzu, TV-Hören und Sehen …“
„Die erscheinen wöchentlich. Ich mach' was Neues, meine wird alle 14 Tage erscheinen.“
Ich schaute ihn mitleidig an.
„Es kostet Millionen, eine Fernsehzeitschrift in Deutschland auf den Markt zu bringen. Heinz, das ist zu groß für Leute wie uns“, sagte ich und stand auf.
„Muß zurück ins Büro. Junge, ich wünsch' Dir was.“
Ich legte das Geld für unseren Kaffee auf den Tisch und ging. Als ich bei der Prominenz vorbeikam, guckte keiner von ihnen auf. Für sie war ich eine Null.
Kurze Zeit später las ich folgende Anzeige in der Wochenendausgabe der Rundschau:
„Gepflegte 3-Zimmer-Altbau-Eigentumswohnung.
Zum Preis von nur 99.000 Mark!
Bei 10% Eigenkapital finanziert unsere
Hausbank den Rest.“
„Jean, schau Dir diese Anzeige an“, sagte ich. „Schon mit 9.900 Mark könnten wir die Wohnung kaufen. Das ist fast so billig wie mieten.“
„Stell Dir vor, wir wären Eigentümer“, sagte sie schwärmerisch. „Aber haben wir genug Geld?“
„Ooh, ich glaube schon, daß wir es zusammenkriegen könnten“, sagte ich, obwohl ich keine Ahnung hatte, woher.
Am Sonntag fuhren wir aus Spaß zur Besichtigung. Vor dem Haus parkte ein weißes Mercedes-Coupé, das mir bekannt vorkam.
Als wir zur Haustür gingen, rief jemand aus dem offenen Fenster des Autos: „Kommen Sie wegen der Eigentumswohnung?“
„Ja“, antwortete ich und erkannte ihn sofort: Wilhelm Weich, den Makler vom Café Schwille.
Während er seine Verkaufsunterlagen zusammenpackte, betrachtete ich die Fassade. Das Haus hatte 7 Stockwerke mit je zwei 3-Zimmer-Wohnungen. Das waren 14 Wohnungen. Gebaut in der Gründerzeit, hatte es eine rote Sandsteinfassade mit schöner Außenstukkatur.
Weich stieg aus. Er trug einen blauen Blazer und weiße Jeans. Mit seinem Stiernacken und der leicht lädierten Nase sah er noch immer wie ein Boxer aus, lediglich etwas dicklicher und sonnengebräunt. Und er hatte bereits das freche Siegerlächeln der Erfolgreichen.
„Guten Tag. Mein Name ist Weich“, er reichte mir charmant lächelnd seine Hand. „Ich bin der Besitzer des Gebäudes.“
Dann musterte er mich und sagte: „Ich glaube, wir kennen uns schon. Verkehren Sie nicht ab und zu im Schwille?“
Ich nickte.
„Mein Name ist Bartels, das ist meine Frau Jean“, stellte ich sie vor.
Wir schüttelten uns die Hände, und er schloß die Haustür auf.
„Dieses Frankfurter Patrizierhaus habe ich im vergangenen Jahr erworben“, erklärte er, als wir die erste Erdgeschoßwohnung betraten. „Ich habe ein Vermögen reingesteckt für eine neue, edle Fassade. Die Wohnungen haben alle ein neues Bad bekommen. Alles ist neu tapeziert und mit wertvollen Bodenbelägen ausgestattet.“
Er strich mit der Hand über die renovierte Tür.
„Diese Wohnung kostet nur 99.000 Mark. Vergleichen Sie diese solide Handwerksarbeit mit den neuen Eigentumswohnungen in den Außenbezirken, die kosten das Zweifache, und Sie kriegen nur billige Sperrholztüren und Auslegware miesester Qualität.
Und wenn Sie in die City wollen, müssen Sie eine Stunde Autofahrt rechnen. Hier sparen Sie den Zweitwagen ein.“
Er war ein guter Verkäufer. Das imponierte mir. Seine Sprüche von der Patrizierwohnung und der soliden Handwerksarbeit waren nicht schlecht.
Ich schaute mich um. Alles sah propper aus, aber es war nicht allzuviel gemacht worden. Die alten Fenster und Türen waren noch drin. Die Tapeten und Teppichböden waren zwar neu, aber es war, alles in allem, nur eine billige Einfachrenovierung.
„Die Wohnungen vom ersten bis zum sechsten Stock kosten etwas mehr, weil sie große Balkons haben“, sagte Weich, als wir höher stiegen. Ich rechnete aus, daß Weich für seine 14 Wohnungen cirka 1,5 Millionen bekommen würde. Gekauft hatte er das Haus für vielleicht 300.000 Mark und ungefähr die gleiche Summe investiert. Das macht einen Gewinn von 900.000 Mark. Ein phantastisches Geschäft!
Als ich darüber nachdachte, wurde mir klar, was ich in Zukunft tun wollte. Mir wurde ganz warm ums Herz, und ich fühlte mich schwindelig. War ich endlich auf der heißen Spur der Erfolgsleiter?
Wir kamen im sechsten Stock an. Auch dort schauten wir in die Wohnungen. Dann kam mir die Idee – die simple Idee, mit der alles anfing …
„Herr Weich, was passiert mit dem Dachboden?“ fragte ich und schritt bereits die Treppe weiter hoch.
„Der richtige Dachboden liegt noch eins drüber“, informierte mich Weich. „In diesem Geschoß waren kleine Zimmer für die Dienstboten. Im Moment ist es in einem furchtbaren Zustand, mit schrägen Wänden und unpraktischen Nischen. Das baue ich im nächsten Jahr aus.“
„Darf ich reinschauen?“ fragte ich ihn.
„Gerne, aber seien Sie nicht zu schockiert. Es sind halt vergammelte Räume. Das Dach ist allerdings dicht und in gutem Zustand.“
Ich guckte hinein. Es sah gruselig aus: uralte Dachverschläge, fast verrottet und voller Gerümpel. Aber es waren 150 qm Fläche.
„Würden Sie mir das Dachgeschoß im jetzigen Zustand zum Sonderpreis verkaufen, Herr Weich?“
Weich war überrascht. Einen Moment dachte er nach, dann fragte er mit einem Pokergesicht: „Was würden Sie bieten?“
„50.000 cash down.“
Jean sah mich erschrocken an.
„Willst Du das nicht nochmal in Ruhe überlegen“, stammelte sie bestürzt über meinen Leichtsinn.
„Nein“, sagte ich todernst. „Herr Weich, Sie haben mein Angebot.“
„Ich muß das in Ruhe durchdenken. Ich rufe Sie morgen im Büro an, Herr Bartels. Einverstanden?“
Ich nickte, gab ihm meine Karte und wir verabschiedeten uns. Jean schimpfte los, als wir aus dem Haus waren.
„Du bist wahnsinnig, Adi! Wie kannst Du soviel Geld für den verrotteten Dachboden bieten. Oh Gott, Du weißt, wir haben nur 4.000 Mark auf der Bank.“
Ich gab ihr einen Kuß und streichelte sie.
„Jean, das rechne ich Dir zuhause vor“, erklärte ich. „Du glaubst nicht, was für Ideen mir bei dem Typen eingefallen sind. Wir werden die gleiche Art von Geschäft machen wie er. Nur zwei Nummern kleiner.“
In unserer Wohnung angekommen, stürzte ich wie ein Besessener an meinen Schreibtisch und fing mit dem Zeichnen an. Bis in den späten Abend hinein rechnete ich herum. Als ich mir über meinen Entschluß im klaren war, setzte ich mich zu Jean ins Wohnzimmer und schenkte uns einen doppelten Scotch ein. Dann zeigte ich ihr meine Zeichnungen.
„Aus dem Dachgeschoß könnte ich drei 2-Zimmer-Wohnungen machen“, sagte ich.
„Paß auf, wir leihen uns das Geld von der Bank. Wir bauen die erste 2-Zimmer-Wohnung aus und ziehen ein. In dem Moment haben wir die Sache schon geschaukelt, weil die ersparte Wohnungsmiete die Hypothek bezahlt.“
Jean hörte mir verwirrt zu.
„Dann machen wir weiter und ziehen Trennwände in die restlichen Räume und verkaufen eine Wohnung zum Selbstausbau. Das verschafft uns genug Geld für den Ausbau der dritten.“
Sie nickte zaghaft und sagte: „Okay, wenn Du glaubst, daß Du es finanziell packst, bin ich einverstanden.“
Sie umarmte mich und flüsterte: „Wer nichts im Leben riskiert, kommt zu nichts. Machen wir's halt.“
Am nächsten Tag rief mich Weich an. Er versuchte, den Preis um 10.000 Mark hochzudrücken. Ich lehnte ab. Zwei Stunden später rief ich bei ihm an, und wir einigten uns auf die Hälfte. Das gesamte Geld, das wir auf der Bank hatten, einschließlich genehmigtem Banküberzug deckte gerade die Anzahlung beim Notartermin. Der Rest war sechs Wochen später fällig, wegen der Bankfinanzierung.
„Allerdings müssen Sie zu mir ins Büro kommen, um den Vorvertrag zu unterzeichnen. Eine reine Formsache“, meinte Weich.
„Wissen Sie, auf dem Papier gehört das Haus meiner Frau. Sie hat meine Immobilienfirma EIWO beauftragt, die Wohnungen zu verkaufen. Wegen der Banken allerdings, die alles finanziert haben, darf ich nur verkaufen, wenn ich was Schriftliches habe. Wie wäre es morgen um elf?“
„Ich verstehe“, sagte ich. „Gut, bis morgen.“
Ich war sehr nervös. Es ging um viel Geld und unsere Zukunft. In der Nacht wachte ich zweimal auf und dachte erschrocken darüber nach. Aber pünktlich zum Termin erschien ich am nächsten Tag in Weichs pompösen Büro an der Hauptwache. Er präsentierte mir einen dreiseitigen „Kaufauftrag“.
Ich überflog die wichtigsten Eintragungen. Eigentlich war alles klar. Für die vielen Klauseln auf der Rückseite hätte ich allerdings einen Anwalt gebraucht. Ich wollte nicht unerfahren wirken – ich unterschrieb.
„Fein“, sagte Weich zu mir.
„98% aller Millionäre haben so angefangen wie Sie, Herr Bartels. Grundbesitz ist das einzige auf der Welt, das sich nicht vermehren läßt. Und er ist die sicherste Anlage“, er klopfte mir wohlwollend auf die Schulter.
„Wenn Sie aus dem Dachgeschoß ein paar vernünftige Wohnungen machen, können Sie sie in zwei Jahren mit sicherem Profit verkaufen.“
„Warum erst in zwei Jahren?“ fragte ich.
„Dann ist der Zugewinn steuerfrei. Selbst wenn er in die Millionen geht.“
Weich lächelte über soviel Unwissenheit.
Benommen trat ich wieder auf die Straße. Das war ein Spitzengeschäft! Fast risikolos und sogar steuerfrei. Kein Wunder, daß die Hausbesitzer im Westend gigantische Vermögen zusammenraffen konnten. Eines war mir nun klar: Die große Asche wird mit Immobilien gemacht!
Vom Büro aus rief ich die Zeitung an und inserierte meine Bauernantiquitäten. Jetzt brauchte ich Geld, viel Geld. Als ich ernsthaft darüber nachdachte, geriet ich wieder in Panik. Was würde passieren, sollte ich keine Bank finden, die mir das Geld leiht? Ich rief Heinz an.
„Mach Dich nicht verrückt, Adi. Du hast einen guten Job und die Immobilie ist Deine Sicherheit. Da sehe ich keinerlei Schwierigkeiten. Wichtig ist nur, daß Du 'nen Spitzenplan machst. Demonstriere der Bank ruhig, daß die Bude eigentlich 'ne Viertelmillion wert ist. Wenn der Bericht steht, besorge ich Dir einen Schätzer. Den mußte ein bißchen schmieren und dann gibt er Dir eine Schätzung von zweihundert bis dreihunderttausend Märker.“
Dieses Insiderwissen hätte ich Heinz nicht zugetraut.
„Woher weißt Du das alles?“ fragte ich ihn.
„Der Klaus vom Mercedesladen an der Bornheimer Landstraße ist ein alter Freund vom Weich. Die haben früher im gleichen Club geboxt. Als ich mir den Heckflossen-Daimler bei ihm gekauft habe, haben wir uns über Weichs Aufstieg unterhalten. Er hat erst vor zwei Jahren damit angefangen und scheint auf 'ne Goldader gestoßen zu sein: die Umwandlung von alten Mietshäusern in Eigentumswohnungen.“
Fasziniert fragte ich weiter: „Aber da braucht man Unmengen von Bargeld. Woher hat er das?“
„Nicht der Weich“, meinte Heinz. „Das ist ein stadtbekannter Zocker. Der kauft Mietshäuser ohne einen Pfennig Cash und verkauft sie sofort weiter gegen eine saftige Vorauszahlung.“
Ich bedankte mich, legte auf und fing sofort an, Etagenpläne zu zeichnen und entwarf mein Konzept für die Bank. Ein ganzer Bürotag und drei Feierabende gingen dafür drauf. Schnellstens übergab ich dann die Mappe meinem Bankfilialleiter.
„Das krieg' ich für Sie durch“, sagte er, nachdem er kurz reingeschaut hatte. „Sie können mit dem Geld rechnen.“
Zwei Wochen später gingen wir zum Notartermin. Weichs Notar Dr. Minke war eine ziemliche Persönlichkeit. Er war es so sehr, daß er uns nicht einmal die Hand gab. Er kam ruckzuck zur Sache und las uns den fertigen Vertrag vor. Dieser eingebildete Popanz war allerdings ein Experte in seinem Fach. Er bewies es dadurch, daß er bereits in dem Vertrag die Befreiung von der Grunderwerbssteuer beantragte.
„Ist das denn möglich?“ fragte ich eingeschüchtert.
„Sie kaufen verfallene Räume, die Sie wieder herrichten. Dadurch schaffen Sie Wohnraum und werden damit per Antrag von der Steuer befreit“, erklärte er ohne aufzusehen und schob uns den Vertrag rüber. Er drückte Jean einen Kugelschreiber in die Hand und deutete unter den letzten Absatz:
„Dort bitte unterschreiben. Und Ihr Gatte darunter.“
Wir machten, was er sagte. Dann unterschrieb Weich. Nun waren wir Hausbesitzer. Wenn auch nur anteilig. Aber trotzdem richtige Besitzer! Und wir waren sehr glücklich, obwohl wir uns damit viele Probleme aufgeladen hatten.
Ich besuchte unsere Druckerei am Anlagenring, um Werbematerial abzuholen. Die Firma war noch nicht mit dem Falzen fertig. Eine Stunde Zeit für einen Caféhausbesuch. Ich ging zum Schwille. Es war ein sommerlicher Vormittag. Die Sonne schien und in der Freßgaß' war Hochbetrieb. Ich kaufte eine Rundschau am Kiosk und betrat das Café.
Die Prominentenecke war voll besetzt. Telly Goldstein, Wilhelm Weich, Versicherungs-Meier und Zeitarbeit-Schulz zockten um die Frühstücksrechnung. Ich ging an ihnen vorbei zu Heinzens Stammtisch. Der unterhielt sich gerade mit Franz-Georg, dem Barmann vom Jazzhaus.
„Hallo, Leute“, sagte ich gutgelaunt und setzte mich dazu. Ich bestellte ein Kännchen Kaffee, gekochte Eier im Glas und ein Butterbrötchen. Dann las ich die Zeitung.
„Money, der Baron, hat einen riesigen Supermarkt in Friedberg gemietet“, erzählte Heinz.
„Der hat außer seinem Titel nur das Schwarze unter den Fingernägeln“, meinte Franz-Georg.
„Das ist ja der Witz. Er macht das mit Mike von Habenberg als Partner.“
„Der Mike hat auch nichts drauf“, sagte ich und trank den ersten Schluck des köstlichen Kaffees.
„Aber sie versuchen, ein großes Ding aufzuziehen. Sie haben den leeren Supermarkt zum halben Mietpreis und drei Monate lang das Rücktrittsrecht, wenn der Laden nicht läuft.“
Ich legte meine Zeitung beiseite und hörte interessiert zu.
„Sie haben mir den Auftrag gegeben, in goldenen Buchstaben Mega-Markt draufzumalen. Hab' ich gemacht, sieht Spitze aus.“
„Hast Du wenigstens Deinen Lohn gekriegt?“ Heinz grinste: „Zehn Kisten Wein.“
Franz-Georg und ich schauten ihn verständnislos an.
„Die haben doch keine müde Mark. Der ganze Deal läuft nur mit Naturalien“, erklärte er.
„Sie haben sich Briefbögen drucken lassen mit Mega-Markt und Herr Direktor drauf. Und jetzt fordern sie rund um die Uhr bei Großhändlern und Herstellern kostenlose Probeware zum Testen an. Nach dem Motto: Wenn Ihre Ware bei uns läuft, bestellen wir nach.“
„Und das funktioniert?“ fragte ich.
„Meistens. Hauptsächlich bei den kleineren Unternehmen, die es noch nötig haben. Der Laden ist schon zur Hälfte mit Ware gefüllt: vom Wein bis zum Dosenfleisch, von der Schokolade bis zur Marmelade. Tonnen von Waren haben sie reingemogelt.“
„Wie soll das weitergehen?“ fragte Franz-Georg.
„Is doch logisch. Nach den Probemonaten machen sie den Laden wieder dicht. Alles, was sie vorher verkaufen, klimpert schön in der Kasse und den Rest verhökern sie zu Dumpingpreisen.“
Jeder dachte beeindruckt darüber nach.
„Deren Nerven möchte ich haben“, dachte ich. Ich fing an, von meinem Dachgeschoß zu erzählen und hoffte, Heinz würde Interesse zeigen und sich vielleicht sogar bereit erklären, es anzuschauen. Er verstand etwas von Innenausbau.
„Ich guck' mir gerne Deine Bude an“, sagte er bereitwillig.
„Vielen Dank“, entgegnete ich erleichtert. „Ich brauche die Meinung eines Fachmannes.“
Heinz lehnte sich zurück, schaute kurz zu Weich rüber und sagte dann ernsthaft zu mir: „Mit dem Weich sollte man keine Geschäfte machen. Der ist zu clever. Da muß man Federn lassen.“
Heinz hatte recht, aber das wußte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Am nächsten Tag war in der Post eine Mahnung. Sie kam von Weichs Maklerfirma – für eine Rechnung, die ich nie bekommen hatte. Sie betrug 2.750 Mark für 5% Maklergebühr. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich dachte, ich hätte vom eigentlichen Besitzer gekauft.
„Scheiße“, fluchte ich.
Es war mir klar, daß auf der Rückseite von Weichs Kaufauftrag etwas über eine Maklergebühr stehen mußte. Ich rief ihn an und teilte ihm mit, daß ich mich weigere, die Gebühr zu zahlen.
„Da werden Sie ganz schön Ärger bekommen“, sagte er zynisch. „Sie haben unterschrieben.“
„Aber ich hab' den Betrag nicht miteinkalkuliert. Ich hab' ihn nicht“, jammerte ich.
„Hmm … Es gäbe eine Möglichkeit, Ihnen entgegenzukommen“, sagte er. „Ich wäre zufrieden, wenn Sie mir die Hälfte schwarz geben würden. Ohne Quittung, Sie verstehen?“
„Und in bar.“
„Ja, genau. Wann könnten Sie zahlen?“
„Wenn es sein muß, dann heute nachmittag“, seufzte ich.
„Okay, kommen Sie zu mir ins Büro“, sagte er und legte auf.
1.375 Mark in bar! Damit waren wir endgültig blank. Zum Glück war es kurz vor dem Ersten und mein Gehaltsscheck könnte schon da sein. Ich rief meine Bank an.
„Überziehen Sie ruhig und machen Sie das in den nächsten Monaten wieder glatt“, meinte mein Banker.
Zähneknirschend holte ich das Geld und brachte es Weich. Der gab mir eine Bescheinigung, daß ich von der Maklergebühr befreit sei. Mit einem Mordshaß ging ich zurück zur Arbeit.
Am selben Abend traf ich Heinz am Bau. Als wir hochgingen und ich das Dachgeschoß aufschloß, erzählte ich von Weichs Rechnung.
„Das ist ein aalglatter Lump. Da wurd'ste ganz schön gelinkt“, meinte er. „Laß bloß in Zukunft die Finger von ihm.“
Wir traten in den Flur, und ich packte meine Tasche aus. Zollstock, Papier, Bleistifte, eine Wasserwaage und zwei Dosen Bier waren drin. Das Bier war für Heinz, weil er immer bei der Arbeit was zum Schlucken brauchte. Heinz machte eine Dose auf.
„Der Bau sieht zwar vergammelt aus, ist aber trotzdem in gutem Zustand“, murmelte er und klopfte mit der Dose an die Balken.
„Solide. Der Fußboden ist auch gut“, sagte er aufmunternd zu mir. „Das Dach ist dicht. Da kommen Isoliermaterial und Nut- und Federbretter rauf. Die Zwischenwände machen wir aus Rigips und Isolierwolle.“
Nur die Fenster und Türen gefielen ihm nicht.
„Isolierfenster und Edelholztüren holen wir uns vom Baumarkt, möglichst im Sonderangebot“, meinte er.
„Langsam, Heinz. Du weißt, daß ich kaum Geld habe.“
Ich dachte nach.
„Vielleicht kann ich am Wochenende ein paar antike Bauernmöbel verkaufen. Das könnte klappen.“
„Du mußt einen Kleinkredit auftreiben. Wir werden mehr brauchen“, sagte er.
„Wenn ich mit einem Kumpel zusammenarbeiten kann, könnten wir die erste Wohnung in ungefähr acht Monaten fertig haben. Dann bauen wir die zweite Wohnung als Rohbau aus.“
Ich nickte eifrig.
„Wir können sofort anfangen. Von draußen sieht keiner, ob wir arbeiten. Und wenn die Baugenehmigung kommt, haben wir schon die Hälfte fertig.“
Wir besprachen die weiteren Details und einigten uns auf den Stundenlohn: schwarze fünfzehn Mark. Es konnte also losgehen.
Bald war ich Stammkunde in allen Baumärkten des Frankfurter Raumes. Ein Kleinkredit und der Antiquitätenverkauf hatten mich für den Anfang flüssig gemacht. In meiner knapp bemessenen Freizeit suchte ich die billigsten Rigipsplatten, Türen, Zargen und schleppte mich mit Werkzeug, Elektrozubehör und Isolierwolle ab.
Dann zogen wir endlich ein. Wir jubelten, als wir unsere eigene Wohnung betraten.
Die Wartezeit für die Steuerbefreiung war fast rum, und wir hatten die zweite Wohnung bereits fertig. In der Frankfurter Rundschau gab ich für das Wochenende folgende Anzeige auf:
Sensationelle Möglichkeit von Privat!
2-Zi.-Eigentumswohnung zum Selbstausbau.
Nur DM 49.000
Tatsächlich meldeten sich ein paar Interessenten und einer von ihnen biß an. Wir machten den Notartermin für die nächste Woche klar.
Jean und ich waren begeistert. Es war kaum zu glauben. Wir würden nicht nur den Kleinkredit, sondern auch die Hälfte der Hypothek zurückzahlen können. Außerdem hatten wir Geld für unseren weiteren Ausbau.
Mit neuem Elan bauten wir an der dritten Wohnung weiter. Die Hälfte unseres Monatseinkommens steckten wir in den Ausbau und lebten deshalb auf Dauerdiät. Zwei Tage vor Heiligabend verkauften wir die dritte Wohnung für 89.000 Mark. Abzüglich der Baukosten erzielten wir runde 50.000 Mark Profit!
Aufgrund dieses Geldsegens erfüllten wir uns einen lange gehegten Wunsch und fuhren zum Verkaufsplatz von Klaus an der Bornheimer Landstraße, um einen neuen Wagen zu kaufen. Da stand, top poliert, ein schwarzer 280er Mercedes mit hellgrauen Polstern – immer noch das neueste Modell. Er hatte allerdings 110.000 Kilometer auf dem Buckel. Wir gingen um den Wagen herum.
„Mit dem Daimler sind Sie doch wer“, sagte Klaus Schröter, ein Sympathie heischender Mann mit einer dicken Goldkette im offenem Sporthemd.
„Wenn Sie mit dem vorfahren, sind Sie für jeden der erfolgreiche Geschäftsmann.“
„Am hinteren rechten Flügel ist eine Schramme und dann der Tachostand. Mit dem Wagen ruiniere ich mich, wenn ich Pech habe“, sagte ich unsicher.
„Machen Sie eine Probefahrt, damit Sie selber erleben, wie die Reichen fahren.“
Er reichte mir die Schlüssel und stieg hinten ein.
„Setz Dich rein, Schatz“, sagte ich begeistert und hielt Jean die Beifahrertür auf. Sie nahm Platz.
„Die Sitze sind sehr bequem“, bemerkte sie.
Ich setzte mich ans Steuer und fuhr los, die Bornheimer runter, am Eschenheimer Turm vorbei bis zur Freßgaß'. Vorm Schwille hielt ich an und lud Klaus zum Kaffee ein. Am Tisch bot ich ihm meinen alten Ford und 4.800 Mark in bar.
In der Wichtigen-Ecke saßen Telly Goldstein und Zeitarbeit-Schulz. Sie hatten meine Vorfahrschau mitgekriegt und begrüßten … uns oder nur Klaus, der ja der beste Freund von Weich war?
Klaus grüßte sie, und ich tat es ihm nach.
„Sagen wir 5.500 in cash und davon zwei schwarz“, sagte er.
„Sagen wir fünftausend“, erwiderte ich.
„Okay, dann nehme ich noch das Radio raus“, pokerte er.
Er reichte mir die Hand, und ich schlug ein. Schon am nächsten Tag war der Wagen auf mich zugelassen. Ich strahlte. Mit dem Wagen konnte ich es den anderen jetzt richtig zeigen.
Abends waren wir oft in der Jazzgasse, und allmählich kannten wir viele der Stammgäste. An einem späten Samstagabend, als wir in der Bodega Frikas mit Knoblauchcreme aßen, kam Baron Money herein. Er trug in jeder Hand zwei prallgefüllte Plastiktüten. Als er uns sah, kam er rüber und setzte sich dazu.
„Wie läuft der Mega-Markt?“ fragte ich ihn interessiert.
„Das ist ein harter Brocken, Adi. Wenn man bei dem Geschäft nicht aufpaßt, hat man ruckzuck die Schmiere am Hals“, sagte er und bestellte sich ein Bier und einen doppelten Asbach.
Deutscher Ur-Alt-Adel, nicht so weltfremd wie ich immer dachte, sondern eher realistisch.
„Ich hab' gedacht, Euer Risiko ist begrenzt?“
„Ja. Aber wir haben doch viele Sachen auf Pump kaufen müssen. Die Elektrorechnungen für die Tiefkühltruhen sind sehr hoch. Trotzdem vergammelt und verschimmelt vieles, weil der Laden extrem lahm läuft.“
Um sich zu stärken, schluckte er den Asbach in einem Zug runter.
„Das Geld fliegt nur so davon. Es ist einfach unmöglich, in der jetzigen Zeit als Geschäftsmann klarzukommen, wenn man kein Startkapital hat.“
„Das große Geld der Nachkriegs-Goldgräberzeit ist lang gelaufen“, sagte ich verständnisvoll.
„Heutzutage muß man durch Politik oder Beziehungen an die fetten Pfründe kommen. Und vor allen Dingen das Finanzamt linken“, meinte er. „Schau Dir den Fischer an. Das ist nur ein kleiner Schornsteinfegermeister, aber er fährt einen Ami-Sportwagen und hat heimlich mehrere Mietshäuser in Florida gekauft.“
Ich kannte den großen, blonden Fischer. Er wirkte wie ein Einfaltspinsel und war doch ein gerissener Hund!
„Weißt Du, der zieht nicht nur aus seinem Bezirk ein sattes Monatssalär raus, sondern verordnet sich zusätzlich noch die Aufträge für Schornstein- und Dachsanierungen. Das zieht er mit Kanaken schwarz durch.“ Money kam richtig in Fahrt. „Das steuerfreie Geld legt er clever im Ausland an, dann fliegt er viermal im Jahr hin und macht auf reichen Rentier.“
Dann schaute er bedeutungsvoll auf seine Plastiktüten. „Und unsereiner hat nicht mal mehr Geld fürs Benzin.“
„Was hast Du da Money?“ fragte ich.
„Die feinsten Delikatessen. Alle zum halben Preis. Schau mal rein.“
Und so kauften wir Krabben in Dosen, Würste, Rosinenstollen, echten Champagner, französischen Käse und Schweizer Schokolade zu einem Spottpreis. Die anderen Gäste kriegten das mit und kauften danach direkt aus seinem Wagen, der bis zum Fensterrand gefüllt war. Money machte das jeden Abend, drei bis vier Wochen lang, bis der Mega-Markt geschlossen wurde. Alles in allem kam er mit einem blauen Auge davon. Als ich ihn später einmal im Schwille traf, sagte er schmunzelnd dazu:
„Wieder ein paar Monate des Lebens locker über die Runden gebracht. Gut gelebt und meine Spielschulden bezahlt. Was will ich mehr?“
„Was machst Du jetzt, Money?“
„Ich gehe Häuser abklopfen für Weich“, sagte er. „Ich suche günstige Gebäude für ihn. Dafür zahlt er mir eine gute Provision.“
„Und wie läuft's?“ fragte ich.
„Na ja, Adi. Sagen wir mal, beschissen ist geprahlt!“
Nach drei Jahren hatte ich mich bei der Nähmaschinenfirma gut eingearbeitet, als es eines Tages an meine Bürotür klopfte.
„Ja, bitte“, sagte ich, ohne von meiner Arbeit aufzuschauen. Die Tür öffnete sich und Dr. Hoffmann, zu dem ich ein freundschaftliches Verhältnis hatte, trat ein.
„Bartels, ich komme, um mich von Ihnen zu verabschieden. Ich habe gerade gekündigt“, sagte er und reichte mir die Hand. „Der Geschäftsführer ist eben von einem Kanadier abgelöst worden. Für mich ist auch schon der Nachfolger da.“
Bevor ich mich von meinem Erstaunen erholen konnte, bedankte er sich für die gute Zusammenarbeit und wünschte mir alles Gute. Ein paar Tage später rief mich sein Nachfolger Mr. Cox in sein Büro und erklärte mir, daß die Schulungsabteilung aufgelöst wird. Die Aufgaben würden anderen Abteilungen zugeteilt.
„Herr Bartels, Sie sind ab sofort stellvertretender Werbeleiter“, sagte er. „Sie arbeiten für Herrn Krause, unseren Werbechef.“
Mir wurde schwindelig. Ich hielt mich am Schreibtisch fest. Krause konnte ich nicht ausstehen und umgekehrt war es wohl genauso. Einem Manager in gleicher Stellung unterstellt zu werden, das war …
„Das ist Degradierung“, stammelte ich. „Ich kündige zum Quartalsende und übernehme eine Position bei der Konkurrenz.“
Weil ich das sagte, wurde ich sofort beurlaubt. Damit hatte ich gerechnet. Jetzt hatte ich neun Wochen bezahlten Urlaub, den ich gut gebrauchen konnte. Ich lag zwar wieder einmal am Boden und mußte mich neu orientieren, aber daraus hatte ich in der Vergangenheit jedesmal einen Vorteil gezogen.