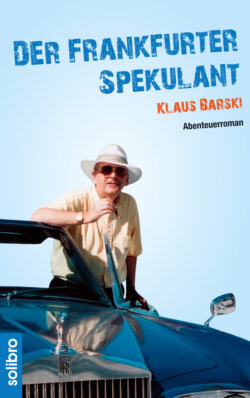Читать книгу Der Frankfurter Spekulant - Klaus Barski - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
BREMEN
ОглавлениеSchon als kleiner Junge war ich ein Einzelgänger, der in einer Traumwelt lebte. Ich hatte Hunderte von Abenteuerromanen verschlungen und träumte davon, Goldsucher, Pferdetramp, Schatzsucher, Journalist oder Rockstar zu werden, je nachdem, was ich gerade gelesen hatte.
Ich hatte immer neue Ideen. So gründete ich einen Verein zur Bekämpfung von Schundliteratur, um so ohne Geld an möglichst viele Groschenhefte heranzukommen. Mit meinen Freunden Achim und Hans legte ich die Statuten unseres Vereins fest und tippte sie auf der klapprigen Schreibmaschine von Achims Tante ins Reine. Mit diesem Dokument, das ich als Präsident und Achim und Hans als meine Stellvertreter unterzeichnet hatten, bestieg ich den Bus der Bremer BVG und fuhr nach Bremen-Blumenthal zur örtlichen Tageszeitung. Dort besprach ich meine ehrgeizigen Pläne mit dem zuständigen Lokalredakteur, der mir amüsiert zuhörte und versprach, mich zu unterstützen. Am nächsten Tag stand unter der Überschrift Schüler gründen Verein zur Bekämpfung von Schundliteratur in der Norddeutschen Zeitung, daß bei dem Präsidenten Bartels eben jene „Schundhefte“ (so wurden sie von den Eltern bezeichnet) wie Akim, Fulgor, Billy Jenkins und Tom Prox abgeliefert werden können. Damals war ich neun Jahre alt.
Tatsächlich kamen in den nächsten Tagen einige Kinder und brachten die Hefte; die meisten waren wohl von ihren Eltern dazu gezwungen worden. Die eingehenden Bestände wurden von uns sorgfältig sortiert und gebündelt. Es war das reinste Schlaraffenland; wir hatten Heftchen in Hülle und Fülle und konnten lesen, lesen und nochmal lesen.
Die meisten der zusammengestellten Sammlungen verschacherten wir dann, tauschten sie gegen Glasmurmeln, Gaspistolen, Fahrtenmesser, Inflationsgeld, Spielzeug, Hitlerorden oder Bargeld. Schon bald war meine Kommode bis zum Rand mit Schätzen gefüllt. Ich kapierte, daß eine gute Idee mit einer sorgfältig geplanten Marketingstrategie und hartem Arbeitseinsatz Berge versetzen kann.
Ich las damals gerade die Schatzinsel und fing an, gleich den Piraten im Buch, mir in der Umgebung geeignete Verstecke für meine Wertsachen zu suchen. Nicht weit von unserer Wohnung im Blumenthaler Forst gab es ein Flüßchen mit ausgehöhlten Baumstümpfen und kleinen Höhlen. Ich verstaute die Sachen in Keks- oder Kaffeedosen, die ich mit Teer, Wachs und Isolierband wasserdicht verschloß, und versteckte sie dort. Dann legte ich mit verschlüsselten Ortsbestimmungen eine Karte an, die einem alten Schatzplan glich.
Hinter dem Forst war ein Barackenlager für Flüchtlinge und fahrendes Volk. An einem schulfreien Samstagmorgen, an dem ich wieder etwas verstecken wollte, sah ich in einer Waldlichtung spielende Kinder aus dem Lager. Sie waren ungefähr so alt wie ich, sie sangen ein fremd klingendes Lied und tanzten und sprangen dazu. Die Jungen waren schmutzig und ihre Kleidung zerlumpt. Sie trugen keine Schuhe und ungepflegte, zottelige Haare fielen in ihre hübschen Gesichter. Ich blieb in den Büschen verborgen und lauschte ihrem seltsamen Treiben.
Da teilte sich das Unterholz auf der anderen Seite der Lichtung. Ein zierliches Mädchen, ungefähr drei bis vier Jahre älter als ich, kam tänzelnd mit ausgebreiteten Armen auf den Platz. Lange, schwarze Haare bedeckten ihren Rücken, und sie trug ein weißes Kleid, das bis zum Boden reichte. Eine goldene Maske mit einem silbernen V über engen Augenschlitzen bedeckte ihr Gesicht.
Das Mädchen sang zusammen mit den Knaben eine traurig wehmütige Klage, tanzte und drehte sich dabei. Regenwolken kamen auf, und es wurde dunkel. Die Kleine tanzte langsamer. Schließlich blieb sie abrupt stehen und zeigte mit dem Finger auf mich! Dann drehte sie sich mit einem schrillen Aufschrei um und rannte davon.
Die beiden Jungen kamen blitzschnell zu mir rüber. „He, da haben wir endlich den heimlichen Lauscher“, sagte der größere mit einer Drohgebärde.
„Ich wollte nicht stören. Ich bin nur zufällig hier vorbeigekommen“, stammelte ich verlegen.
„Halb so schlimm“, meinte er. „Tara ist nur furchtbar erschrocken. Sie ist so scheu.“
„Gehört sie zu Euch?“
„Ja, unsere Familie hat sie aufgenommen. Ihre gesamte Sippe ist im Krieg umgekommen.“
„Warum trägt sie die goldene Maske?“
„Die wurde von Generation zu Generation in ihrer Sippe weitervererbt und ist das einzige, was ihr geblieben ist. Über tausend Jahre alt ist sie und stammt aus Indien.“
Damals war ich von dem Tanz des Mädchens mit der goldenen Maske stark beeindruckt.
Als ich Wochen später ein paar Sachen aus meinen Verstecken holen wollte, stellte ich fest, daß alle meine Schätze geplündert worden waren. Jemand mußte mich beim Vergraben beobachtet haben. Ich weinte und eine ungeheure Wut stieg in mir auf. Ich ging rüber zum Barackenlager, aber es war leer. Städtische Arbeiter räumten den Platz. Das fahrende Volk war verschwunden. Ich fühlte mich verraten und hilflos. Für mich stand fest, daß die Kinder um Tara meine geheimen Schätze geborgen hatten.
Oft nahm ich den Schulatlas meines Vaters mit auf den Speicher über unserer kleinen Mietwohnung; dort hatte ich mir ein Versteck gebaut. Ich studierte die Karten und las die fremden Namen und stellte mir vor, diese exotischen und geheimnisvollen Orte später selbst einmal aufzusuchen. In Europa gab es nur zwei Städte, die mich faszinierten: Paris und London.
Natürlich wollte ich auch nach Amerika, nach New York mit seinen irrsinnigen Wolkenkratzern oder nach Key West, wovon ich keinen blassen Schimmer hatte, aber mich reizte die extreme Lage am Ende einer langen Inselkette, umgeben vom Atlantik und dem Golf von Mexico.
Ich träumte meine Träume, in denen ich ein strahlender, reicher Mann war. Mit einer großen schwarzen Limousine fuhr ich dann ein geheimnisvolles Mädchen mit einer goldenen Maske spazieren …
Es dauerte nicht mehr lange, bis ich begreifen sollte, daß der Schritt ins große Abenteuer eigentlich ganz simpel ist. Wenn Du die Schnauze richtig voll hast und mit Deinem Leben unzufrieden bist, dann mußt Du den totalen Bruch mit Deinen Lebensumständen riskieren. Du mußt radikal alles abbrechen, so daß es keinen Weg zurück mehr gibt. Das ist unabdingbar, denn dann bist Du gezwungen, mit der neuen Situation fertig zu werden und durchzuhalten – so wie ich es 1962 getan hatte.
Irgendwo hinter Metz stand ich im Morgengrauen auf der Landstraße. Die Nacht hatte ich, eingerollt in eine Wolldecke, im dichten Gras des Straßengrabens verbracht. Die Decke legte ich zusammen und verstaute sie in meinem Leinenkoffer. An einer Viehtränke strich ich mir die Haare glatt und putzte mir die Zähne. Ich setzte mich auf eine Milchrampe, aß ein Leberwurstbrot und nahm einen Schluck aus der Milchflasche. In meinem Transistorradio spielte französische Volksmusik – und wieder begann ein neuer Traumtag.
All die anderen armen Teufel auf der Welt rissen gerade ihren lausigen Acht-Stunden-Tag ab, und ich saß hier in der französischen Provinz und tat nichts. Kein Bürochef, der auf die Uhr schaut, wenn Du fünf Minuten zu spät kommst. Keine nervtötenden Zahlenkolonnen, die stunden-, nein tagelang addiert und miteinander verglichen werden müssen; keine lausigen Überstunden bis in den späten Abend hinein, die Dir außer einem anerkennenden Schulterklopfen keine müde Mark mehr ins Portemonnaie bringen.
Ich war zum ersten Mal seit Jahren glücklich, weil ich frei war. Meine Lehr- und Gehilfenzeit als Kaufmann hatte ich in einem Bremer Verlagshaus verbracht. Über fünfzig Stunden die Woche für einen Monatslohn von 50 Mark; mein letztes Gehalt als Gehilfe betrug 320 Mark brutto. Scheiße!
In dem Verlagshaus hatte ich schon im ersten Jahr bemerkt, daß ich gut verkaufen konnte, also bemühte ich mich immer um einen Job am Kundenschalter, um Drucksachen oder Anzeigen zu verkaufen. Da die Lehrlinge nach dem Ausbildungsplan alle Abteilungen einer Firma durchlaufen müssen, war es nicht immer einfach, sich aus der langweiligen Buchhaltung oder dem noch langweiligeren Versand davonzustehlen. Aber weil ich im direkten Kundenkontakt eine gute Figur machte und auch kleine Verkaufserfolge vorzuweisen hatte, setzte mich die Firmenleitung immer häufiger in der Kundenbetreuung ein.
Kurz vor Ende meiner Lehrzeit bat mich der stellvertretende Betriebsleiter, Herr Pickel, in sein Büro. Er legte eine Ausgabe seiner privaten Vereinszeitschrift Aumunder Vereinsleben, die er in seiner Freizeit als ein aus Anzeigen finanziertes Monatsblatt verlegen wollte, auf den Tisch.
„Bartels, das ist mein privates Blatt, das ich zusammen mit 18 Nordbremer Vereinen ab nächsten Monat verlegen will. Die Sache hat aber einen Haken, den hier …“
Herr Pickel legte einen Brief der Bremer Handwerkskammer daneben.
„Diesen Brief hab' ich heute morgen bekommen. Meine Zulassung zur Meisterprüfung. Darauf warte ich seit zwei Jahren.“
Die Meisterprüfung war die Voraussetzung dafür, Betriebsleiter zu werden. Aber Meisterprüfung und Freizeitverlag, das ging nicht zusammen.
„Bartels, Sie sind zwar noch ziemlich jung, haben aber Talent als Anzeigenverkäufer. Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor?“
„Ich möchte für unsere Tageszeitung als Anzeigenvertreter mit Fixum und Provision arbeiten. Möglichst schon im nächsten Jahr, sofort nach meiner Abschlußprüfung!“
„Sehen Sie, genau das hab' ich mir gedacht. Deshalb schlage ich Ihnen ein Geschäft vor, unter uns, versteht sich. Sie übernehmen in den nächsten drei Monaten den Anzeigenverkauf für mein Blatt. Das heißt, Ihre gesamte Freizeit, alle Abende, die Wochenenden und Ihr Urlaub gehen dabei drauf, wenn Sie für mich den Anzeigenvertreter machen. Wenn Sie Erfolg haben und meine Zeitung steht in drei Monaten noch gesund da, garantiere ich Ihnen den ersten freien Anzeigenvertreterposten im nächsten Jahr!“
Ich war vor Freude ganz besoffen. Überschwenglich bedankte ich mich und versprach den totalen Einsatz. Instinktiv erkannte ich meine Chance!
„Chef, Sie werden es nicht bereuen.“
„Viel Erfolg, Bartels.“
Ich schuftete wie ein Tier, arbeitete an den Wochenenden und nahm meinen gesamten Jahresurlaub. Mit meiner Begeisterungsfähigkeit und in dem blinden Glauben, daß Fleiß tatsächlich seinen Preis bringt, schaffte ich Rekordumsätze. Schon vor Erscheinen der ersten Ausgabe hatte ich zwei Drittel Anzeigenraum für drei Ausgaben verkauft! Mein Lohn: 3% vom Umsatz; Pickel kassierte 45%.
Ich war damals 17 Jahre alt und diese lächerlichen drei Prozent schienen mir viel, viel Geld. Ich war bereit, alles, wirklich alles zu geben, um nur den Hauch einer Chance zu bekommen, etwas höher zu steigen auf der Leiter des Erfolgs.
Aber wenn ich mich umsah und die anderen Angestellten betrachtete, ja selbst die Abteilungsleiter oder den Bürochef, wie sie jahrelang „für die Firma“ schufteten und dachten, es im Leben „geschafft“ zu haben, nur weil sie sich einen lausigen Mittelklassewagen leisten konnten, dann sagte ich mir, daß es das nicht sein könne, in zwanzig Jahren hier immer noch zu sitzen, in diesem stinklangweiligen Büro mit seinen kleinen popeligen Intrigenspielen. Ist das wirklich der Sinn des Lebens? Ich hatte schon als kleiner Hüpfer erlebt, wie sich die Älteren gegenseitig fertigmachen, sich zerfleischen für eine Gehaltsaufbesserung, für einen Bürosessel mit gepolsterten Armlehnen, und mir wurde klar, daß ich alles tun mußte, um hier rauszukommen. Alles!
Im nächsten Frühjahr kündigte ein Außendienstmitarbeiter und ging zur Konkurrenz. Durch sein Weggehen mußte sein Bezirk natürlich ein paar Federn lassen, aber es war immer noch ein umsatzstarker Bezirk, der vor allem ausbaufähig war. Pickel gab mir die nötigen Unterlagen: Kundenkartei, Vertretermappen, Verkaufsmuster und Auftragsblock.
„Arbeiten Sie sich in den nächsten 14 Tagen mal da ein“, sagte er und klopfte mir wohlwollend auf die Schulter.
In den nächsten Nächten lernte ich Anzeigengröße, Rabattstaffeln und Preise auswendig. Auf der Landkarte markierte ich mit kleinen Fähnchen meine Besucherroute und entwickelte eine Verkaufsstrategie. Ich war unheimlich glücklich.
Dann rief mich Pickel in sein Büro.
„Es tut mir sehr leid“, stammelte er mit gespielt trauriger Miene, „aber die Geschäftsleitung hat anders entschieden. Sie meint, daß Sie noch zu jung für diesen Posten sind, Bartels. Ich habe alles versucht, um den Chef zu überzeugen. Er schätzt Ihre Fähigkeiten sehr, ist aber der Meinung, daß Sie noch zwei, drei Jahre Erfahrung sammeln sollen, bevor Sie so einen wichtigen Posten übernehmen können.“
Ich war maßlos enttäuscht. Mir schwindelte, und ich setzte mich hin.
„Das ist nicht richtig, das ist nicht richtig“, stammelte ich und verließ sprachlos Pickels Büro.
Die anderen Angestellten hatten ihren Spaß und fragten scheinheilig, wann ich denn nun endlich den neuen Posten anträte.
„Bei dem Job kannst Du Dir bald einen Porsche zulegen“, hänselten sie, obwohl alle Bescheid wußten.
Ich schlich niedergeschlagen durch die Büroräume und war froh, wenn sie mich in Ruhe ließen.
Die alte Redaktionssekretärin aus dem ersten Stock setzte sich eines Mittags in der Kantine zu mir und löffelte ihre Bohnensuppe.
„Bartels, Sie sollten fairerweise etwas wissen. Der neue Außendienstmitarbeiter ist Pickels Cousin!“
Das war eine Bombe. Ich bekam kaum noch Luft. Ich stürmte an meinen Schreibtisch, kramte alle Unterlagen raus, nahm sie und eilte damit zu Pickels Büro. Dort angekommen, riß ich die Tür auf und warf ihm alles ins Gesicht. Ich nannte ihn ein Arschloch, rannte zum Personalbüro, kündigte mit lauter Stimme meinen Job und verlangte meinen restlichen Lohn. Die anderen Angestellten waren inzwischen zusammengelaufen und starrten mich entsetzt an.
„Bartels, machen Sie sich nicht unglücklich“, flüsterte der erste Buchhalter.
„Bartels, Sie verpfuschen sich Ihre ganze Zukunft“, die Chefsekretärin.
Und der hinterlistige Versandleiter sagte hinter vorgehaltener Hand zu seinem Assistenten: „Ich hab' immer gewußt, daß der Bartels eine Niete ist, ich hab's immer gewußt.“
Ich nahm mein Geld, ging zum Hauptbahnhof und kaufte mir eine Fahrkarte nach Hamburg, ohne Rückfahrt, denn ich wollte meinen Eltern nicht ohne Job vor die Augen treten.
Nach Hamburg wollte ich schon immer mal, vor allem auf die Reeperbahn, konnte es mir aber nie leisten. Ich verpraßte meinen gesamten Monatslohn in einer einzigen Nacht. Zuerst landete ich in einer schummrigen Bar mit Animierdamen, schließlich mit einer vollschlanken, blonden Nutte im Bordell. Ich durfte mit ihr all das anstellen, wovon ich bislang nur geträumt hatte, und es hat mir gewaltigen Spaß gemacht. Ich war damals gerade achtzehn Jahre alt.
Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war sie weg. Nur der Hundertmarkschein, den ich klugerweise im Anzugfutter versteckt hatte, und mein Ausweis waren noch da.
Ich zog mich an, ging zu Woolworth und kaufte mir einen beschädigten Leinenkoffer für zehn Mark, dazu zwei Garnituren Unterwäsche, ein Handtuch, Rasierzeug, eine billige Decke aus Kunststoff, ein Oberhemd zum Wechseln und ein paar preiswerte Turnschuhe, dazu ein Messer und im Lebensmittelladen etwas Proviant. In meiner Aktentasche hatte ich noch Schreibzeug und mein kleines Transistorradio aus dem Büro.
Mit der Straßenbahn fuhr ich Richtung Autobahn und ging den Rest zu Fuß. Ich stellte mich mit erhobenem Zeigefinger an die Autobahnauffahrt.
Von Metz wollte ich weiter nach Paris. Irgendwann hielt ein Lastwagen und nahm mich mit.