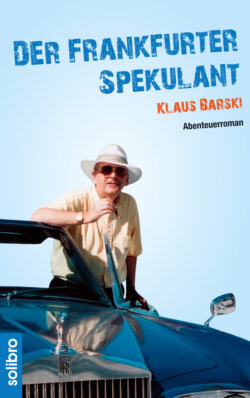Читать книгу Der Frankfurter Spekulant - Klaus Barski - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PARIS
ОглавлениеIch hatte nur noch fünf Francs in der Tasche. Der Fettgeruch eines Hot-Dog-Stands drang herüber und löste in mir ein bohrendes Hungergefühl aus. Ein Straßensänger sang zur Gitarre: And I don't give a damn about a greenback dollar, ein ganz starker Song.
Für zweieinhalb Francs kaufte ich mir eine Tüte Pommes mit Wurst, gab mit dem großen Alu-Streuer mächtig Salz drauf und löffelte noch einen großen Senfklacks auf den Pappteller. Dann setzte ich mich auf eine kaputte Apfelsinenkiste und verspeiste genußvoll mein Abendessen. Um mich herum wurde das große alte Stück „Les Halles bei Nacht“ gegeben: Lachende Nachteulen trieben sich herum, Betrunkene versuchten, heil nach Hause zu kommen, und schwitzende Gemüsepacker ächzten unter ihren Lasten. Und dann war da wieder dieser wunderbare Song: „I don't give a damn about a greenback dollar.“
Durch die Gäste des teuren Cafés de l'Universe ging plötzlich ein Raunen. Ein riesiger, silbergrauer Rolls Royce-Phantom war vorgefahren. Der Chauffeur sprang raus und öffnete die hintere Tür.
Ich legte meine englische Filzmelone, die ich mir auf dem Flohmarkt gekauft hatte, mit der Öffnung nach oben auf die Obstkisten. Ich trug meinen abgewetzten Büroanzug und verdreckte Tennisschuhe, war unrasiert und hatte lange, schmutzige Haare; ich sah wie ein heruntergekommener Gammler aus.
Aus dem Rolls stieg ein kleiner, dunkelhaariger Mann im Frack; er war etwa 45 Jahre alt, hatte ein Bäuchlein und trug ein grünes Ordensband auf dem Revers. Nachdem er ausgestiegen war, half er seiner Begleiterin, einem bildschönen, jungen Mädchen mit langen, schwarzen Haaren aus dem Wagen.
Dabei hob sie den Saum ihres schulterfreien Abendkleides an. Sie war schlank und trug eine goldene Maske, in der Mitte über den Augenschlitzen konnte ich das silberne V erkennen. Ich erkannte Tara sofort. Sie lächelte mich freundlich an.
„And I don't give a damn about a greenback dollar“, klang es auf einmal ganz nah an meinem Ohr.
„Hey man, you like that girl?“ fragte mich der blonde, blauäugige Sänger, der dicht neben mir stand und frech grinste. Er war sehr muskulös, trug einen Oberlippenbart, eine Pilotenbrille, braune Lederjacke, Jeans und Bundeswehrstiefel.
Als das elegante Paar an uns vorbeiging, warf der ordengeschmückte Mann eine handvoll Münzen in meinen Hut und sagte lachend: „That's nearly a greenback dollar, friends.“
Ich sagte überrascht „Danke, Chef“, worauf sich der Sänger abrupt zu mir umdrehte.
„He, du bist ja Deutscher!“
„Ja, aus Bremen, ich bin schon seit ein paar Wochen in Paris.“ Ich streckte ihm meine Hand entgegen. „Ich heiße Adi Bartels.“
„Wolf Schmidt, aus Essen.“
Ich nickte zur silbergrauen Limousine ‚rüber und sagte: „Ich steh auf Rolls Royce. Der Phantom ist für mich das absolut Größte, was es gibt.“
„Da brauchst Du aber jede Menge Kohle, Mann, genau wie der geölte Konsul hier“, antwortete Schmidt und deutete auf das CC-Nummernschild.
„Wenn man eine Panne mit 'nem Rolls hat, kommt ein Mechaniker per Hubschrauber direkt aus dem Werk, um ihn zu reparieren, hab' ich gehört.“
„Das ist blödes Gequatsche“, meinte Schmidt kopfschüttelnd.
„Wenn ich erstmal reich bin, dann kauf' ich mir auch einen Rolls Royce“, sagte ich, nahm die Münzen aus dem Hut und reichte sie Schmidt.
Er schlug vor, davon eine Flasche Rotwein zu kaufen und sie gemeinsam zu trinken. Die Gitarre hatte Schmidt von einer Freundin geschenkt bekommen. Sie hatte ihm auch das einzige Lied, das er spielen und singen konnte, beigebracht. Damit zog er jeden Abend den Boulevard St. Michel und St. Germain rauf und runter. Das Geld, das er bekam, reichte zum Leben … bis zum nächsten Abend.
„Das ist ein Spitzenleben hier in Paris“, sagte Wolf und reckte sich. „Du lebst wie ein Fürst, hast immer reichlich Mäuse in der Tasche und brauchst nicht zu malochen. Die einzige Scheiße ist nur, daß das nicht im Winter geht. Da geh' ich zurück nach Essen und arbeite als Gabelstaplerfahrer in einem Lagerhaus. Gott, wie ich das hasse!“
Er schlug einen harten Akkord an und sang: „And I don't give a damn about a greenback dollar!“
Ich wohnte damals im Arbeiterviertel Levallois, im Nordwesten der Stadt, in der Auberge de la Culture – von Kultur war da allerdings nicht viel zu spüren. Wir schliefen zu zwölft in einem Zimmer, das inklusive einfachem Frühstück nur zweieinhalb Francs pro Nacht kostete. Die Herberge war heruntergekommen und verdreckt und deshalb nur für Penner und gestrandete Existenzen akzeptabel. Mindestens einmal pro Woche waren wir von oben bis unten von Läusen und Wanzen zerstochen; dann kam der Kammerjäger und sprühte alles mit einem stark riechenden und wenig wirkungsvollen Insektengift aus. Wir schliefen auf Armee-Klappbetten und jeder bekam zwei dünne, verschlissene Wolldecken. Manche hatten einen Schlafsack und schliefen aus hygienischen Gründen darin. Ich hatte leider keinen. Zum Frühstück erhielt jeder von der Madame, einer freundlichen Herbergsmutter, zwei Baguettehälften, die mit einem Hauch von Margarine bestrichen waren, und heißen Malzkaffee, der allerdings entsetzlich schmeckte. Aber man hatte ein warmes Frühstück im Magen und das war, was zählte. Und wenn die Sonne schien und ich noch 11 und 1/4 Francs für eine Packung Gauloises hatte, dann war die Welt für mich mehr als in Ordnung.
Ich hatte mich mit Wolf Schmidt im Petit Café an der Seine verabredet. Als ich ankam, las er die Zeitung und saß an seinem Lieblingstisch, direkt an der Straßenecke.
„Setz Dich, ich spendiere Dir 'nen Kaffee“, sagte er lässig.
„Garçon, un café noir!“ rief er dem Kellner zu.
Dann saßen wir dort stundenlang und betrachteten die vorbeiziehenden Passanten. Die alten Pariser aus dem Viertel gingen zum Einkaufen, Studenten von der Sorbonne schlenderten vorbei, Hippies aus aller Welt vermischten sich mit amerikanischen und europäischen Touristen, gut gekleidete Geschäftsleute und Angestellte hasteten vorüber und Neger in langen exotischen Gewändern boten ihre Waren feil, auch Polizisten aus dem großen Kommissariat an der Ecke liefen vorbei.
In dem Café lernten wir die verrücktesten Leute kennen: Taschendiebe, Autoknacker, Künstler und Lebenskünstler aller Schattierungen. Mittags kam meistens der Engländer-Jeff in seiner abgeschabten Mönchskutte vorbei. Er hatte blaue Augen und rötlichblonde Haare, einen mächtigen Bart und trug indische Sandalen. Im Arm hatte er ein Bündel mit allerhand Diebesgut.
„Ich hab' heute Nacht mindestens dreißig Autos kontrolliert“, sagte er und entfaltete sein Tuch.
„Ich bin der Robin Hood vom Montmartre: den Reichen nehmen und den Armen geben. Sind interessante Sachen dabei: vier Paar Lederhandschuhe, zwei Transistorradios, Regenschirme und ein Topfeuerzeug, echtes Gold.“
Er hielt das Feuerzeug in die Höhe.
„Ein wertvolles Dupont-Feuerzeug, wer will es haben? Nur 50 Francs!“
„Ich geb' Dir 30 und keinen Centime mehr, Jeff“, rief Wolf und zog drei alte Tausender aus der Tasche.
„It's yours!“ Jeff stellte das Feuerzeug auf den Tisch und grapschte blitzschnell nach dem Geld.
Peter Hummer, der Maler von der Place du Tertre, kaufte einen Knirps für fünf Francs, und Hasch-Hermes aus Frankfurt erstand für die gleiche Summe eine Pilotenbrille. Gute Geschäfte auf beiden Seiten.
Ein Taxi hielt und ein gut aussehender, modisch gekleideter Typ hievte eine zusammengeklappte Staffelei und ein noch feuchtes, mit Drahtstiften und Spanplatte gesichertes Ölgemälde aus dem Auto. Er rückte seinen langen, grünen Wollschal zurecht, drehte sich um und nahm ein Bild entgegen, das ihm Kim, seine schwarze, afrikanische Freundin, aus dem Wagen reichte, bevor sie dann ebenfalls ausstieg. Der Maler hieß Rolf Bartewski und kam aus Hanau. Offenbar hatte er an diesem Tag ein Bild verkauft, denn er kam mit dem Taxi statt mit der U-Bahn, zudem spendierte er uns allen einen petit rouge.
Maler in Paris, das war für mich damals das Höchste, ich beneidete die Typen und war froh, daß sie mich in ihrer Mitte duldeten. In der Schule hatte ich zwar immer mit Begeisterung gemalt und gezeichnet, aber es hatte in jeder Klasse immer einen oder zwei mit mehr Talent gegeben. Sie kamen mir begnadet vor und ließen mich meine eigenen Ergüsse kritisch betrachten, so daß ich zu dem Ergebnis kam, daß man diesen Schuß Genialität haben muß, um erfolgreich zu sein und dem miesen Mittelmaß zu entkommen.
Bartewski liefen all die hübschen Mädchen nach, bei denen ich nicht den Hauch einer Chance hatte. Ich beneidete ihn.
„Wo ist der Place du Tertre?“ fragte ich Schmidt. Er erklärte mir, wie man mit der Metro zum Montmartre kommt und wo Sacre Coeur liegt.
„Wenn Du auch Dein Glück als Maler machen möchtest, dann fahr hin, ich spendier' den ersten Tag mit einem Kredit von zwanzig neuen Francs!“ sagte er und steckte mir großspurig zwei Scheine in die Brusttasche.
Wenn er genug Publikum hatte, war Schmidt ein überheblicher „Big Spender“.
Am nächsten Vormittag machte ich mich auf den Weg. Ich ging drei Kilometer zu Fuß von Lavallois zur Endstation der U-Bahn, fuhr dann bis Clichy und stieg in den Zug nach Barbes. Dort stieg ich aus und ging durch enge, bevölkerte Gassen, vorbei an den bekannten Tati-Textilhäusern, Kneipen, Bordellen und schmuddeligen Bistros, schob mich durch heftig gestikulierende Arabergruppen und Armeen von Touristen, die aus ihren Reisebussen kletterten, und stieg immer höher, bis ich endlich die majestätische Kuppel von Sacre Coeur sah. Die endlos wirkende Treppe mündete direkt vorm Bistro Sabout-Rouge. Der Himmel war von einem wolkenlosen, strahlenden Blau und die Sonne knallte erbarmungslos. Vor dem Platz standen unzählige Maler und pinselten an ihren Ölbildern. Ich war überwältigt von dem Treiben auf dem Platz. Die Touristen photographierten wie wild, und die Kellner wieselten in den umliegenden Cafés, die mit ihren rotkarierten Tischdecken und blauen Markisen aussahen wie auf den Postkarten.
Peter Hummer, der deutsche Maler, den ich schon vom Petit Café kannte, trug ein seidenes, chinesisches Käppchen und ein schwarzes Gewand. Sein schmales Kinn zierte ein Spitzbart. Er arbeitete an einer typischen Montmartre-Szene, die er mit Holzkohle vorgezeichnet hatte. Er trug eine Gasmaskenbrille aus der Armee, die beim Malen fast die Leinwand berührte. Er benutzte keinen Pinsel, sondern trug die Farbe mit einem kleinen, dünnen Spachtel sorgfältig auf. Seine Bilder gefielen mir. Aufgrund der eigenartigen Technik hatten sie eine strenge, weltentrückte Wirkung.
Ich bummelte weiter um den Platz herum, und kurz darauf entdeckte ich den Meister persönlich, Rolf Bartewski. Zu einem grauen Flanellanzug und grünem Rollkragenpullover trug er seinen grünen Wollschal. Auf dem Kopf hatte er einen Strohhut. Er war umringt von ein paar jungen Touristinnen, die seine Bilder bewunderten. Bartewski war dabei, das Bild zu datieren. Aufgrund irgendwelcher Gesetze durfte jeder Maler nur ein fertiges Bild zum Verkauf ausstellen und an einem neuen arbeiten. Hinter der Staffelei bewahrte er deshalb immer noch ein fertiges, gut verpacktes Bild als Ersatz für ein verkauftes auf. Natürlich war das Bild, an dem er arbeitete, ebenfalls fertig. Doch jeder Maler spielte ein bißchen Theater. Wenn ein Tourist stehen blieb und Interesse an seinem Bild zeigte, nahm er einen Pinsel, ging ein paar Schritte nach hinten und betrachtete kritisch sein Werk, trat dann wieder vor und machte mit dramatischer Geste einen schwarzen Punkt auf einen schon vorhandenen schwarzen Punkt. Dann ging er wieder zwei, drei Schritte zurück und betrachtete das Bild mit zusammengekniffenen Augen, stürzte erneut an die Staffelei, um abermals einen Punkt auf den Punkt zu malen. Rolf zog nun genau die Show ab und malte lange an seiner '62 herum, der Endlosdatierung. Dabei verwickelte er die drei amerikanischen Studentinnen, die interessiert sein Bild betrachteten, in ein Verkaufsgespräch.
„Do you like this picture?“ fragte er charmant, steckte dabei das Ende des Pinsels in den Mund und schaute die kleine Schlanke mit dem mächtigen Busen und den engen Jeans erwartungsvoll an.
„Oh yes, it's fantastic!“ antwortete sie verlegen, während ihre beiden Freundinnen kicherten.
Man war bereits am entscheidenden Punkt angelangt. Entweder versuchte er nun, das Bild zu verkaufen, oder er begann, sie anzubaggern. Und Rolf war gerade darin ein Meister. Das ging von der Einladung, mit ihm in dem nur ein paar Meter entfernten Bistro einen Kaffee zu trinken, bis hin zu dem Vorschlag, ihm in seinem Atelier Modell zu stehen. Die Masche mit dem Modellstehen benutzte natürlich jeder der Maler auf der Place und die jungen Mädchen fielen oft genug darauf herein. Aber Rolf war zur Zeit mit Kim liiert, die ihn eifersüchtig bewachte. Er erklärte der Amerikanerin, daß sein Bild ein stilisiertes Liebespaar darstelle.
„Dieses Bild hab' ich als Erinnerung an eine große, verlorene Liebe gemalt. Die letzten sieben Nächte hab' ich wie im Fieber daran gearbeitet.“
Dabei blickte er gedankenverloren und sehnsüchtig in die Ferne, seufzte und sah dem Mädchen in die Augen, lächelte und griff nach dem Pinsel, um erneut die Rundungen der '62 nachzumalen. Die Kleine war hingerissen und schaute ihn mit weit geöffneten Augen hypnotisiert an.
„Dir, schöne Fremde aus Amerika, schenke ich das Bild für nur 120 Dollar!“ sagte er und nahm ihre Hand. „Und dann trinken wir einen kleinen Roten im Bistro nebenan.“
Die junge Studentin sah zuerst den Maler und dann das Bild bewundernd an.
„I like it, I like it very much. Es wird eine phantastische Dekoration für mein Studierzimmer abgeben.“
Sie kramte in ihrer Handtasche und holte ein paar Dollars hervor. Auch ihre Freundinnen prüften ihren Bargeldbestand und liehen ihr ein paar Scheine. Sie zählte alles zusammen und sagte:
„Ich habe nur 90 Dollars?“
„Das ist nicht schlimm, dann verkaufe ich es Dir eben für neunzig und einen Kuß auf die Wange, okay?“ antwortete Wolf und hielt ihr seine geöffnete Hand und die Wange hin. Sie gab ihm das Geld und einen Kuß. Ihre Freundinnen kicherten wieder.
Bevor die Mädchen sich verabschiedeten, baten sie mich, sie zusammen mit dem Maler auf dem Platz zu photographieren. Ich machte das Photo und gab ihnen den Apparat mit einem Lächeln zurück; fröhlich gingen sie davon.
„Guter Tag heute, hab' schon zwei Bilder verkauft“, meinte Rolf, wickelte die Dollarscheine um ein Geldbündel und spannte einen Gummiring darum. Dann nahm er das Gemälde hinter der Staffelei hervor, packte es aus und spannte es in die Staffelei. Es war eine exakte Kopie des gerade verkauften Bildes.
„Das Erfolgsgeheimnis hier auf dem Platz ist, daß Du erstmal ein paar verschiedene Bilder malst und anbietest. Die zwei, die sich am besten verkaufen, kopierst Du dann. Die, die sich schlecht verkaufen, übermalst Du immer und immer wieder und entwickelst dabei einen neuen Stil, bis Du ein paar richtige Renner hast, wie zum Beispiel meinen Clochard hier.“
Er deutete mit dem Pinsel auf ein kleines Bild, das auf dem Boden stand. Es stellte einen schlafenden Vagabunden unter einer Seinebrücke dar, mit Rotweinflasche und Loch im Schuh.
„Das hab' ich schon über fünfzigmal verkauft!“ beteuerte er. „Ich geh' was essen. Hast Du Lust, bei meinen Bildern zu bleiben und sie zu verkaufen?“
Ich nickte erfreut.
„Das hier auf der Staffelei bietest Du für 300 an und gehst beim Verhandeln nicht unter 100. Den Clochard für 160, Minimum 70, okay?“
„Gerne, ich bin total pleite. Was ist für mich dabei drin?“
„Kommt auf den erzielten Preis an. Bei Höchstsatz ein Drittel, bei niedrigem Preis zehn Prozent. Mach halt das Beste draus.“
Er nahm seinen Skizzenblock, zwei Bleistifte und schwirrte ab.
Nun war ich Kunstmaler in Paris, auf dem weltberühmten Montmartre. Ich nahm seinen schwarzen Pinsel und ahmte Rolfs Malershow nach. Auf der Straße spielten zwei Amerikaner Folksongs auf Mundharmonika und Gitarre. Touristen mit PanAm-Taschen schlenderten vorbei, aßen ihre Eiswaffeln und wurden von Portraitzeichnern angehauen.
Monsieur Silhouette schrie: „Monsieur Directeur, Monsieur Doctor – gehen Sie nicht so achtlos vorbei. Ihre Frau Gemahlin hat ein so wunderbares Profil, ich mache Ihnen einen unvergeßlichen Scherenschnitt, für nur drei Francs! Monsieur Directeur, Monsieur Doctor, ich bitte Sie!“
Ich sprach jeden an, der auch nur in meine Richtung schaute. Die Amerikaner sprach ich mit „Do you like my paintings?“ und die Deutschen mit „Scheenes Bild, Chef! Tut Ihnen gefallen?“ an, denn ich war sicher, daß kein Deutscher in Paris je ein Bild von einem anderen Deutschen kaufen würde. Pausenlos verwickelte ich Leute in Verkaufsgespräche. Und so verkaufte ich einem Amerikaner aus New York das große Bild für 400 Francs und einer dänischen Studentin den Clochard für 220 Francs. Von dem Geld steckte ich schon einmal 160 Francs ein.
Als Rolf zurückkam, gab ich ihm 460 Francs. Er war hocherfreut und gab er mir als Provision 150. Ich war nun über 300 Francs reicher und bummelte glücklich über die Place du Tertre.
In einem Café an der Ecke setzte ich mich an einen Außentisch und bestellte einen café noir und ein großes Baguette mit Käse. Es war Samstagnachmittag, und zufrieden genoß ich das bunte Treiben auf dem Platz.
Allmählich lernten die deutschen Maler der Place du Tertre meine Verkaufsbegabung schätzen. Ich verkaufte schließlich für Bartewski, Hummer und Hermes und kam an manchen Tagen auf 500 neue Francs Gewinn. Ich fuhr nur noch mit dem Taxi, gab den Kellnern fürstliche Trinkgelder, spendierte Lokalrunden und legte mir schließlich eine Staffelei zu, um mit der Ölmalerei anzufangen. Allerdings waren meine eigenen Bilder so schlecht, daß ich keines verkaufen konnte. Dafür vertickerte ich für die anderen um so mehr und verabschiedete mich schwermütig von meinen Malambitionen.
Nächtelang hingen wir im Petit Café an der Seine rum. Wenn das schloß, marschierten wir zum Storyville, einem Jazzclub, und machten dort bis zum Morgengrauen weiter. Wir waren ein Haufen junger, lebenshungriger Kerle, die dachten, sie wären die Größten, weil sie ein paar Francs in der Tasche und ein paar Rouge getrunken hatten.
Wolf und ich hatten die wildesten Zukunftspläne. Reich und berühmt wollten wir werden und große, teure Wagen fahren. Wir stritten uns stundenlang darüber, ob nun der Rolls Phantom oder der Silvercloud das bessere Auto wären.
„Der Phantom kostet doppelt soviel wie der Silvercloud, außerdem brauchst Du dafür einen Chauffeur“, sagte ich.
„Der Phantom ist die größere Show und degradiert die simplen SCs“, meinte Wolf ganz cool.
Da saßen wir beide, abgerissene Vagabunden ohne richtige Bleibe, in einer Kneipe und überlegten tatsächlich ernsthaft, welchen Rolls wir uns später anschaffen wollten. Und das war noch nicht genug – ich erzählte Wolf, daß mein Traum war, später einmal ganz in der Karibik oder in Florida zu leben.
„Ich gehe nach Ibiza“, sagte er bestimmt. „Das ist nicht so weit weg von Deutschland und ebenfalls ein Paradies. Da ist die Mark viel wert, und als Deutscher ist man dort der King!“
Wolf nahm seine Gitarre und spielte And I don't give a damn about a greenback dollar. Es war eine warme Spätsommernacht mitten im Quartier Latin. Wir waren jung, vom Rotwein besoffen und große, glückliche Träumer.
„Ich hab' mal einen Film gesehen mit Humphrey Bogart, Gangster in Key Largo hieß er, seitdem träume ich von den Florida Keys“, sagte ich schwärmerisch. „Ich glaube, der alte Hemingway lebt da immer noch und sitzt jede Nacht im Sloppy Joe.“
„Okay Adi, nach der ersten Million hauen wir ab, von mir aus nach Key West. Fragt sich jetzt nur noch, wie wir an die Kohlen kommen.“
„Auf jeden Fall nicht mit unserer Hände Arbeit, das laß Dir gesagt sein. An die dicke Knete kommst Du nur als Geschäftsmann, als echter Schacherer! Links billig kaufen und rechts mit einem bißchen Profit weiterverkaufen. Und das Geld muß Du sofort anlegen und für Dich arbeiten lassen. Nur so geht's“, sagte ich ernst. „Man muß natürlich seinen eigenen Dreh finden – und den kriegen die meisten von ihren Eltern mitgeliefert.“
„Aber wir, Kinder von armen Schluckern, haben den leider nicht mitgekriegt, Adi“, murrte Wolf Schmidt. „An das Geld kommst Du nur durch 'nen guten Bruch oder 'nen Überfall. Und wenn ich erstmal mein Startkapital habe, cash auf der Hand, dann mach' ich einen schönen geilen Stoßbetrug.“
Ich schaute ihn fragend an.
„Stoßbetrug ist, wenn Du eine Scheinfirma gründest und jede Menge Ware auf Pump kaufst, dann verschleuderst Du die Sachen zu einem Bruchteil ihres Wertes und machst mit dem Erlös die große Mücke – nach Ibiza oder sonstwohin!“ sagte Wolf.
Er hatte tatsächlich die Idee, auf kriminellem Wege zum Erfolg zu kommen! Und er ließ sich nicht davon überzeugen, daß dies auch legal gehen könnte.
„Adi, alle großen Selfmade-Millionäre sind halbe Verbrecher, glaub mir. Du mußt über Leichen gehen, wenn Du erfolgreich sein willst“, sagte er mit leuchtenden Augen.
Es wurde Herbst und das Wetter schlechter; es regnete und über die Place du Tertre pfiff ein kalter Wind. Von Tag zu Tag standen weniger Maler auf dem Platz; durchgefroren, mit klammen Fingern versuchten sie durchzuhalten. Die Maler, die ihr Geld gespart hatten, waren zum Überwintern runter an die Côte d'Azur und später nach Süditalien oder Griechenland gefahren, und die, die den Sommer über gepraßt hatten, zitterten nun in der Kälte.
Täglich wurde es ungemütlicher. Um den ganzen Tag dort zu stehen, brauchte man gefütterte Stiefel, einen dicken Pullover oder eine warme Lammfelljacke. Das hatte ich mir in den profitreichen Tagen leider nicht angeschafft. Frierend stand ich nun bei den Bildern und sah, wie sich die Zahl der Touristen Tag für Tag verringerte. Die Maler saßen meist in dem blauen Café an der Ecke und schauten nur sporadisch mal vorbei, um zu sehen, ob ich etwas für sie verkauft hatte.
„He Adi, wie geht's, altes Haus?“ hörte ich jemanden sagen. Es war Wolf Schmidt, der an diesem kalten Oktobertag vor mir stand. Ich hatte eine Mordserkältung und war schlecht drauf.
„Meine Gitarre hab' ich an 'nen Ami verkloppt“, meinte er mit einer hilflosen Geste. „Ich hab' kaum noch einen lausigen Franc machen können in der letzten Zeit. An den Tischen draußen sitzt kein Schwein mehr und drinnen schmeißen sie Dich raus. Gestern haben mich vier Caféhausbesitzer vor die Tür gesetzt, da kommst Du Dir vor all den Leuten scheißblöd vor“, fluchte er.
„Ich mach' hier noch 'nen kleinen Überfall, Tankstelle oder so etwas, und dann hau' ich ab in den sonnigen Süden. Also, falls wir uns nicht mehr sehen sollten, tschüß, bis zum nächsten Sommer auf der Place!“ Er gab mir einen freundschaftlichen Boxerhieb in die Rippen und zog ab.
Am nächsten Tag verabschiedete sich auch der eigenbrötlerische Peter Hummer von mir. „Ich hab' im Sommer etwas gespart und gehe jetzt mit ein paar Typen runter nach Südspanien, der Winter in Paris ist nicht auszuhalten. Was machst Du?“ fragte er mich.
„Ich weiß noch nicht.“
Ich zuckte mit den Schultern. Ich hatte tatsächlich keinen blassen Schimmer, was ich tun sollte.
Zwei Tage später saß ich allein im Petit Café und trank ein Biere d'Alsace. Es regnete in Strömen und heftige Windböen drückten den Regen gegen die Fensterscheiben. Es war so dunkel, daß die Autos ihre Scheinwerfer eingeschaltet hatten. Plötzlich ging die Tür auf und Hermes, der seine grüne Armeejacke über den Kopf gezogen hatte, stürzte herein.
„'n Abend Alter“, keuchte er. „Sauwetter, keine Touristen, kein Zaster, alles Scheiße!“
„Du hast es erfaßt, Mann“, pflichtete ich ihm bei. Er steckte einen Franc in den kleinen Musikautomaten und drückte zwei Songs. Die Maschine ratterte ein bißchen, knackte ein paarmal und fing dann ziemlich blechern an, Bill Haleys Rock around the Clock zu spielen. Er holte sich einen kleinen Roten an der Theke und setzte sich zu mir an den Tisch.
„Den kleinen Supermarché am Sacre Cour hat gestern jemand hopgenommen.“
Er kramte in seiner linken Hemdtasche und zog einen Fetzen zusammengefaltetes Zeitungspapier heraus.
„Hier steht's“, sagte er mit triumphierender Stimme. „Der maskierte Räuber sprach französisch mit deutschem Akzent, war bekleidet mit Jeans, brauner Lederjacke und schwarzen Stiefeln. Er hat den Kassierer der Hauptkasse niedergeschlagen. Beute: 8.000 neue Francs. – Mensch Adi, das ist unser Supermarché am Place.“
Er sah mich mit großen Augen an. „Das deutet doch alles auf Schmidt!“
Zur Unterstreichung seiner Worte schlug er mit der Faust auf den Tisch, so daß die anderen Gäste zu uns herüberschauten.
„Ruhig, ruhig, Junge“, sagte ich leise. „Die Beschreibung mag auf ihn passen, aber Du hast keinerlei Beweise. Natürlich traue ich ihm den Überfall zu, er hat ja selbst dauernd davon geredet, aber den brutalen Schläger nehm' ich Dir nicht ab. Ich denke, daß der Schmidt ein guter Kumpel ist.“
„Adi, da bist Du auf dem falschen Dampfer!“ sagte Hermes.
Ich machte eine abwehrende Geste und glaubte ihm nicht. Aus der Musikbox jaulte Elvis mit seinem Jailhouse Rock. Ein Penner kam vorbeigetorkelt und stocherte in dem Abfallkübel vor dem Lokal. Der Regen hatte inzwischen etwas nachgelassen, als ein Taxi vor dem Bistro hielt. Rolf Bartewski stieg aus und zog die bildhübsche, schwarze Kim hinter sich her.
„Guten Abend, Freunde der Nacht“, begrüßte er uns freundlich und wickelte sich aus seinem riesigen grünen Schal. Dabei gab er Kim einen zärtlichen Klaps auf den Po.
„Garçon, zwei Rote“, orderte er zur Theke herüber. Hermes erzählte ihm aufgeregt die Sache mit dem Überfall und äußerte seinen Verdacht.
„Das gibt es nicht“, sagte Bartewski erstaunt, „dann ist er es gewesen. Er hat nämlich heute morgen die Rechnung im Hotel bezahlt und hatte neue Klamotten an, als er sich von mir verabschiedete. Auf meine Frage, ob er die Credit Lyonnaise überfallen habe, hat er schallend gelacht. Mensch, der Kerl hat Nerven!“
Schweigend schauten wir uns an.
„Der Schmidt, Adi, den kennst Du noch nicht so lange wie ich. Das ist eine ganz hinterlistige, gemeine Schlägertype, der hat irgendwo in seinem Hirn einen Schlag weg, glaub mir“, sagte Rolf nach einer langen Pause. „Ich hab mal gesehen, wie er einen jungen Araber zusammengeschlagen hat, nur so aus Spaß. Vergessen wir's.“
Ich holte mir an der Theke einen billigen Absinth. Die Sache hatte mich mitgenommen. Nach dem vierten Glas ging es mir besser und meine Träume kehrten zurück: weißer Strand, blauer Himmel – irgendwo auf einer kleinen Insel in der Karibik wollte ich mir die Sonne auf den Bauch scheinen lassen.
„Key West, I'm on the way – irgendwann werde ich kommen, irgendwann ...“‚ malte ich mir meine Zukunft aus.
Inzwischen war es Ende Dezember, ich hatte nichts mehr auf der Tasche, zudem war es saukalt in Paris. Ich beschloß, zurück nach Bremen zu trampen und hatte Glück. Der letzte Fahrer ließ mich mitten in der Bremer Altstadt raus. Von meinem restlichen Geld ließ ich mir in der City die Haare schneiden. Meine alte Jacke, sie war nur mehr ein Fetzen, schmiß ich in die nächste Mülltonne und kaufte mir im Sonderangebot eine Jeansjacke für nur 12 Mark, Ramschware von billigster Qualität, dafür aber neu und sauber. Ich wollte nicht so heruntergekommen aussehen, wenn ich bei meinen Eltern vorbeischaute.
Als ich nach Hause kam, lag dort mein Einberufungsbescheid für die Bundeswehr: 1. April 1964, Ausbildungskompanie 14, Wesendorf bei Oldenburg.
Oh Schreck, laß nach, dachte ich. Ich konnte mir nicht vorstellen, in einer Uniform zu stecken, außerdem war ich extrem unsportlich.