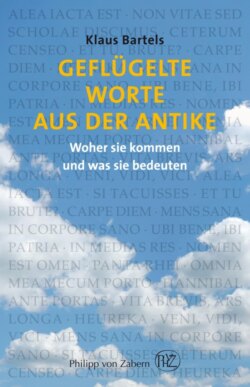Читать книгу Geflügelte Worte aus der Antike - Klaus Bartels - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Amicorum communia sunt omnia
ОглавлениеAuf die Frage, was ein Freund sei, soll Aristoteles einmal erwidert haben: „Eine einzige Seele, die in zwei Körpern wohnt.“ Da klingt ein griechisches Sprichwort an, das Aristoteles auch in den Freundschaftsbüchern seiner „Nikomachischen Ethik“ mehrfach zitiert: Ein Freund sei ein „állos“ oder ein „héteros autós“, ein „anderes“ oder ein „zweites Selbst“, oder, wie es im Lateinischen heisst, ein „alter ego“, ein „zweites Ich“ . Dieser alten Formel steht in der Antike ein entsprechendes, fast möchte man sagen: befreundetes Sprichwort zur Seite. Auf griechisch lautet es „Koiná ta ton phílon“, „Gemeinsam, Gemeingut ist, was Freunden gehört“, auf lateinisch „Amicorum communia sunt omnia“, „Was Freunden gehört, ist alles gemeinsam, alles Gemeingut“, und die deutsche Version ist hier ausnahmsweise einmal die knappste und kargste von allen: „Freundesgut Gemeingut“.
Der Freund ein „zweites Ich“, unter Freunden „alles Gemeingut“: Das verhält sich zueinander wie das Sein zum Haben. Das erste dieser knappen Worte hebt die Grenze dessen auf, was einer ist: die Schranke zwischen dem unverwechselbaren Ich und dem ebenso unverwechselbaren Du; das zweite hebt die Grenze dessen auf, was einer hat: die Schranke zwischen dem unantastbaren Mein und dem ebenso unantastbaren Dein. Kein Wunder, dass zumal die zweite dieser paradoxen Freundschaftsformeln über alles Persönliche hinaus auch politische Brisanz gewonnen hat, in der Antike in Platons Staatsutopie mit ihrer schon damals anstössigen Güter-, Frauen- und Kindergemeinschaft und in der Gegenwart im marxistisch-leninistischen Kommunismus des 20. Jahrhunderts mit ihren volkseigenen Betrieben.
In seinem „Phaidros“ hat Platon dieses „Koiná ta ton phílon“, „Gemeingut ist, was Freunden gehört“, zum wegweisenden Schlusswort des Dialogs gemacht; in seinem letzten Werk, den späten „Gesetzen“, hat er es als ein altehrwürdiges Sprichwort und als ein massgebendes Leitwort für seinen utopischen Staatsentwurf ins Feld geführt: „Der vorzüglichste Staat ist der, und die vorzüglichste Verfassung und die vorzüglichsten Gesetze bestehen dort, wo immer das seit alters geläufige Wort im ganzen Staat so weit irgend möglich zur Tat geworden ist: Man sagt doch, dass wirklich und wahrhaftig gemeinsam ist, was Freunden gehört.“
Über die Menandrische Komödie der „Adelphoí“, der „Brüder“, und ihre lateinische Version, die Terenzischen „Adelphoe“, ist das bereits im Griechischen geflügelte Wort um die Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. den Römern zugeflogen. Da beklagt sich der eine Bruder, der autoritäre Demea, bei dem anderen, dem liberalen Micio, über die – wie er meint – ungebührliche Einmischung des Bruders in die – wie der wieder meint – allzu strenge Erziehung seines Sohnes: „Wenn ich mich nicht um deinen Sohn kümmere, dann kümmere du dich auch nicht um meinen!“, und Micio pariert den Hieb mit der entwaffnenden Parade: „Das ist doch ein altes Sprichwort: dass unter Freunden alles Gemeingut ist – communia esse amicorum inter se omnia.“
Die reiche Zitiergeschichte dieses weitherzigen Wortes, die in der römischen Welt mit diesem Komödienzitat beginnt und über die klassischen Philosophen Cicero und Seneca bis zu den spätantiken Kirchenvätern Ambrosius und Hieronymus hinüberreicht, gipfelt in der frühen Neuzeit in den Erasmianischen „Adagia“. Schon in der ersten, im Säkularjahr 1500 in Paris erschienenen Ausgabe seiner stupenden Zitatensammlung, die in der Folge zu gut drei und schliesslich zu gut vier „Adagiorum Chiliades“, „Zitaten-Tausendschaften“, anwachsen sollte, hat Erasmus das altehrwürdige Sprichwort als ein „glückverheissendes Zeichen“ zum Eröffnungswort erhoben: „Amicorum communia sunt omnia‚ Unter Freunden ist alles gemeinsam, ist alles Gemeingut: Kein anderes Sprichwort stiftet so viel Heilsames, und keines wird so viel gerühmt wie dieses; darum will ich meine Sammlung mit ihm als einem glückverheissenden Omen beginnen. Wäre dieses Wort so fest in unseren Herzen verwurzelt, wie es uns allen locker und leicht über die Lippen kommt, wahrhaftig: Von dem grössten Teil der Übel wäre unser Leben dann entlastet.“
Vgl. „Homo sum, humani nil a me alienum puto“, unten Seite 73.