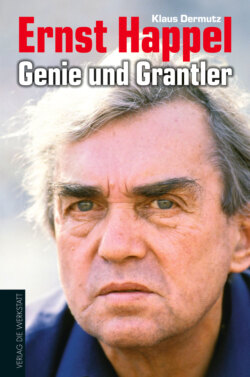Читать книгу Ernst Happel - Genie und Grantler - Klaus Dermutz - Страница 7
ОглавлениеEinleitung
»Happel, Hanappi, Ocwirk« waren die Namen, die mein Vater in den 1960er Jahren oft in einem wehmütigen Singsang wiederholte. Ich begriff nicht, warum er immer wieder die drei Namen nannte, an manchen Tagen noch »Zeman« hinzufügte. Erst allmählich begann ich zu verstehen, dass die Namen dieser begnadeten Fußballer für meinen Vater, derselbe Jahrgang wie Ernst Happel, eine Erinnerung an jene Zeit war, als Österreich zu den besten Fußballnationen der Welt zählte. Mit »Happel, Hanappi, Ocwirk« erhielt ich mit sechs, sieben Jahren die Initiation in die Welt des Fußballs.
In den 1970er Jahren waren die Auftritte von Happel im österreichischen Fernsehen außergewöhnliche Ereignisse. Während Fußball-Österreich den vertanen Chancen hinterhertrauerte, sagte Happel mit einem provokativen Lachen auf die Frage, ob er Nationaltrainer werden wolle: Der österreichische Fußball könne international nicht mithalten, er sei zwar Patriot, aber kein Idiot. Seine Kommentare standen quer zur österreichischen Mentalität, die auf eine diffuse und die betrübliche Realität verschleiernde Ausgewogenheit aus war. Happel hatte das Charisma eines freien, furchtlosen Geistes.
Mitte der 1980er Jahre schlug ich einem Grazer Redakteur ein Interview mit Happel vor. Ich fuhr im August 1986 von West-Berlin aus nach Hamburg. Die Spieler des Hamburger SV kamen an jenem Morgen von einem Auswärtsspiel in der Saisonvorbereitung zurück. Miroslaw Okonski, den Happel von Lech Poznan geholt hatte, hatte blaue Badeschlappen an, einen weißen Verband um den linken Knöchel und humpelte. Ich ging auf Happel zu und stellte mich vor. Er fragte mich, von welchem Boulevardblatt ich komme. Happel hatte einen Trainingsanzug an, er sagte mir, er könne das Interview nicht wie vereinbart am Vormittag geben, ich möge auf ihn warten, um 15 Uhr habe er Zeit.
Ich sah beim Training zu, die älteren Spieler lockerten sich ein wenig, mit den jüngeren übte Ristić noch eine halbe Stunde länger Flanken und Kopfbälle. Es war heiß an jenem Montag, und die Zeit bis 15 Uhr verging nur langsam.
Kurz vor dem zugesagten Termin fuhr Happel in einem eleganten Sportwagen vor, er hatte sich umgezogen, er trug einen feinen Anzug, weißes Hemd und Krawatte. Das Klubgebäude wurde gerade umgebaut, der Boden neu verlegt. Ein Arbeiter fragte Happel, was vor drei Tagen gegen Liverpool los gewesen sei, der HSV habe nur ein »Törchen« geschossen. Happel erwiderte nur, der HSV schieße keine »Törchen«, sondern »Tore«. Das Interview dauerte eine Stunde. Im Hintergrund hämmerten die Zimmerleute.
Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf die Idee kam, Happel nach dem Gespräch vorzuschlagen, ein Buch über ihn zu schreiben. Vermutlich kam mir die Idee deswegen in den Sinn, weil Happel gesprächig gewesen war. Er hatte nichts dagegen, meinte nur, der Verlag müsse ihm ein Honorar von 500.000 Mark zahlen, dafür setze er sich 14 Tage auf ein Schiff und erzähle sein Leben. Ich begrub das Projekt, ich konnte mir nicht vorstellen, einen Verlag zu finden, der bereit sei, Happel diese Summe zu zahlen.
Am Ende des Gesprächs fragte ich ihn, ob ich am nächsten Tag beim Training zusehen könne. Er war damit einverstanden. Als wir auseinander gingen, erzählte er noch, dass Arigo Sacchi und andere italienische Trainer 14 Tage sein Training beobachtet hätten. Am nächsten Tag kam Happel nach dem Training auf mich zu, schenkte mir einen HSV-Schlüsselanhänger. Ich fragte ihn, ob ich auch ein Trikot bekommen könnte. Er brachte mir eines mit der Nummer sechs. Beides habe ich heute noch.
Bevor der HSV im vorletzten Spiel der Hinrunde Ende November 1986 zum Spiel gegen Blau-Weiß Berlin fuhr, rief ich kurz vor neun Uhr am Trainingsgelände an, sagte Happel, ich würde ihn gern wiedersehen. Er meinte, es gehe nicht, er treffe am Freitagabend Freunde, am Samstag habe er das Spiel. Der Samstag war sein 61. Geburtstag. Happel hatte zu den Spielern gesagt, sie mögen ihm einen Sieg zum Geburtstag schenken, was sie auch taten. Der HSV gewann vor 22.000 Zuschauern mit 3:1. Ich war ins Olympiastadion gegangen, hatte die meiste Zeit nur Happel beobachtet, konnte aus der Ferne aber nicht viel erkennen. Als das Spiel zu Ende war, ging Happel in Richtung Marathontor, hob kurz die Hand, grüßte die Fans.
Da ich gelesen hatte, Happel gehe gern ins Casino, schickte ich ihm zum Geburtstag Fjodor M. Dostojewskis Roman Der Spieler. Ich weiß nicht, ob er ihn gelesen hat.
Bevor ich im Oktober 1991 nach Innsbruck zum zweiten Interview fuhr, unterhielt ich mich mit einem Freund über Happels Gesundheitszustand. Ich fragte den Freund, einen Mediziner, was Happel für eine Krankheit habe, er spreche immer von einem Virus, der seine Leber befallen habe. Der Freund meinte, er habe Krebs, Happel gingen die Haare aus, die Chemotherapie greife vor allem die schnell wachsenden Haarzellen an.
Als Happel beim Interview vom Virus sprach, sagte ich im Stillen zu mir, die Wahrheit müsse nicht ausgesprochen werden, erwiderte nur, ich hätte Angst gehabt, es könne Krebs sein. Das Interview fand im ersten Stock einer Tankstelle statt – an einem Ort für passagere Emotionen. Happel hat sich dort wohlgefühlt, war gut gelaunt gewesen.
26 Jahre nach der ersten Idee habe ich das Happel-Buch geschrieben, ihm den Titel Genie und Grantler gegeben.
Vom Soziologen Georg Simmel habe ich die Überlegung aufgenommen, das Genie eines Menschen nicht als die Leistung eines Einzelnen zu sehen. Es ist vielmehr so, dass die »Summierung physisch verdichteter Erfahrungen ganz besonders entschieden nach einer Richtung hin und in einer solchen Lagerung der Elemente erfolgt ist, dass schon der leisesten Anregung ein fruchtbares Spiel bedeutsamer und zweckmäßiger Funktionen antwortet. Dass das Genie so viel weniger zu lernen braucht wie der gewöhnliche Mensch zu der gleichartigen Leistung, dass es Dinge weiß, die es nicht erfahren hat – dieses Wunder scheint auf eine ausnahmsweise reiche und leicht ansprechende Koordination vererbter Energien hinzuweisen.«
Bei Happel sind es die Energien jener technisch brillanten und fantasievollen Fußballer gewesen, deren Eltern als tschechische Saisonarbeiter am Beginn des 20. Jahrhunderts nach Wien gekommen waren, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Von ihnen wird im ersten Kapitel der vorliegenden Biographie berichtet; unter ihnen war auch der Mittelstürmer Matthias Sindelar, Happels Lieblingsspieler. 20 Fotos hatte Happel als Kind von dem exzellenten Techniker gesammelt.
Für Sigmund Freud liegt der Mensch, der seine Wünsche nicht nach dem Lustprinzip erfüllen kann, »mit der ganzen Welt im Hader«. Mit der Welt des Fußballs lag Happel oft im Hader, und sein Granteln war der Ausdruck des Unbehagens, wenn nicht lustvoller Angriffsfußball gespielt wurde.
Das Granteln ist für Happel jedoch kein Selbstzweck gewesen, sondern Movens und Motor für neue Entwicklungen und Erfolge. Für »grantig« wird im Deutschen Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm u. a. auch die Bedeutung »gierig«, »spitz, scharf sein« angegeben. Als Grantler war Happel gierig und scharf auf schöne Spiele und die aus ihnen resultierenden Siege. Nur sie haben den Hunger dieses Genies gestillt.
Die vorliegende Publikation ist der Versuch, Happels Genialität als Spieler und Trainer in den Kontext der Zeitgeschichte und der Professionalisierung des Fußballs zu sehen, um ein Verständnis dafür zu erlangen, von welchem Ausgangspunkt und in welcher Weise Happel den Fußball weiterentwickelt hat.
Mein Vater lebt nicht mehr, Happel ist seit 20 Jahren tot. In der Vergegenwärtigung der beiden Verluste wiederhole ich mit den Lippen eines in die Jahre gekommenen Mannes das »Mantra« meiner Kindheit: »Happel, Hanappi, Ocwirk.«
Berlin, 2. August 2012
Klaus Dermutz