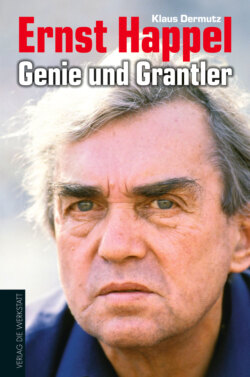Читать книгу Ernst Happel - Genie und Grantler - Klaus Dermutz - Страница 8
Оглавление1925 BIS 1943
Einsame Kindheit, entbehrungsreiche Jugend
In eine massive wirtschaftliche und politische Krisenzeit fällt der Beginn von Ernst Franz Hermann Happels Leben am 29. November 1925 in Wien. Happel hat, so würde man heute dazu sagen, einen tschechischen Migrationshintergrund; er wächst größtenteils im 15. Bezirk bei seiner aus Böhmen stammenden Großmutter auf. Die Welt, in die er hineingeboren wurde und die ihm seine Prägung gab, den meisten heutigen Lesern vermutlich fremd, soll zu Beginn dieser Biografie dargestellt werden.
Wien am Gebirge
Das Ende des Ersten Weltkrieges brachte für die österreichische Bevölkerung einen dramatischen Verlust an Identität und Nationalstolz. Die mächtige Doppel-Monarchie Österreich-Ungarn (1867-1918) hatte einen kleinen Staat zurückgelassen, in dem die Bürgerinnen und Bürger sich mit melancholischen Empfindungen einrichteten. In einer rasant sich wandelnden Welt wurde die nationale Größe der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg beschworen.
Wie tief der Schock saß, lässt sich auch daran ablesen, dass der später weltberühmte Philosoph Ludwig Wittgenstein (1889-1951) noch zwei Jahre nach dem Ende des Krieges in Wien in der Uniform der k.u.k. Monarchie umherlief. Eine einflussreiche Nation hatte ihre Macht und auch ihr Selbstbewusstsein verloren.
Für den aus einer Prager Familie stammenden Essayisten und Erzähler Anton Kuh (1890-1941) hatte Wien als Hauptstadt nach dem Ende der Monarchie die frühere Bedeutung verloren. Im Essay Wien am Gebirge rückt er aufgrund der politischen, sozialen und kulturellen Veränderungen Wien sogar von der Donau weg: »Als Wien noch Reichshaupt- und Residenzstadt der österreichisch-ungarischen Monarchie war, da hieß die Stadt mit ihrem vollen volksschulgeographischen Titel: Wien an der Donau. Der unendliche Strom war das Wichtige, der, Industrien schaffend, Handel bindend, von Europas Herz fast bis zu Asiens Pforte reichte und das Reich in der Mitte durchschnitt. Dieser Strom war die Zufahrtsstraße der Stadt, ihr Vorrang in der Staatsgeographie. Das Wien, das nichts als Hauptstadt ist, liegt nur noch an der Donau, wird von ihr flüchtig mitbeschenkt, aber es gebietet nicht mehr über sie. Es hat an dem Strom nicht mehr das Recht als das frühere Königreich Serbien oder irgendeines der balkanischen Unterländer, denen er noch zum Abschied den Boden stärkt. Man sagt nicht mehr ›Wien an der Donau‹, und wenn man es sagt, so hat es nicht mehr den weitgebietenden, imperialen Glanz. Wien liegt nicht mehr an der Donau – wo es streng genommen niemals lag –, sondern am Gebirge (lies für: a. G.): nicht in der weltoffenen, ausblicksreichen Ebene, sondern angepresst an gemütsumdämmerndes Bergland.«1
Tschechische Minderheit
In breiten Bevölkerungsschichten herrschte eine große Angst vor Immigranten, die um 1900 vor allem aus Böhmen und Mähren nach Wien kamen, um den Sprung in die feine Gesellschaft zu schaffen oder um, wie die meisten der Arbeitssuchenden, die schwerste und am schlechtesten bezahlte Arbeit zu verrichten.
Zwischen 250.000 und 300.000 Tschechen lebten als Wanderarbeiter um die Jahrhundertwende in Wien, sie ließen sich für einige Monate in der Donaumetropole nieder, kehrten im Spätherbst in ihre Heimat zurück und brachen erneut auf, wenn es im Frühjahr in den Ziegelfabriken wieder Arbeit gab. Wien war damit die zweitgrößte tschechische Stadt.
Der Segregation der Tschechen in den einzelnen Bezirken können nach Michael Johns und Albert Lichtblaus Studie Schmelztiegel Wien. Einst und jetzt mit folgenden Zahlen unterlegt werden: »1900 lebten etwa ein Viertel in Favoriten, 12 Prozent in Brigittenau und Leopoldstadt, 11 Prozent in Ottakring; ungefähr ein Viertel der tschechischsprachigen Bevölkerung Wiens wohnte in den inneren Bezirken, wobei die weibliche Bevölkerung die Mehrheit stellte. An dieser Verteilung wird deutlich, dass sich die tschechischen Zuwanderer an die funktionelle Differenzierung der Stadtteile angepasst haben: Die zu einem hohen Anteil in Industrie und Gewerbe unselbständig beschäftigten Zuwanderer siedelten sich in erster Linie in den Industrie- und Arbeiterbezirken 10, 16 und 20 an; ein großer Teil der weiblichen Zuwanderer lebte in den inneren Ober- und Mittelstandsbezirken, dem Arbeitsort der Dienstmädchen, böhmischen Köchinnen und tschechischen Ammen; im peripheren Nobelbezirk Döbling wohnte eine relativ kleine Gruppe Tschechen, die sich in diesem Zeitraum weder nennenswert verkleinert noch vergrößert hat.«2
Auch die Vorfahren von Happel gehörten zur tschechischen Minderheit in Wien. Sie waren in die Donau-Metropole gekommen, um sich unter schwierigen Bedingungen einen Lebensunterhalt zu sichern.
Kaltes Wien
Der Kultur- und Musikwissenschaftler Viktor Velek unterscheidet zwischen zwei Gruppen von tschechischen Migranten, den »Wiener Tschechen«, einer Mittelklasse von Händlern, Kaufleuten, Beamten, zum Reichtum gekommenen Handwerkern, und den »Wiener Böhmen«, der großen Anzahl von Arbeiterinnen und Arbeitern aus Böhmen, Mähren oder der Slowakei. Die Handwerker, die Dienstmäderl, Köchinnen und Schneiderinnen fristeten in den Außenbezirken der Donaumetropole ein entbehrungsreiches Dasein. »Das 19. Jahrhundert war«, so Velek, »das Jahrhundert des Nationalismus. Nach dem Revolutionsjahr 1848 wuchs die Angst vor den Slawen und der ›Tschechisierung‹ Wiens. Z.B. musste man, um das Bürgerrecht zu erhalten, zuerst auf den ›deutschen Charakter Wiens‹ schwören.«3
Den Tschechen wurde in Wien das Leben schwergemacht, es kam immer wieder zu gewalttätigen Konflikten: »Alle diese Dinge haben dazu geführt«, so Velek, »dass sich die Tschechen nie mit ihrer neuen Heimatstadt ausgesöhnt haben. In Liedern, tschechischen Zeitungen und in der Literatur wird Wien immer als die ›böse‹ bzw. die ›fremde Stadt‹ geschildert.«4
Die Tschechen stellten um 1900 ein knappes Viertel der Wiener Bevölkerung. Die Einwanderer wurden häufig mit abfälligen Redewendungen und Liedern bedacht. Auch die Arbeiter-Zeitung brachte im Oktober 1918 ihre Empörung über die Zuwanderung zum Ausdruck, die für ihr politisches und nationales Verständnis ein nicht mehr tragbares Ausmaß erreicht hatte. Der Traum einer Vormachtstellung Österreichs im neu zu gestaltenden Europa war mit der Ausrufung der Ersten Republik im November 1918 ausgeträumt. Das einstmals glorreiche Habsburgerreich war zu Splittern zerbrochen. Wien wurde in der Zwischenkriegszeit zu einer Metropole für schlamperte Genies. Und das galt auch für den Fußball.
In Mehr als ein Spiel – Zwei Studien zum Wiener Fußball der Zwischenkriegszeit legt Kulturwissenschaftler Wolfgang Maderthaner dar, dass »die Arbeitsmigration zu Beginn der zwanziger Jahre gleichsam zu einer alltäglichen Erscheinung im Fußballbetrieb« wurde: »Nun war der Fußball in Wien um diese Zeit bereits ein höchst internationales Phänomen geworden, eben weil er Ausdruck einer zutiefst urbanen Kultur, konzentriert auf die multikulturell geprägte ehemalige Habsburgerresidenz, war. Die Wiener Spitzenvereine fanden ihre wesentlichen Gegner nicht im eigenen Land, vielmehr wurde mit Prag und Budapest ein reger Spielverkehr gepflogen, die regelmäßigen Oster-, Pfingst- und Weihnachtstourneen der Großclubs fanden ein ausführliches und aufgeregtes Echo in der Sportpresse.«5
»Aufschrei der Masse«
In Wien stritten die Politiker verschiedenster Couleur um die Gunst der Bevölkerung und versuchten, einer schwierigen sozialen Lage Herr zu werden, die großen Zündstoff in sich trug.
Die politische Landschaft war zerklüftet. Die Christdemokraten kämpften erbittert gegen die Sozialdemokraten. Die illegalen Nationalsozialisten nutzen die Zeit des Übergangs, um ihre Propaganda und ihre Parolen unter die Leute zu bringen. Die Spannungen zwischen der rechtsradikalen »Frontkämpfervereinigung« und den Mitgliedern des sozialdemokratischen »Schutzbundes« wurden immer größer und führten am 15. Juli 1927 zum Justizpalastbrand. Der Grund dafür war ein mildes Urteil gegen die »Frontkämpfervereinigung«, die auf Mitglieder des »Schutzbundes« geschossen hatten. Ein Kind war bei dem Schusswechsel getötet worden. Die Arbeiter ließen sich in ihrer Empörung nicht mehr stoppen und zündeten den Justizpalast an. Die darauf folgende Auseinandersetzung mit der bewaffneten Polizei, bei der 89 Menschen starben, brachte die Erste Republik an den Rand eines Bürgerkrieges.
Der Schriftsteller Elias Canetti sah mit 22 Jahren den Justizpalast brennen. Es wurde ihm in jenen Tagen bewusst, was es für ein Individuum heißt, in der Masse zu stehen. Für den Germanisten Wendelin Schmidt-Dengler war dieses Ereignis, wie er in Hamlet oder Happel ausführt, »noch nicht die wichtige Keimzelle für sein Werk Masse und Macht, nein, diese war der Sportklub Rapid.«6 Also jener Verein, dem Ernst Happel lebenslang verbunden bleiben sollte.
Als der Justizpalast brannte, wohnte Canetti in Hietzing und arbeitete an einer Dissertation in Chemie. In Die Fackel im Ohr. Lebensgeschichte 1921-1931, dem 1980 publizierten zweiten Teil seiner dreibändigen Autobiographie, schreibt er über diesen Tag: »Eine schwache Viertelstunde Weges von meinem Zimmer, auf der anderen Talseite in Hütteldorf, lag der Sportplatz Rapid, wo Fußball-Kämpfe ausgetragen wurden. An Feiertagen strömten Menschen hin, die sich ein Match dieser berühmten Mannschaft nicht leicht entgehen ließen. Ich hatte wenig darauf geachtet, da mich Fußball nicht interessierte. Aber an einem Sonntag nach dem 15. Juli, es war ein heißer Tag wie damals, ich erwartete Besuch und hatte die Fenster geöffnet, hörte ich plötzlich den Aufschrei der Masse. Ich dachte, es seien Pfuirufe, und so erfüllt war ich noch vom Erlebnis des furchtbaren Tages, dass ich mich einen Augenblick verwirrte und Ausschau hielt nach dem Feuer, von dem er erleuchtet war. Doch da war kein Feuer, in der Sonne glänzte die Kuppel der Kirche von Steinhof. Ich kam zur Besinnung und überlegte: Das mußte vom Sportplatz kommen. Als Bestätigung wiederholten sich bald die Laute, in ungeheurer Anspannung horchte ich hin, es waren keine Pfuirufe, aber es war der Aufschrei der Masse. (…) Es fällt mir schwer, die Spannung zu beschreiben, mit der ich dem unsichtbaren Match aus der Ferne folgte. Ich war nicht Partei, da ich die Parteien nicht kannte. Es waren zwei Massen, das war alles, was ich wusste, von gleicher Erregbarkeit beide und sie sprachen dieselbe Sprache. Damals (…) bekam ich ein Gefühl für das, was ich später als Doppel-Masse beschrieb und zu schildern versuchte. (…) Aber was immer es war, was ich schrieb, kein Laut vom Rapid-Platz entging mir. Ich gewöhnte mich nie daran, jeder einzelne Laut der Masse wirkte auf mich ein. In Manuskripten jener Zeit, die ich bewahrt habe, glaube ich noch heute jede Stelle eines solchen Lautes zu hören, als wäre er durch eine geheime Notenschrift bezeichnet.«7
Für Schmidt-Dengler wäre es fair gewesen, wenn Canetti den Nobelpreis mit dem Sportklub Rapid geteilt hätte. Der Wiener Germanist legte 2002 dar, welchem Ereignis wir die bahnbrechende Studie Masse und Macht (1960) verdanken, und stellte die rhetorische Frage, welcher Fußballverein der Welt sich rühmen könne, ein mit dem Nobelpreis gekröntes Werk verursacht zu haben.
Von den Dichtern und Intellektuellen wurden Rapid und die bei dem Verein spielenden Tschechen nicht nur einhellig verehrt und geliebt. Der Journalist und Dichter Soma Morgenstern (1890-1976) schrieb am 13. Juli 1928 voller Empörung an seinen Freund Alban Berg, dem Komponisten von Lulu und Wozzeck, einem ebenso glühenden wie ahnungslosen Rapid-Fan: »Dein Triumph mit ›Rapid‹ macht mir gar nichts. Über ›Hakoah‹ siegten die Rapidler auf eigenem Platz wie immer mit der Hilfe des Schiedsrichters. (…) Ich hasse diese Tschechen von ›Rapid‹!«8
Pfiffe für Mussolinis Fußballer
Für die Verbreitung der Ideologie des Faschismus sorgten inzwischen die Heimwehren, die in allen Bevölkerungsschichten präsent waren. Ab 1927 wurden von den Unternehmern gelbe Gewerkschaften organisiert. Die Aufmärsche im Oktober 1927 in Linz waren so erfolgreich, dass sie den Sozialdemokraten schwere Verluste zufügten, zumal diese lautstark verkündet hatten, solche Aufmärsche in Arbeiterstädten zu verhindern: »Im Februar 1928 marschierten die Heimwehren durch Meidling«, so Jürgen Dolls Analyse, »ohne dass jedoch dieser ›Marsch auf Wien‹ wie beim italienischen Vorbild den Auftakt zur Machtübernahme bedeutet hätte. Da es den Heimwehren nicht gelang, zu einer Massenbewegung im Stile der Schwesternorganisationen zu Deutschland und Italien zu werden, wovon ihre schwachen Resultate bei den Wahlen von 1930 zeugen, verlegten sie ihre Hoffnungen auf einen gewaltsamen Umsturz. (….) Im größten österreichischen Industrieunternehmen, der von der deutschen Großindustrie dominierten Alpinen Montangesellschaft, wurden nur mehr heimwehrorganisierte Arbeiter beschäftigt.«9
Seit dem Frühjahr 1928 wurden die Heimwehren nicht nur vom Hauptverband der Industrie und von den Banken, sondern auch vom faschistischen Italien mit Geld und Waffen versorgt.
1931 führt die Weltwirtschaftskrise zum Zusammenbruch der Österreichischen Creditanstalt. Das Bankdesaster verschlimmert die soziale Lage vieler Österreicher/innen und ermöglicht einen immer stärker werdenden Einfluss rechtsradikaler Kräfte. Die Konflikte schaukeln sich in den 1930er Jahren immer stärker auf.
Das Burgtheater, die Identität stiftende Institution Wiens, bringt am 22. April 1933 das Stück Hundert Tage von Benito Mussolini und Giovacchino Forzano zur Aufführung und »Geld ins Land«, wie die Wiener Sonn- und Montags-Zeitung (2.5.1933) mit der Überschrift »›Hundert Tage‹ und die österreichische Industrie. Große italienische Aufträge an verschiedene österreichische Industrieunternehmen« berichtet: »Die Herzlichkeit der österreichisch-italienischen Beziehungen trägt auch wirtschaftlich Früchte. In der letzten Zeit flossen namhafte Bestellungen aus Italien bei verschiedenen österreichischen Firmen ein. Dieser Ordereinlauf hat sich seit der glanzvollen Aufführung von Mussolinis Napoleon-Drama erheblich gesteigert, und man führt in eingeweihten Kreisen diese Tatsache auf persönliche Initiative des Duce zurück. Namentlich die völlig reorganisierten Krupp-Werke mit einem derzeitigen Arbeiterstand von 1.100 Mann sind voll beschäftigt, vornehmlich dank italienischer Aufträge. So ereignet sich die selten zu beobachtende Tatsache, dass ein gut gebrachtes Drama im Staatstheater ein anderes Drama, das Drama in den industriellen Elendsorten Österreichs zu mildern vermag.«
Mussolini verzichtet auf die Tantiemen, die ihm durch die Burgtheateraufführungen zugeflossen wären, zugunsten arbeitsloser Wiener Schauspieler. Der Duce lädt Werner Krauß, den Darsteller des Napoleon, nach Rom ein und empfängt den Mimen, der als einziger Passagier in einer Sondermaschine reist, am 5. Mai – am Todestag und in der Todesstunde von Napoleon.
Die Bedeutung der Hundert Tage, so das Wiener Morgenblatt (24.3.1933), liege darin, »dass sie zu den politischen Verhältnissen unserer Zeit eine so lebendige Beziehung herstellen, die niemand zu verkennen vermag«. Mussolinis Stück klinge »wie eine temperamentvolle Verteidigungsrede für die Diktatur, für das alleinige Entscheidungsrecht des großen Mannes, dem in bedrängendsten Zeiten niemand in den Arm fallen sollte, das zu tun, was dem Vaterland frommt. Dass Napoleon zu nobel war, von dieser Diktatur rückhaltlos Gebrauch zu machen, wird nicht nur ihm, es wird auch dem französischen Volk zum tragischen Verhängnis. Dies, offenkundig nur dies ist der letzte und in hohem Maße aktuelle Sinn eines historischen Schauspiels, dessen Autor Mussolini heißt und das im Burgtheater (mit außerordentlicher Besetzung: Werner Krauß als Napoleon) mit gebührender Achtung und Aufmerksamkeit aufgenommen wurde.« Mussolinis Stück wird am Burgtheater vom 22. April 1933 bis zum 18. April 1937 insgesamt 53-mal gespielt.
Die Anhänger der österreichischen Nationalmannschaft sind von Mussolinis Fußballern nicht so betört wie das Burgtheater-Publikum und die Kritiker. Als es am 24. März 1935, knapp zwei Jahre nach der Premiere der Hundert Tage, zu einem Fußballländerspiel zwischen Österreich und Italien kommt, entlädt sich – nach einem Bericht der Brünner Arbeiterzeitung (31.3.1935) – der Unmut: »Als die Italiener vor Beginn des Spieles das Spielfeld betraten und sich mit dem Faschistengruß am Mittelkreis des Spielfeldes aufstellten, brach im Stadion tosendes Pfuigeschrei los. Die Demonstrationen nahmen auch kein Ende, als das Spiel begann; das Publikum benützte jede Gelegenheit, den Faschisten seine Antipathie zu zeigen. In der ersten Spielhälfte gab es ein ununterbrochenes Gejohle und Gepfeife gegen die Italiener. (…) Solange ein Italiener auf dem Spielfeld zu sehen war, hielt die Demonstration an. Während des Spieles versuchten wiederholt die Anhänger der Italiener ihre Landsleute durch Sprechchöre aufzumuntern, wurden aber sofort durch Gegenreaktionen – Pfeifkonzerte usw. – niedergeschrien.« Weltmeister Italien unterliegt Österreich mit 0:2.
Geburtsname Ernst Nechiba
Zu diesem Zeitpunkt ist Ernst Happel neun Jahre alt und lebt bei seiner Großmutter. Trotz intensiver Recherchen konnte der Autor im Wiener Geburtsregister keinen Eintrag des begnadeten Fußballers und Star-Trainers ausfindig machen.
In vielen Porträts über ihn ist zu lesen, dass er das Kind von Karoline und Franz Happel sei. Im belgischen Dokumentarfilm Ernst Happel: Altijd in de aanval (Immer im Angriff, 2009) von Lieven de Wispelaere, Steven van de Perre und Jan Antonissen wird eine andere Herkunftsgeschichte erzählt. Happel hieß zunächst Ernst Nechiba, seine Mutter Karoline brachte ihren Sohn ledig zur Welt und heiratete ein Jahr nach der Geburt ihres Kindes den Wirt Franz Happel, der das Kind als Stiefsohn annahm. Seinen leiblichen Vater hat Ernst Happel nie gesehen.
Franz Happel betätigt sich als Gewichtheber, nimmt sich nicht viel Zeit für den heranwachsenden Sohn. Der großgewachsene Stiefvater betreibt im 9. Gemeindebezirk ein Wirtshaus, spricht dem Alkohol zu, flüchtet aus einem deprimierenden Alltag in ausgedehnte Sauftouren, kommt bisweilen drei Tage nicht nach Hause. Auch Mutter Karoline führt ein Wirtshaus. Ein Familienleben existiert nicht. Die Ehe zwischen der Mutter und dem Stiefvater hält nicht lange, Happel sieht sich als Opfer der Scheidung, ist enttäuscht von den Eltern und auch böse auf sie. Happels Großmutter nimmt den Vierjährigen in ihre Obhut, er wächst bei ihr in der Huglgasse 3 im 15. Bezirk auf. Zwar hat der junge Happel das Gefühl, von den Eltern abgeschoben worden zu sein, doch er empfindet Zuneigung zur Großmutter. Sie betreibt einen Stand am Meiselmarkt, den er in den Krisenjahren oft aufsucht, um seinen Hunger zu stillen.
Die Huglgasse wie auch der Meiselmarkt sind, so der Politologe Georg Spitaler, Kerngebiet von Rapid, »einige Funktionäre der Zwischenkriegszeit hatten dort in der Nähe ihre Betriebe, z. B. Präsident Johann Holub und Fahrradobmann Karl Kochmann«.10
Tatsächlich hat es Happel von der Huglgasse aus nicht weit bis zur »Pfarrwiese«, dem 1911 erbauten Stadion von Rapid. Der Verein ist 1898 von Ottakringern Arbeitern unter dem Namen »Erster Wiener Arbeiter Fußball-Club« gegründet worden. Im Neuen Wiener Abendblatt (5.5.1898) wird der Klub zum ersten Mal erwähnt: »Der 1. Wiener Arbeiter Fußball-Club, welcher es sich zur Aufgabe gemacht hat, den in Wien so beliebt gewordenen Fußballsport auch unter den sportfreundlichen Kollegen der arbeitenden Klasse einzuführen, ladet hiermit alle ernstlich sportgesinnten Arbeiter ein, dem Club, der bereits über eine Anzahl guter und geschulter Spieler verfügt, beizutreten.« Die Einschreibgebühr beträgt eine Krone, der Wochenbeitrag zehn Heller.
Am 8. Januar 1899 wird auf der Generalversammlung des Arbeiter FC die Namensänderung zu »Rapid« beschlossen. Auf einem Teil des früheren Exerzierfeldes der k.u.k. Armee wird auf der Schmelz neben der Radetzky-Kaserne gespielt. Die ursprünglichen Vereinsfarben Blau-Rot werden sechs Jahre später in Grün-Weiß geändert. Die berühmte »Pfarrwiese« wurde 1911 für 4.000 Besucher erbaut, Anfang der 1920er Jahre wird das Fassungsvermögen auf 20.000 Zuschauer vergrößert. Der Sportklub Rapid ist seit der ersten österreichischen Meisterschaft 1911/12 immer erstklassig. Als Happel im Jahr 1938 zu Rapid kommt, ist der Verein bereits zwölfmal Meister geworden.
Straßenfußballer
Für Rapid-Stürmer Alfred Körner war der junge Happel »ein eigenartiger Bua, der hätt’ den Kitt vom Fenster g’fressn, bevor er g’sagt hätt: I hab’ an Hunger.« (Sport Magazin, 1.3.1991) Nicht nur in materieller Hinsicht durchlebt Happel eine harte Kindheit. Im Alter von mehr als 60 Jahren sagt Happel, er habe nie Liebe gekriegt. Es bleibt ihm nicht viel anderes übrig, als sich allein durchs Leben zu schlagen. So wird für den Einzelgänger das Leben früh zu einem Spiel, das er gewinnen muss.
Happel weiß, dass er auf sich allein gestellt ist. Von der Familie ist keine Unterstützung zu erwarten. Der Fußball ist für ihn mit der Hoffnung verknüpft, der engen und entbehrungsreichen Welt seiner Herkunft zu entkommen und ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Der Fußball hilft ihm, belastende familiäre und finanzielle Verhältnisse hinter sich zu lassen.
Als kleiner Bub bekommt Happel von seinem Onkel zu Weihnachten ein Trikot von Rapid Wien und grün-weiße Stutzen geschenkt. Das Dress von Rapid ist freilich nicht seine erste Wahl. Am besten gefällt ihm in der Kindheit das weiße Trikot der Admira. Happel ist glühender Admira-Fan. Er bewundert die Admira-Stars Peter Platzer, Toni Schall und Adolf Vogl. Nach der Schule erledigt er schnell die Hausaufgaben, wirft den Schulranzen in die Ecke und läuft dem Ball hinterher, jeden Tag mehrere Stunden. Er wird ein richtiger Straßenfußballer. Viele Jahre später wird er als Trainer sagen, die besten Fußballer kommen von der Straße, denn ein Kind, das nur zweimal in der Woche eineinhalb Stunden trainiere, könne nicht in der technischen Entwicklung und im Durchsetzungsvermögen mit den Straßenfußballern mithalten, die jeden Tag mehrere Stunden mit dem Ball verbringen und sich von früh an in einer rauen Umgebung zurechtfinden und sich gegen ältere Mitspieler behaupten müssen.
Der Fußball hat für Happel aber auch noch eine andere Funktion: Er hilft ihm bereits in jungen Jahren, mit der Einsamkeit fertig zu werden, die ihn sein Leben lang begleiten wird.
»Genies des Fußballrasens«
In politischer, ökonomischer und kultureller Hinsicht verliert Österreich seit dem Fin de siècle und dem Untergang der Donaumonarchie ständig an Einfluss und Bedeutung. Nur im Fußball genießt Österreich weiterhin hohes internationales Ansehen.
Vor allem dem aus Böhmen stammenden Hugo Meisl (1881-1937) ist es zu verdanken, dass in Österreich bereits 1924 eine Profiliga eingeführt wird, in der die Wiener Vereine dominieren und fast alle Spieler der Nationalmannschaft stellen. »Herr Hugo«, wie die Spieler Meisl nennen, ist der Wegbereiter der Modernisierung und Internationalisierung des Fußballs und wird zum geliebten und auch geschmähten Bundeskapitän des »Wunderteams«, das um 1930 mit seiner eleganten Spielkunst einige Jahre als die beste kontinentaleuropäische Nationalmannschaft gilt und 1932 Sieger des »International Cups« wird, der zwischen Österreich, Italien, Frankreich, Ungarn, der Tschechoslowakei und der Schweiz im Ligamodus mit Hin- und Rückspielen ausgetragen wird.
Ende der 1920er Jahre wird der Fußball zum Massenphänomen und zieht auch die Aufmerksamkeit der Schriftsteller auf sich. Wie die Fußballer werden auch andere Sportler mit Elogen bedacht. Im Illustrierten Sportblatt (15.10.1927) wird konstatiert, dass der »Fußballsport marschiert«, und zu den »Kleinigkeiten aus der großen Fußballwelt« gehöre es, dass ein Umdenken stattgefunden habe, nicht mehr die Stars die Bühne, sondern die des grünen Rasens zögen die Zuschauer in ihren Bann: »Noch vor ein paar Jahren galt die Beschäftigung von Fußball für einen Literaten noch als degradierend. Die verrohte Jugend, die verflachte Zeit, das geistlose, inhaltsleere Pöbelspiel – das war das Urteil! Unter hoher und höchster Literatur tat man es nicht, und kein Schriftsteller hätte sich – selbst, wenn es ihn interessiert hätte – bei einem Fußballspiel sehen lassen. Heute ist das anders geworden. Bei den großen Kämpfen bemerkt man unter anderen nicht bloß die prominenten Schauspieler, nein, auch bildende Künstler, Gelehrte und Schriftsteller.«
Im Zusammenhang dieses Wertewandels wird noch darauf hingewiesen, Alfred Polgar, »Wiener Meister feinsten geistsprühenden Stils«, habe den Meisterschwimmer Arne Borg sogar mit einem Essay gewürdigt. Auch wenn manche Schriftsteller noch nicht ein Offside von einem Corner unterscheiden könnten, sei dies »kein so großes Malheur«, »wir finden in der Tatsache, dass Literaten über Fußball schreiben, ein gutes, wichtiges Zeichen der Zeit«: »Wir sehen daraus, dass die Literaten eingesehen haben, dass es kein so absolutes Unglück bedeutet, wenn sich die Jugend zum großen Teil vom Theater abgewandt, dem Sport ergeben hat. Vielleicht ist auch zum großen Teil das Theater dran schuld, dass die Jugend nicht so zu fesseln vermochte und versandet ist. ›Welches Theaterstück‹, so schreibt Polgar ungefähr, ›vermag so zu erregen, so zu packen, wie die Sekunden, die Arne Borg über 100 m nicht gebraucht hat?‹ Wie gesagt, vielleicht ist das Theater selbst dran schuld.«
Kein Geringerer als der Romancier Robert Musil beschreibt 1930 in seinem Jahrhundertwerk Der Mann ohne Eigenschaften den Paradigmenwechsel in der öffentlichen Wahrnehmung der Sportler und zieht vier Jahre nach Polgars Feuilleton ein erstes Fazit: »Es hatte damals schon die Zeit begonnen, wo man von den Genies des Fußballrasens oder des Boxrings zu sprechen anhub, aber auf mindestens zehn geniale Entdecker, Tenöre oder Schriftsteller entfiel in den Zeitungsberichten noch nicht mehr als höchstens ein genialer Centrehalf oder großer Taktiker des Tennissports. (…) Das hat wohl gewiss zeitlich seine Berechtigung, denn es ist noch gar nicht lange her, dass man sich unter einem bewunderungswürdigen männlichen Geist ein Wesen vorgestellt hat, dessen Mut sittlicher Mut, dessen Kraft die Kraft einer Überzeugung, dessen Festigkeit die des Herzens und der Tugend gewesen ist, das Schnelligkeit für etwas Knabenhaftes, Finten für etwas Unerlaubtes, Beweglichkeit und Schwung für etwas der Würde Zuwiderlaufendes gehalten hat. Zum Schluss ist dieses Wesen allerdings nicht mehr lebendig, sondern nur noch in den Lehrkörpern von Gymnasien und in allerhand schriftlichen Äußerungen vorgekommen, und das Leben musste sich ein neues Bild der Männlichkeit suchen.«11
Moderner Fußball
Hugo Meisl setzt um, wovon Musil schreibt. Er kreiert »Genies des Fußballrasens«, avanciert zum Erfinder des modernen Fußballs und schafft mit weitblickender Kompetenz das »Wunderteam«, das am Beginn der 1930er Jahre als Inbegriff eines attraktiven und intelligenten Fußballs gilt.
Den Auftakt bildet der 5:0-Sieg gegen Schottland am 16. Mai 1931 in Wien. Die Schotten werden gemeinhin als Lehrmeister des kontinentaleuropäischen Spiels angesehen. Der Kantersieg gegen sie ist nicht nur die »Geburtsstunde des Wunderteams«, sondern auch eines von Rundfunkkommentator Schmieger »gesungenen wunderbaren Ohrwurms: ›Schall zu Vogl, Vogl zu Schall – Tor!‹«12 Zischek erzielte zwei Treffer, Sindelar, Schall und Vogl je einen.
In den Jahren des »Wunderteams« ist das Österreich dem deutschen Nachbarn auf dem Fußballfeld klar überlegen. Der Führung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist der Wiener Fußball ein Dorn im Auge, weil hier Profis vor den Ball treten. Für den DFB-Vorsitzenden Felix Linnemann ist nach Rudolf Oswalds Studie »Fußball-Volksgemeinschaft« der Profifußball »ein untrügliches Zeichen des Niederganges eines Volkes«. Schon Symptome, die auf einen »Übergangsprozeß (…) zum Berufssport« hinweisen, seien »mit allen Kräften (…) zu bekämpfen« und Fußballer, so Linnemann 1928, die aus »anderen Gründen als sportlichen, moralischen oder beruflichen Gründen (…) Vereinswechsel« vorhaben, seien »verächtlich und aus allen Organisationen für Leibesübungen auszuschließen«.13
Auf einer Vorstandssitzung in Hannover im Februar 1925 verabschiedet der DFB sogar ein Verbot von Spielen gegen ausländische Profimannschaften, das sich vornehmlich gegen die mitteleuropäischen Länder Österreich, Tschechoslowakei und Ungarn richtet und erst im Februar 1930 aufgehoben wird. Zwischenzeitlich hat das Verbot dazu geführt, die Leistungsstärke des deutschen Fußballs spürbar zu schwächen. 1931 kassiert die von Otto Nerz trainierte deutsche Nationalelf gegen Österreich zwei derbe Niederlagen. In Berlin siegt das »Wunderteam« mit 6:0, in Wien mit 5:0.
Die internationale Bewunderung des »Wunderteams« wird neben dem 5:0 gegen die Schotten aber vor allem durch eine Niederlage geschürt. Über das »Jahrhundertspiel« gegen England am 7. Dezember 1932 in London schreiben Andreas und Wolfgang Hafer in ihrer Hugo-Meisl-Biografie: »Das klein und unbedeutend gewordene Österreich, das nach dem Ersten Weltkrieg so wenig eigene Identität empfand, dass es sich am liebsten an Deutschland angeschlossen hätte, mehr und mehr durch wirtschaftliche Krisen und politische Konfrontationen zerrissen, fand zu sich selbst durch den Sport: Die Erfolge des Wunderteams ließen bei den Österreichern plötzlich einen zuvor unbekannten Nationalstolz erblühen, der mit dem legendären Spiel gegen England Ende 1932 fast hysterische Züge annahm: Tausende von Österreichern reisten, teilweise sogar zu Fuß, dekoriert mit einer rot-weiß-roten Kokarde, nach London, die Abreise der österreichischen Mannschaft wurde zum Massenspektakel, das Spiel selbst wurde öffentlich per Lautsprecher übertragen, Fabriken und Geschäfte ließen während des Matches die Arbeit ruhen, sogar das Parlament unterbrach während des Spiels seine Sitzung. Zwar wurde das Spiel mit 3:4 verloren, die Wiener feierten die Niederlage wie einen Sieg, Spiel und Team wurden sofort zum Mythos, und als die Mannschaft heimkehrte, war ganz Wien aus dem Häuschen.«14
Das Sport-Tagblatt hat Max Johann Leuthe nach London geschickt. Der Sonderberichterstatter lässt die Fußballinteressierten in Österreich wissen, was er von der W-Formation hält, mit der die Engländer zum Sieg gekommen sind: »Die Engländer mussten froh sein, dass sie in der letzten Viertelstunde von den Österreichern nicht völlig über den Haufen gerannt wurden. Was unsere Stürmer in diesen Kampfphasen zeigten, war ausreichend, die Ansichten über die W-Formation zu demontieren (…). Die W-Formation ist Punkteschinderei in Reinkultur. Der englische Fußballsport kann nur dann gerettet werden, wenn er die W-Formation, dieses System für Minderbemittelte, so rasch wie möglich aufgibt!«15
Für Johann Skocek und Wolfgang Weisgram hat das in London verlorene Match nichts von seiner Magie verloren, es ist für die beiden Autoren die »einzige österreichische Niederlage, die als Sieg in die Geschichte eingegangen ist«.16
Die tschechischen Wurzeln des Wiener Fußballs
Liest man heute die Analysen zur Spielweise des »Wunderteams«, kommt einem die Philosophie des FC Barcelona in den Sinn. »Die Wiener Schule«, so Andreas und Wolfgang Hafer, »war also charakterisiert durch perfekte Ballbeherrschung, schnelles Kurzpassspiel und eine Spielweise ohne Körpereinsatz.«17 Die beiden Autoren, Enkelkinder des legendären Bundeskapitäns, der es liebte, im Stadion mit Gehstock und Melone aufzutreten, betonen in ihrer Darstellung der Wiener Fußballkultur, dass viele Wiener Spitzenfußballer tschechische Wurzeln hatten, »auch wenn sie in Wien aufgewachsen waren; hier sei nur an Spieler wie Sindelar, Sesta und Smistik erinnert. Der Wiener Fußball war auch ein Immigrantensport. Für die tschechischstämmigen Jugendlichen in den Arbeitervierteln, sozial wie ethnisch deklassiert, bot sich mit dem Fußball eine doppelte Aufstiegschance: soziale Anerkennung und ethnische Integration. (…) Eine weitere Überlegung gilt der Rolle des Judentums in Wien vor 1938; sein Einfluss auf die Alltagskultur Wiens kann gar nicht überschätzt werden. Hierzu gehörte die Kaffeehauskultur ebenso wie die Freude am intellektuellen Diskurs, die Bereitschaft zum Experimentieren und eine allgegenwärtige wache Intelligenz. Und noch ein letzter Faktor, der auch und gerade im Wiener Fußball nicht ohne Wirkung geblieben sein kann: Wien war die Stadt der Musik. Immer wieder wird dem Wiener Fußball eine zauberhafte Beschwingtheit attestiert, und nicht zufällig nennt der schwedische Sportjournalist Tore Nilsson seine Darstellung über das Wunderteam ›laget som spelade fotboll i valstakt‹ übersetzt also: Die Mannschaft, die im Walzertakt spielte. (…) Und die Franzosen sprachen von ›Künstlern des runden Leders‹ und verglichen den österreichischen Fußball sogar mit der Musik Mozarts.«18
In dieses Bild fügt sich, dass Meisl gern mit einem Dirigentenstab dargestellt wird und in Kaffeehäusern die Pressevertreter wissen lässt, was er von ihnen hält: Sie seien »Schmieranskis«. Meisl nimmt die Huldigungen der Journalisten aber auch gern an, gilt er doch als Ersatzkaiser, der in einem Ringcafé täglich vor Journalisten Hof hält.
Sindelar, das erste Fußballgenie
Matthias Sindelar, der prominenteste Spieler im »Wunderteam«, avanciert in den 1930er Jahren nicht nur zum Star der Medien, er wird auch als Werbeträger für unterschiedlichste Produkte eingesetzt. »Sindelar, der beste Spieler der Welt, ist glücklicher Besitzer der wertvollen Alpina-Gruen-Pentagon-Uhr«, »Sindelar, der Caruso des Fußballsports trägt den eleganten Ceschka-Hut!«, »Sindelar: Wenn jedes Bummerl so sitzen möchte wie der Rekord-Anzug…« und »Der Mantel, der Wien begeistern wird: ›Sindelar-Ulster‹, ein Wurf unserer Werkstätte, treffsicher wie Sindelars Schuß!«, lauten die Werbeslogans.19
Im österreichischen Wunderteam spielt neben dem Genie Sindelar noch ein anderer Wiener Tscheche: Josef »Pepi« Bican. Dieser stets zu Späßen aufgelegte Stürmer wächst in derselben Straße wie Sindelar in Wien-Favoriten auf, Bicans Vater war nach Wien gekommen, um Arbeit zu finden. Bican, 1913 in Wien geboren, schafft bereits mit 17 Jahren den Sprung in die 1. Mannschaft von Rapid. Wenn er gute Laune hat, lässt er in einem Taxi seinen Hut und Mantel zum Stadion bringen und folgt selbst im zweiten Taxi. Bican ist ein Wanderer zwischen Österreich und Tschechien, seine Ferien verbringt er in dem Dorf Sedlice, in dem seine Großeltern in Armut leben. Roman Horak hat in einer Rede zu Bicans 95. Geburtstag am 28. November 1998 vor 100 Tschechen und Österreichern auf dem Prager Vyšehrader Friedhof die Verdienste dieses Ausnahmekönners gewürdigt, der als aktiver Fußballer in einem Atemzug mit Matthias Sindelar genannt wurde. Für Horak ist Bican eine Brücken bildende Figur zwischen zwei unterschiedlichen Welten, der von Rapid Wien und Slavia Prag: »Wie nur wenige Fußballer – der Wunderteamspieler Karl Sesta ist noch so ein Beispiel – hat Josef Bican für die österreichische und die tschechische Nationalmannschaft gespielt: in 19 Länderspielen trug er das österreichische Trikot, in 14 das tschechische. 1934, bei der unglücklichen Weltmeisterschaftsendrunde in Italien, spielte er neben Sindelar im österreichischen Nationalteam, ab 1938 in der Mannschaft der Tschechoslowakei. Zwischen Prag und Wien – so könnte man Bicans Weg beschreiben. Als Fußballer steht er nicht zuletzt in der Reihe der großen Migranten, die dem Wiener Fußball ihren Stempel aufdrückten. Es ist wohl kein Zufall, dass die beiden ersten Schlüsselfiguren des Wiener Donaufußballs – Josef Uridil und Matthias Sindelar – tschechischen Hintergrund hatten. Man kann ihnen durchaus Pepi Bican, den ich hier nicht für Wien vereinnahmen will, an die Seite stellen.«20
Zur WM 1934 im faschistischen Italien fährt ein »Wunderteam«, das seinen Zenit bereits überschritten hat. Die Österreicher treffen im Semifinale auf den Gastgeber. Sie sind gewarnt. Ivan Eklind, der schwedische Schiedsrichter, hatte mit Benito Mussolini diniert. Eklind gibt ein irreguläres Tor und ebnet damit den Italienern den Weg ins Finale. Über 60 Jahre nach der Endrunde in Italien erinnert Bican sich an den skandalösen Schiedsrichter: »Als eine Flanke von Karl Zischek kam, konnte der alleine auf das italienische Tor laufen. Da hat der Schiedsrichter, der gerade dort stand, den Ball absichtlich weggeköpft. Unglaublich!«21 Sindelar wird im Strafraum von den Beinen geholt, doch der Pfiff des Schiedsrichters bleibt aus. Für Hugo Meisl ist klar, dass seiner Mannschaft durch ein irreguläres Tor der Einzug ins Finale verwehrt worden war. Eklind wird seine »Leistung« honoriert, er darf auch das Endspiel pfeifen. Und wieder pfeift er für Italien, lässt äußerst grobe Fouls ungeahndet, doch erst in der Verlängerung verliert die Tschechoslowakei das Finale der 2. Fußball-Weltmeisterschaft.
Stars wie Sindelar und Bican beobachtet der junge Happel genau und erprobt ihre Tricks mit einem alten Tennisball oder einem »Fetzenlaberl« auf der Straße und in den Parks. Er wächst in dem Selbstverständnis auf, dass der Wiener Fußball der beste Europas ist. Er verfolgt bereits als Kind die Ergebnisse der nationalen und internationalen Spiele, er ist von jungen Jahren an in einem vertrauten Kontakt mit dem Spitzenfußball.
Ersatzvater Nitsch
Als Happel 1970 mit Feyenoord als Trainer die Bühne des internationalen Fußballs betritt, ist es für ihn eine Selbstverständlichkeit, mit seiner Mannschaft zu den besten Teams Europas zu gehören. Eine reiche Tradition stärkt ihm den Rücken. Happel tritt stets souverän auf, bei ihm hat man nie den Eindruck, dass er sich emporgearbeitet hat. Er knüpft gleichsam en passant an die Leistungen des »Wunderteams« an. Seine Vorbilder haben ihm Woche für Woche ein lebendiges Beispiel dafür gegeben, dass Fußball mit Eleganz und Einfallsreichtum zu tun hat, mit Kabinettstückerln und heiter-sarkastischen Kommentaren. Der Spielwitz findet bei Happel nach dem Match seine Fortsetzung in einer originellen Sprache. Die Sprache ist für ihn nichts Vorgegebenes, in das man sich einzufinden habe, die Sprache muss mit Esprit erfunden werden, und auch hier ist er ein Zauberer, der mit Pointen wie mit Bällen jongliert. Es geht immer darum, den Gegner und die Journalisten zu überlisten, sie in die Fallen zu locken und selbst ins Schwarze zu treffen. Man kann sich bei Happel gut vorstellen, dass er sich über eine treffsichere Replik ebenso sehr freut wie als Spieler über einen perfekten 40-Meter-Pass, der die gegnerische Verteidigung aufschneidet. Happel kennt die Materie, er bewegt sich leichtfüßig, zur Schmach für die Gegner kommt noch sein Wiener Schmäh als krönender Abschluss hinzu.
Sein eigenes großes fußballerisches Talent wird entdeckt, als er zwölf Jahre alt ist. Bei einem Probetraining im Sommer 1938 fällt er Leopold Nitsch, Rapids Jugendtrainer, auf und wird als erster von ungefähr 100 Buben ausgewählt. Nur sechs Nachwuchsspieler werden aufgenommen, darunter sind auch die beiden Körner-Brüder Alfred und Robert.
Zu diesem Zeitpunkt hat Happel schon eine Menge Erfahrung als Straßenfußballer, mehr als acht Jahre hat er bereits sich dem Fußball gewidmet, bevor er in die Jugendmannschaft von Rapid geholt wird. In Nitsch findet er einen Ersatzvater, der an ihn glaubt und ihn fördert. Happel hat wahrscheinlich öfter die Schule gewechselt. Denn anders ist es für den Kulturwissenschaftler Gerhard Urbanek nicht zu erklären, dass in dessen »Schulbeschreibungsbogen der Hauptschule Afritschgasse in Wien-Donaustadt in Kagran vermerkt war, dass die spätere Fußballikone in Turnen immer nur die Note 4 hatte. Er hatte stets ›den Turnunterricht wegen angeblichen Fußballtrainings‹ geschwänzt – und der Weg nach Hütteldorf war weit.«22
Fußballer für den »Anschluss«
Für den 13. März 1938 ist eine Volksabstimmung über die Unabhängigkeit Österreichs geplant. Drei Tage vor diesem Termin lässt Hitler die Volksabstimmung absetzen und Pläne für den Einmarsch der deutschen Soldaten in Österreich ausarbeiten.
Im »Berchtesgardener Abkommen« vom 12. Februar 1938 hat Bundeskanzler Schuschnigg Hitlers massivem Druck nachgegeben. Die österreichische Außenpolitik wird bereits von Hitler kontrolliert. Am 12. März 1938 wird der »Anschluss« Österreichs in die Tat umgesetzt. Unter dem Jubel großer Teile der österreichischen Bevölkerung marschieren die deutschen Soldaten in den Morgenstunden ein und machen Österreich kampflos zur »Ostmark«. Deutsche und österreichische Zollbeamte schaffen mit vereinten Kräften den Grenzbalken aus dem Weg. Im Triumphzug fährt Hitler über Linz nach Wien. Am späten Vormittag des 15. März 1938 erklärt Hitler in einer »Vollzugsmeldung vor der deutschen Geschichte« vom Balkon der Neuen Hofburg der jubelnden und dicht gedrängten Menge von 250.000 Menschen auf dem Heldenplatz: »Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reiches melde ich vor der Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich! Sieg Heil!«
Reichstrainer Sepp Herberger will, dass Bican wie Sindelar in der neu zu bildenden »reichsdeutschen« Auswahl spielen. Beide Spielerpersönlichkeiten lehnen ab, sie haben ihre internationale Karriere schon beendet. Bican spielte von 1933 bis 1936 (19 Spiele, 14 Tore) in der Nationalmannschaft, Sindelar von 1928 bis 1937 (43 Spiele, 26 Tore). Nach Wolfgang Maderthaner hat der technisch brillante Sindelar die Einladungen zu den »Reichslehrgängen« nicht einmal ignoriert. In Der »papierene« Tänzer. Matthias Sindelar, ein Wiener Fußballmythos zitiert Maderthaner die abfällige Äußerung des Reichstrainers Sepp Herberger über den Stürmer: »Das soll ein Fußballer sein?«23
Der Schüler Happel lehnt den »Anschluss« ab. Er registriert im Frühjahr 1938 die politischen Veränderungen genau und spürt im alltäglichen Leben die Beklemmung und die Angst, die sich in seiner Familie breitzumachen beginnen. Er hat nichts für den militärischen Drill und die preußischen Ideale übrig, die mit Hitlers Machtübernahme in Österreich Einzug halten.
Die dramatischen politischen Entwicklungen betrachtet Happel aus der Perspektive der tschechischen Minderheit. Karl Brousek zeigt in seiner Analyse ›Die falschen Behm‹ – Vom Widerstand der Wiener Tschechen, welche Folgen der »Anschluss« für die tschechische Bevölkerungsgruppe hatte: »Für die in Wien lebenden Tschechen – zu einem Großteil Arbeiter und kleine Gewerbetreibende – bedeutete der ›Umsturz‹ eine radikale Einengung ihres gesellschaftlichen Lebens. Sozialdemokratische und kommunistische Vereine wurden aufgelöst. (…) Den ›Anschluss‹ Österreichs an das Deutsche Reich erlebten die Wiener Tschechen als einen Schock. Kurz vor dem Einmarsch gab es noch Demonstrationen, an denen sich viele Wiener Tschechen beteiligten. (…) Nach dem ›Anschluss‹ 1938 waren die Erhaltung der Schulen (…) und die Weiterexistenz der tschechischen Presseorgane die Prioritäten der Minderheitenpolitik. Ein Gefühl des Unbehagens aufgrund der neuen politischen Machthaber und die Befürchtung, dass der Spielraum für die Minderheit noch enger und restriktiver werden würde, erfasste den Großteil der Wiener Tschechen. Bei einigen machte sich zudem eine unterschwellige Angst vor einer möglichen Aussiedlung breit. (…) Unmittelbar nach dem ›Anschluss‹ wurde das tschechoslowakische Generalkonsulat in Wien von tschechoslowakischen Staatsangehörigen umlagert, unter ihnen auch viele Juden. Sie baten um Schutz und Hilfe für die Heimkehr.«24
Ein Zusammenleben von Menschen aus verschiedenen Nationen und Kulturen lehnte Hitler ab. Im Rückblick auf seine Zeit in Wien fand Hitler »wenig Gefallen an der Multikulturalität der Donaumetropole«25, wie Brousek erläutert, der in dem Zusammenhang auf folgende Passage in Mein Kampf verweist: »Widerwärtig war mir das Rassenkonglomerat, das die Reichshauptstadt zeigte, widerwärtig dieses ganze Völkergemisch von Tschechen, Polen, Ungarn, Ruthenen, Serben und Kroaten usw., zwischen allem aber als ewiger Spaltpilz der Menschheit – Juden und wieder Juden. Mir erschien diese Riesenstadt als Verkörperung der ›Blutschande‹.«26
Drei Wochen nach dem »Anschluss«, am 3. April 1938, findet in Wien ein »Versöhnungsspiel« statt, in dem sich die »Ostmark« mit der reichsdeutschen Auswahl misst. Sindelar erzielt nach der Pause die hochverdiente Führung, und sein Freund »Schasti« Sesta hämmert aus 45 Metern einen Freistoß zum 2:0-Sieg ins Netz.
Die Volksabstimmung wird vier Wochen nach der »Wiedervereinigung Österreichs mit dem deutschen Reich« nachgeholt. Auf den Stimmzetteln, die am 10. April 1938 ausliegen, ist der »Ja«-Kreis doppelt so groß wie der »Nein«-Kreis. Prominente Schauspielerinnen und Schauspieler des Burgtheaters werben für den »Anschluss«, unter ihnen Paula Wessely und Attila Hörbiger, der seine Entscheidung im ersten Aprilheft der Wiener Bühne mit den Worten begründet: »Wir Künstler sind froh und stolz, am neuen großdeutschen Werk mitarbeiten zu können, und werden uns am 10. April einmütig zu unserem Führer bekennen!«
Rapid kommt bei der Gleichschaltung mit der NS-Ideologie eine große Bedeutung zu. Der Umbau auf der Vereins- und Verbandsebene geht, wie Jakob Rosenberg und Georg Spitaler in ihrer Studie Grün-Weiß unterm Hakenkreuz ausführen, schnell voran: »In der Werbung zum ›Ja‹ für die Volksabstimmung am 10. April wurden in den Zeitungen auch zustimmende Botschaften prominenter Sportler und Sportlerinnen abgedruckt. Darunter war ›die letzte Auswahlelf Deutschösterreichs‹. Im Fußball-Sonntag wurden die Unterschriften der Fußballteamspieler (›Wir und mit uns 600.000 deutsche Fußballer stimmen mit Ja!‹) abgedruckt, darunter die Rapid-Spieler Franz Binder, Hans Pesser, Stefan Skoumal und Franz Wagner.« 27
Tod eines Fußballspielers
Am 23. Januar 1939 wird der 36-jährige Sindelar in der Wiener Innenstadt, in der Annagasse 3, tot aufgefunden. Die gleichgeschaltete Polizei und die Gutachten der gleichgeschalteten Sachverständigen kommen zum Ergebnis, der Fußballstar sei Opfer einer Kohlenoxydgasvergiftung. Anderen Berichten zufolge soll das Ofenrohr nicht defekt gewesen sein. Sindelars Freundin Camilla Castagnola, eine Italienerin jüdischer Herkunft und katholischer Konfession, stirbt einen Tag nach Sindelar, sie kommt nicht mehr zu Bewusstsein.
Sindelar galt in den 1930er Jahren als bester Fußballer der Welt. Als Kind hat Happel Fußballbilder gesammelt, die in den Schokoladenpackungen in Staniolpapier eingewickelt waren. Er hat sie, wie er Heinz Prüller erzählte, »schön und sauber« eingeklebt und sich mit einem weißen Fotostift Autogramme aller Fußballer geholt. Von Sindelar hatte er sogar 20 Fotos. Als der Krieg begann, musste er sie alle eintauschen, um den Hunger zu stillen.
Der Tod des einstigen Idols ist für Happel der Selbstmord eines in die Enge getriebenen Menschen, dessen Freundin von den Nazis enteignet und verfolgt wurde: »Seine Freundin, eine Jüdin, hatte ein Kaffeehaus. Alles hat man ihr weggenommen – der Hitler war ja schon da. Worauf die beiden beschließen, sich in der Wohnung anzutrinken – und dann das Gas aufzudrehen. Als Hilfe kommt, ist Sindelar schon tot. Seine Freundin atmete noch, aber weil sie Jüdin war, hat man sie sterben lassen. Das weiß ich von sehr authentischen Leuten.«28
Alfred Polgar schreibt in seinem Nachruf »Abschied von Sindelar«, der zwei Tage nach dem Tod des Fußballspielers auf der dritten Seite der Pariser Tageszeitung (25.1.1939) erscheint: »Er spielte Fußball, wie ein Meister Schach spielt: mit weiter gedanklicher Konzeption, Züge und Gegenzüge vorausberechnend, unter den Varianten stets die aussichtsreichste wählend, ein Fallensteller und Überrumpler ohnegleichen, unerschöpflich im Erfinden von Scheinangriffen, denen, nach der dem Gegner listig abgeluchsten Parade, erst der rechte und dann der unwiderstehliche Angriff folgte. Er hatte sozusagen Geist in den Beinen, es fiel ihnen, im Laufen, eine Menge Überraschendes, Plötzliches ein, und Sindelars Schuss ins Tor traf wie eine glänzende Pointe, von der aus erst der meisterliche Aufbau der Geschichte, deren Krönung sie bildete, recht zu verstehen und zu würdigen war.«
Der aus einer Prager jüdischen Familie stammende Friedrich Torberg veröffentlicht das Gedicht Auf den Tod eines Fußballspielers, das mit folgendem Vers beginnt und schließt: »Er war ein Kind aus Favoriten / und hieß Matthias Sindelar«. Auch Torberg vertritt in seinem Gedicht die Ansicht, dass Sindelar sich umgebracht hat – in einem letzten Protest gegen das NS-Regime: »Es jubelte die Hohe Warte, / der Prater und das Stadion, / wenn er den Gegner lächelnd narrte / und zog ihm flinken Laufs davon, / bis eines Tags ein andrer Gegner / ihm jählings in die Quere trat, / ein fremd und furchtbar überlegner, / vor dem’s nicht Regel gab noch Rat. / Von einem einz’gen, harten Tritte / fand sich der Spieler Sindelar / verstoßen aus des Planes Mitte, / weil das die neue Ordnung war. / (…) Er war gewohnt zu kombinieren, / und kombinierte manchen Tag. / Sein Überblick ließ ihn erspüren, / dass seine Chance im Gashahn lag.«29
Ungefähr 15.000 Menschen folgen Sindelar am Sonntag, dem 28. Januar, auf seinem letzten Weg. Seine Mutter wird von Max Reiterer und Rudo Wszolek gestützt. Den Begräbniszug führen die Nazis an, auf ihren Kränzen sind Schleifen mit dem Hakenkreuz angebracht. Der SA-Brigardenführer Kozich, der SS-Sturmbannführer Rinner und der HJler Otto Naglic erheben am Grab auf dem Wiener Zentralfriedhof die rechte Hand zum »Deutschen Gruß«.
Seit Sindelars Tod reißen die Debatten über das Ende dieses begnadeten Fußballers nicht ab. In seiner 2005 erschienenen Studie Massen, Mentalitäten, Männlichkeit. Fußballkulturen in Wien vertritt Matthias Marschik die These, eine Rauchvergiftung sei aufgrund eines schadhaften Ofens die Ursache für Sindelars Tod und der seiner Partnerin gewesen, »aber die Gerüchte über Mord, Selbstmord und Doppelselbstmord sind bis heute nicht verstummt, und unmittelbar nach dem Ereignis setzte die Mythologisierung des fußballerischen ›Wienertums‹ ein. In der Folge wurde jedes Spiel zwischen Wien und dem ›Altreich‹ bis weit in die Kriegsjahre hinein zu einer hitzigen Auseinandersetzung um die fußballerische Vorherrschaft und zu einer Manifestation wienerischen Aufbegehrens. Gerade das Wiener Publikum wurde immer weiter radikalisiert, und es kam ständig zu Raufhändel und antipreußischen Ausschreitungen, die nicht selten in vandalistischen Akten endeten. Eine sportliche Versöhnung zwischen Admira und Schalke sollte im November 1940 im Wiener Stadion zur Deeskalation beitragen, doch nachdem der Schiedsrichter zwei reguläre Admira-Treffer aberkannte, erhob sich der ›Volkszorn‹. Tobende Anhänger verprügelten die Schalker Spieler, zertrümmerten die Fensterscheiben des Mannschaftsbusses, zerstachen die Reifen des Wagens von Gauleiter Schirach und lieferten sich stundenlange Schlägereien mit der Polizei. (…) Dies führte dazu, dass nun auch die im ›Altreich‹ gastierenden Teams verbal und auch tätlich angegriffen wurden (…).«30
Happels Abneigung
Als ich Happel im Oktober 1991 zum NS-Regime befrage, spricht er in sich gekehrt über diese Zeit: »Wie der Hitler da kommen ist, war ich 13 Jahre, wir haben in einem Zinshaus gewohnt, in der Vorstadt, in dem Haus waren 50 Parteien, von der Monarchie noch her, meine Großmutter ist eine Tschechin gewesen, von den 50 Parteien waren 25 Parteien Tschechen, auf jeder Etage hast du eine Wasserleitung draußen gehabt und vier Klos. Wenn die zwei Großmütter bei der Wasserleitung standen sind, haben sie nicht Deutsch gesprochen, sondern Tschechisch. Und dann kommt die bestimmte Diktatur von Hitler, in einer gewissen Perfektion, die Großmutter hat selber sieben Kinder gehabt, vier Mädchen und drei Buben, und der Älteste war ein Super-Nazi, die ganze Familie hat eine Angst gehabt vor dem Mann, der ist überall einmarschiert, u. a. in der Tschechei, da können wir nicht zufrieden sein. Wie der Krieg begonnen hat, der Überfall, dann hat der Hitler Russland angegriffen, der Nichtangriffspakt, hat man alles gewusst, in Wien war die Einstellung so, du kannst mit dem Regime nicht einverstanden sein, aber du kannst nichts machen. Ich bin Ledergalantrist gewesen, das war mein Beruf, du bist da gekommen in die Lehrwerkstätte, wo zwölf solche Jungens waren, da hast du einen Meister gehabt, und du hast müssen, wenn’st reinkommst, Heil Hitler sagen, du gehst zu deinem Arbeitsplatz und nimmst die Schürze, dreimal davor wieder Heil Hitler, ich war auf das nicht eingestellt, ich bin auch nicht interessiert gewesen an der Hitler-Jugend, aber ich habe gewöhnlich hingehen müssen, weil sonst hätte ich nicht bei Rapid Wien in der Jugendmannschaft spielen können, das war eine Verpflichtung, ich habe kein Interesse gehabt, dass ich dreimal da hingehe und dass ich singe die Lieder. Ich war nicht für das Regime, aber was hast machen wollen, du kannst nichts machen, dann war die Lehrzeit, dann bist du Geselle gewesen, dann bist du gleich im Arbeitsdienst, statt neun Monate war ich drei Monate beim Arbeitsdienst, das war damals schon im Jahr 42/43, dann waren in Russland schon die Rückmärsche durch den strengen Winter im 41er Jahr, der Mann wollte die ganze Welt beherrschen.«
Happel wehrt sich gegen den Drill, der durch das NS-Regime seine Jugend bestimmt. Er will bereits in jungen Jahren ein freier Mensch sein, sich niemandem unterordnen müssen. Dies zeigen auch die Erinnerungen seines Mannschaftskameraden Alfred Körner, der mit seinem um zwei Jahre älteren Bruder Robert zur gleichen Zeit wie Happel zu Rapid kam. Mit den Körner-Brüdern war Happel in tiefer Freundschaft verbunden, sie waren exzellente Spieler der berühmten Rapid-Mannschaft in den 1940er und 1950er Jahren. Körner II war knapp drei Monate jünger als Happel.
Im von Harry Windisch herausgegebenen Happel-Erinnerungsbuch hat Alfred Körner die schwierige Lage der Nachwuchsspieler von Rapid während der NS-Zeit folgendermaßen dargestellt: »Mit der NS-Politik gab es damals immer wieder Probleme, von denen vor allem unser Freund Happel betroffen war. Als HJ-Bann-507-Jugendspieler mussten wir gelegentlich auch an Heimabenden teilnehmen, wobei der zuständige HJ-Führer in der damals üblichen zackigen Form: ›Ein Lied‹ kommandierte. Happel wollte aber nicht singen und hat so lange getratscht und gemeutert, bis er schließlich rausgeschmissen wurde. Das hatte natürlich Folgen, denn wir Jugendspieler brauchten damals immer wieder einen Stempel von der NS-Partei in unseren Spielerpässen, um an der Meisterschaft teilnehmen zu können. Dem Ernstl wurde der Stempel nach diesem Zwischenfall verweigert, und so musste unser Trainer Nitsch einen Canossagang in das damalige Parteilokal in der Diesterweggasse antreten, um mit Hilfe von Interventionen die Sache wieder auszubügeln. Ein anderes Mal hatten wir wieder Probleme mit den damals für Jugendspieler obligaten HJ-Uniformen. Wir mussten im Zuge der sogenannten Gau-Meisterschaften 1939 mit der Rapid-Jugend gegen eine Stadtauswahl von Graz in Wiener Neustadt antreten. Wir gewannen zwar mit 2:1, verloren aber auf dem grünen – oder vielmehr braunen – Tisch mit 0:3, weil wir im Gegensatz zu den Grazern nicht in den vorschriftsmäßigen HJ-Uniformen erschienen waren.«31
Rapid besiegt Schalke
Der »Anschluss« bedeutet, dass Österreichs Spitzenteams nun um die deutsche Fußballmeisterschaft mitspielen. Mit dem vom »Wunderteam« inspirierten Scheiberlspiel setzt sich Rapid gegen das kraftraubende Spiel der deutschen Mannschaften immer wieder durch. In der Saison 1940/41 bezwingt Rapid den Dresdner SC im Halbfinale der nun »großdeutschen« Meisterschaft in Beuthen mit 2:1. Happel und Alfred Körner sind bei dem Spiel »Ballschanis« (Balljungen). Zwei Jahre später stehen sie selbst in der 1. Mannschaft.
Im Finale trifft Rapid im Berliner Olympiastadion auf Schalke 04. Den »Knappen« winkt im Falle eines Sieges der Titel-Hattrick. Wenige Stunden vor dem Anpfiff am 22. Juni 1941 fällt die Wehrmacht in die Sowjetunion ein. Im Berliner Olympiastadion, in dem Adolf Hitler fünf Jahre zuvor die Olympischen Spiele 1936 eröffnete, werden Informationsblätter verteilt, wie Hardy Grüne in seinem Buch Glaube, Liebe, Schalke festhält, auf denen von einer »Meisterschaft wie im Frieden« und einem »friedlichen Alltag« die Rede ist.32
95.000 Zuschauer sind trotz einer Temperatur von 40 Grad ins Stadion gekommen, die meisten wollen Schalke 04 wie in den beiden vergangenen Jahren triumphieren sehen, als am 18. Juni 1939 Admira mit 9:0 vom Platz gefegt und ein Jahr später am 21. Juli 1940 der Dresdner SC mit 1:0 besiegt wurde. Schalke ist auch dieses Mal Favorit, doch Rapid Wien mit Franz »Bimbo« Binder war aus einem anderen Holz geschnitzt als zwei Jahre davor die Admira. Binder kündigt vor dem Spiel an: »Wir werden Wiens Fußballehre wiederherstellen.«33
In ihrer Analyse der sportlichen und politischen Ereignisse an jenem heißen Sommertag schreiben Wolfgang Maderthaner und Roman Horak, dass es bis kurz vor Spielbeginn nicht klar war, »ob das Berliner Endspiel um die deutsche Meisterschaft überhaupt würde stattfinden können. In der Stadt herrschte eine gewisse Unruhe und eine seltsam aufgeregte Stimmung, allerorten boten Zeitungsverkäufer lautstark diverse Extrablätter zum Einmarsch in die Sowjetunion an. Da Flugangriffe der Roten Armee befürchtet wurden, hatten die Machthaber rund um das Olympiastadion und auf dessen obersten Rängen Flakbatterien aufziehen lassen.«34
Alles sieht so gut für die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet aus. Die Schalker gehen bereits vor der Pause mit 2:0 in Führung. Als Hinz in der 58. Minute auf 3:0 erhöht, scheint das Finale entschieden zu sein. Doch dann gehen die Rapidler zum Angriff über, »Bimbo« Binder läuft zur Höchstform auf, steckt einen verschossenen Elfmeter weg. Innerhalb kürzester Zeit findet Rapid Wien zu seinem Spiel und schießt innerhalb von neun Minuten – zwischen der 62. und 71. Minute – vier Tore. Nach einem Tor von Schors zum 1:3 trifft Binder mit einem Freistoß zum 2:3, verwandelt einen Elfmeter zum Ausgleich und schießt wieder mit einem Freistoß das Siegestor. Die berühmte Rapid-Viertelstunde, die letzten 15 Minuten, war noch nicht einmal angebrochen. Zwar sind nach Rapids 4:3-Führung noch 19 Minuten zu spielen, aber Schalke kann den Wienern nichts mehr entgegensetzen.
Von der Presse wurde Schalke dafür gegeißelt, dass sie nicht während der Aufholjagd die Verteidigung verstärkt haben, mindestens zwei Mann hätten in die Verteidigung zurückbeordert werden müssen. Im Kicker (Nr. 25, 24.6.1941) stellt Friedbert Becker die nüchterne Frage: »Hat denn Schalke nichts von der ›Rapid-Viertelstunde‹ gehört? Man beharrt auf dem Angriffsspiel, sieben Mann vorne.« Für Schalke 04 wird ein bitteres Resümee gezogen: »Wie erst Schalke höchste Fußballkunst vorzauberte und dann im Augenblick eines scheinbar nahenden torreichen Triumphes unter den Blitzschlägen Rapids zusammenbrach.«
Das »Endspiel« wurde als »Blitzkrieg« gesehen, und das Reichssportblatt schloss seinen Bericht über das Spiel, wie Jakob Rosenberg und Georg Spitaler in ihrer Studie Grün-Weiß unterm Hakenkreuz darlegen, mit folgendem politischen Kommentar: »Daß wir im Sport einen Tag wie den 22. Juni, gerade den 22. Juni, erleben durften, das verdanken wir unserer stolzen Wehrmacht. So brandete auch das Sieg Heil, das vor dem denkwürdigen Spiel auf den Führer ausgebracht wurde, mit besonderer Stärke gen Himmel.«35
Die beiden Autoren zitieren auch die Überlegungen, die Reichssportführer Tschammer auf der Titelseite von NS-Sport (29.6.1941) eine Woche nach dem Finale veröffentlichte: »Ich glaube, dass es den meisten Besuchern dieses Spiels so gegangen sein wird wie mir: Wir standen doch ganz und gar unter dem Eindruck der politischen Ereignisse im Osten. Da war es uns allen ein Wunder, dass an einem solchen Tage in der Reichshauptstadt im strahlenden Sonnenschein 100.000 Deutsche ein so starkes und freudiges sportliches Erlebnis hatten. Ueber allem lag eine unerhörte Zuversicht, ein bedingungsloses, tiefes Vertrauen. Welch ein Beweis der deutschen Ruhe. (…) Wo immer Wettkämpfe an diesem denkwürdigen Sonntag waren, international und national, haben es unsere Kameraden beglückt erleben dürfen, dass unser Tun selbst unter den Vorzeichen des Kriegsbeginns gegen den Moloch Russland sinnvoll und berechtigt bleibt. So grüße ich Sie alle in der Heimatfront des Sports und fasse Ihre und meine Gefühle in dem einen Wunsche zusammen, dass der Herrgott den Feldherrn Adolf Hitler und seine nun im Kampfe gegen unseren Todfeind Bolschewismus stehende Wehrmacht segnen möge.«36
Der 16-jährige Happel war am Tag des Finales ins Ottakringer Bad gegangen, wo er sich auf die Wiese legte, um der Berichterstattung zu lauschen, die aus dem Lautsprecher des Freibads drang. Happel freute sich über den Sieg von Rapid und die Tore von Binder. Das Debakel der Admira wird mit dem famosen Sieg vergessen gemacht.
Der famose »Bimbo« Binder ist für Happel in seiner langen Laufbahn als Spieler und Trainer ein großes Idol geblieben. Als Kind hat er sich um ein Autogramm bei Binder angestellt, nach dem Krieg wird er bei Rapid und in der österreichischen Nationalmannschaft mit Binder zusammenspielen und ist darauf stolz. Viele Jahre später wird er über den Ausnahmekönner sagen: »Binder war als Fußballfachmann für mich der Größte!«37
Als Happel vom Freibad wieder zu Hause ist, ist das »Unternehmen Barbarossa«, der Überfall auf die Sowjetunion, bereits in Gang.