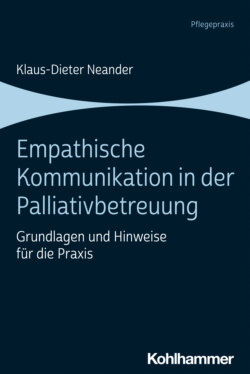Читать книгу Empathische Kommunikation in der Palliativbetreuung - Klaus-Dieter Neander - Страница 10
Vorwort
ОглавлениеDas Lied von der Uhr hat mich schon in Kindertagen fasziniert – ich verstand die Metapher wohl schon recht früh und war in der Lage, das Gedicht zu rezitieren, bevor ich andere zusammenhängende Sätze formulieren konnte. Die Uhr als Metapher des Lebens.
Ich begann meine Ausbildung zum Krankenpfleger 1975 in einem Kreiskrankenhaus. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mit Tod und Sterben nun »theoretisch« zu tun. Meine protestantische Mutter, die als »Gemeindehelferin« (heute nennt man diesen Beruf »Diakonin«) und »Krankenhausseelsorgerin« sehr engagiert tätig war, und meine Familie prägten mich insofern, als dass sie mich lehrten, dass Tod und Vergänglichkeit, Abschied nehmen müssen und Menschen zu verlieren zum »Leben« gehören würde, dass sie – egal was sie in ihrem Leben getan oder nicht getan haben – zum »himmlischen« Vater gehen würden, der sie unendlich liebe und dass dem Schmerz des Abschieds vom irdischen Leben der Trost einer »Zukünftigkeit« folgte. Ich hatte gelernt, die Orgel in unserer kleinen Gemeinde zu spielen, und so hatte ich die Möglichkeit, während unzähliger Beerdigungsfeiern nicht nur die evangelischen Lieder zu begleiten, sondern Menschen zu beobachten, die Abschied nehmen mussten: tief, vor Gram gebeugt, weinend, sich ein Taschentuch vor das Gesicht haltend, den Blick starr nach vorne gerichtet, keine Miene verziehend, sich gegenseitig stützend, manchmal streichelte eine Tochter ihre Mutter oder der Sohn nahm seinen Vater in die Arme. So standen sie alle an den offenen Grabstellen, in denen der Sarg verschwand und mit ihnen der Mensch, der in irgendeiner Weise zum Leben derer gehörte, die – wie man so sagt – zurückblieben. Ich war als Kind bei der ein oder anderen Beerdigung dabei gewesen… Ich kann mich aber nicht erinnern, dass mich die Zeremonie tief berührt hätte!
In der Krankenpflegeschule wurde das Thema – meiner Erinnerung nach – eher technisch besprochen: »Versorgung des toten Körpers!«. Als Schüler*innen mussten wir mit einem Kollegen bzw. einer Kollegin die Toten aus dem Badezimmer der Station holen, im Bett über die Flure des Krankenhauses schieben und sie dann in das hinter dem Krankenhaus gelegene Extrahaus bringen, in dem sie in einer Kühlbox gelagert wurden, bis das Beerdigungsinstitut den Leichnam abholte. Der Leichnam, den wir aus dem Badezimmer abholten, war von uns Pflegekräften vorher versorgt worden: Die Kinnlade wurde mit einer weißen, nassen Mullbinde »hochgewickelt«, damit der Mund nicht offen stand. In der Regel legten wir noch ein Handtuch unter den Kopf, damit dieser nicht »nach hinten« wegknickte. Die Haare wurden gekämmt, nicht selten fand ein »Totenwäsche« statt. So versorgt, wurden zwei Bettdecken über den Toten gebreitet, ein oder zwei Kopfkissen daraufgelegt, um den Patient*innen, die uns möglicherweise auf dem Flur oder im Fahrstuhl mit dem Bett sehen würden, zu suggerieren, wir würden lediglich ein durch eine Entlassung frei gewordenes Bett zur Reinigung in den Keller fahren. Wenn irgend möglich, sollte niemand erfahren, dass gerade ein Mensch verstorben war.
Wie gesagt, ich komme aus einer christlich geprägten Familie und einige andere Kolleg*innen, die sich in der Ausbildung befanden, auch, so dass wir einen »Hauskreis« gründeten, der sich mit dem Thema »Tod und Sterben« beschäftigen wollte. Ein Hauskreis, bei dem sich mehrere Menschen »in seinem Namen versammeln« und wo er mitten unter ihnen sein würde (Matthäus 18, 20), ist eine Institution, die besonders im christlich-pietistischen Umfeld dazu dient, gemeinsam die Bibel zu lesen, darüber zu reden, gemeinsam zu singen und zu beten. Der Hauskreis wird als Umsetzung der »Gemeinschaft der Heiligen« verstanden (»heilig« ist in diesem Sinne die Person, die sich in besonderer Weise Gott zugehörig weiß, z. B. indem sie sich ganz bewusst im Kreis Gleichgesinnter zu Gott bekennt, seine Schrift studiert und ihm dienen will).
Wir waren in diesem Hauskreis vielleicht fünf oder sechs Auszubildende, wir erlebten erstmalig auf den Stationen, dass jemand starb, wir waren »irgendwie« anwesend, allein gelassen, mit dem, was wir erlebten. Altgediente Kolleg*innen beeindruckten uns durch den schnoddrigen Umgang mit dem Tod (»Na, das wurde aber auch Zeit!«), mit dem Vokabular (»Machst du mal den Ex fertig!«), selten dadurch, dass sie wahrnahmen, wie uns junge Menschen diese Erfahrungen verunsicherten, dass wir es eklig fanden, wenn wir einen Leichnam waschen sollten oder seine Exkremente vom Hintern wischen mussten. Sie merkten nicht, dass wir eine Scheu davor hatten, den Toten zu berühren, der vor einer Stunde noch mit uns kommuniziert hatte; Profi-Pflegende und Ärzt*innen ließen uns in unserer Verwirrung zurück, wenn wir nach andauernder Reanimation einen Körper inmitten Kanülen und Intubationsbesteck, bei blinkendem Monitor und leise vor sich hin zischendem Beatmungsgerät betrachteten und irgendwie versuchten, das Geschehene einzuordnen. Niemand brachte uns bei, wie wir den Angehörigen, die vor der Eingangstür der Intensivstation bange warteten und – sobald wir das Reanimationszimmer verließen – ahnten, nein, spontan die Gewissheit hatten, dass ein Leben »verlöscht« war, begegnen sollten. Was sagt man den Hinterbliebenen, floskelhaft »herzliches Beileid« oder »wir konnten nichts mehr für ihn*sie tun«?
Seit diesen Tagen (seit über 40 Jahren) wurde ich in den unterschiedlichsten »Settings« immer wieder mit dem Tod konfrontiert: in meiner langjährigen Tätigkeit auf Intensivstationen und im Rettungsdienst, in meiner Tätigkeit bei langzeitbeatmeten Klient*innen in der häuslichen Pflege, in Tätigkeiten im Hospiz oder der ambulanten Palliativversorgung. Ich stand selbst am Grab von Menschen, die mir sehr, sehr viel bedeutet haben und wo das Unfassbare plötzlich über mich hereinbrach: Der Tod meiner Pflegemutter und der meines Schwiegervaters waren für mich die existentiellsten Erfahrungen, die mich betrafen, meine Familie, die Menschen, die ich liebte und die mit mir um »Fassung« rangen. Ich erinnere mich noch gut, als mein Schwiegervater (ein Landwirt in einem kleinen Dorf) verstorben war und wie wohltuend ich es fand, dass das Dorf, die weitere Familie aus einer langen Tradition, uns, die wir eng mit ihm verwandt waren, stützte, indem sie – oftmals wortlos – tat, was getan werden musste: Man kondolierte, vielleicht floskelhaft, aber es tröstete uns, man kam in das Haus meines Schwiegervaters und »war da«, einfach so, hielt mit uns das aus, was uns so unerträglich schien, hielt unser Weinen und Klagen, unsere Erschütterung, unsere Ziellosigkeit einfach »aus« … wie glücklich ich heute noch über diese Erfahrungen bin.
In dem Hauskreis lasen wir damals das Buch »Die Kunst des Sterbens – eine Anleitung« (Mauder 1976) von einem evangelischen Theologen und diskutierten darüber. Aber mir scheint, wir sprachen damals wie der berühmte Blinde über die Farbe. Viele andere Bücher, z. B. von Kübler-Ross (1975), habe ich seitdem zum Thema gelesen und viele persönliche Erfahrungen machen dürfen. Es zeigt sich nach meiner Wahrnehmung, dass auch der festeste Glaube häufig die Angst vor dem Tod nicht zu lindern vermag. Meine Erfahrungen lehren mich, dass wir immer noch »sprachlos« sind angesichts des Todes oder des bevorstehenden Todes.
2014 lernte ich das Konzept der »Gewaltfreien Kommunikation« nach Marshall B. Rosenberg kennen, die »Sprache des Herzens« (M. B. Rosenberg 2013). Ich war und bin fasziniert davon, wie Rosenberg – national und international – den Gedanken entwickelt hat, dass sich Menschen mit ihren Gefühlen und Bedürfnissen verbinden und diese einander mitteilen sollen. M. B. Rosenberg war davon überzeugt, dass Gewalt auch durch Sprache entsteht bzw. »gewaltvolles Verhalten« seine Ursprünge darin hat, dass eine Person sich ihrer eigenen Gefühle und Bedürfnisse nicht bewusst ist bzw. sie im Gegenüber nicht erkennt.
Mir ist wichtig, den Gewaltgedanken in zwei Richtungen zu benennen: Gewalttätigkeit wird in der Regel so verstanden, dass einer Person einer anderen Person »Gewalt« antut, sie schlägt oder zu irgendetwas zwingt. In der häuslichen (ambulanten) Pflege findet mehr »Gewalt« statt, als wir gemeinhin annehmen – nicht unbedingt im Sinne von körperlicher Gewalt, die auch stattfindet, sondern in Form von Mikroaggressionen: spitze Bemerkungen, gezielte Provokationen, absichtliches Missverstehen usw. M. B. Rosenberg spricht von dieser »Gewalt«, die eben auch in der Sprache liegt, und will mit seinem Kommunikationsmodell eine Möglichkeit anbieten, diese Gewalt zu verhindern. Gewalt richten wir aber auch gegen uns selbst, wenn wir Gefühle nicht zulassen und Bedürfnisse unterdrücken. Das klingt banal, aber wie oft können wir nicht einmal ein Gefühl benennen, das uns bedrückt, es so beschreiben, dass der Gegenüber versteht, warum es mir schlecht geht. Und wir sind häufig völlig überfordert, wenn es darum geht, für uns selbst und mit anderen zu klären, welches Bedürfnis ich mir erfüllen muss und mir erfüllt werden müsste, damit es mir wieder besser gehen kann. Hier hat M. B. Rosenberg ganz klar Zusammenhänge beschrieben, die helfen können, stressige, belastende Situationen zu meistern.
Mit der intensiven Beschäftigung und dem Versuch, »Gewaltfreie Kommunikation« selbst zu praktizieren, stelle ich immer häufiger fest, wie oft wir uns gegenseitig verletzen, weil wir unüberlegt oder wenig empathisch mit dem Gegenüber reden und uns über dessen Reaktion wundern (oder empören oder ärgern). Mit dem Wissen über die »Sprache des Herzens« höre ich in der Praxis der Palliativpflege die Gespräche innerhalb der Beziehungen und Familien, höre die in verletzende Worte gepackte Sprachlosigkeit und spüre die Ängste der todkranken Person und der An-/Zugehörigen. In den Beratungsgesprächen mit Klient*innen und deren Familien gelingt es nicht selten, mit »Gewaltfreier Kommunikation« Unsagbares sagbar zu machen. Und diese Möglichkeit möchte ich den Leserinnen und Lesern eröffnen, ihnen aufzeigen, dass Sprachlosigkeit mit der »Sprache des Herzens« überwunden werden kann und befreiend wirkt:
• für die todkranke, im Sterbeprozess befindliche Person,
• für die An- und Zugehörigen, aber auch
• für die Ehrenamtlichen, Pflegenden, Mediziner*innen und Theolog*innen.
»Palliative Pflegepraxis wird als ›Face-to-Face-Dimension‹ [umschrieben, als ein] Involviert-Sein, Betroffen-Sein, Berührt-Sein. Damit tangiert die Erfahrung des sterbenden Menschen auch stets das Erleben und somit die Persona, das Person-Sein, vom professionell Begleitenden […]. […] [Aber es kommt anscheinend] zu einer Divergenz von Profession und Persona: Während der professionellen Pflegefachperson eine ›Verobjektivierung‹ von Situations(deutung) und Verhalten zugeschrieben wird, wird angenommen, dass auf der anderen Seite ihre Persona eine subjektive Deutung vornimmt und so erspürte Bedürfnisse sterbender Menschen subjektiv beantwortet. Im Rückschluss ist die Face-to-face-Beziehung […] von Fremd- und Betroffen-Sein gekennzeichnet und damit ebenso als notwendige Selbstpflege von professionell Pflegenden zu erbringen.« (Schulze 2014, S. 36f.)
Mit anderen Worten: Die Kommunikation zwischen den Beteiligten muss oder sollte für beide »gut sein«:
»[…] dass ich sagen kann, […], das war für mich auch gut. Auch so eine Begleitung für mich, kostet mich ja Kraft, aber sie muss auch für mich gut sein, wenn ich sehe, ich konnte da einen Schritt weit was bewirken, dass alle aus der Situation gut herausgehen.« (Schulze 2014, S. 37)
Gewaltfreie Kommunikation leistet aus meiner Sicht einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zum »Sorge tragen«, denn sich um den Anderen (und sich selbst) (Selbstpflege nach Orem, Cavanagh 1997, Neumann-Ponesch 2011, Moers & Schaeffer 2011) zu sorgen, bedeutet »das Wachstum des Anderen (und sich selbst) zu ermöglichen« (Maio 2019, S. 222). Sorge bedeutet aber auch, »die Unmittelbarkeit ernst zu nehmen, […] sie ist und bleibt in jeder unmittelbaren Begegnung ein Werkstück, das immer wieder neu entworfen und abgestimmt werden muss« (ebd., S. 222) und sie ist »(über-)lebensnotwendig, denn nur die Sorge kann dem hilfsbedürftigen Menschen das Gefühl der Achtung vermitteln und zum Ausdruck bringen, dass man ihm beisteht.« (ebd., S. 224)
Wenn dieses Buch bei Ihnen, liebe Leser*innen, die Idee aufkeimen lässt, dass mit der »Gewaltfreien Kommunikation« vielleicht ein Bruchteil dessen verwirklicht werden kann, was gemeinhin als »umfassende Pflege«, als »empathische Unterstützung« oder einfach als »Menschsein« verstanden werden kann, dann erfüllt es seinen Zweck.
Wir leben in einer medialen Welt und so habe ich vereinzelt Hinweise auf im Internet verfügbare Videos eingefügt, die entweder einen Sachverhalt noch einmal »anders« erklären oder aber wichtige Persönlichkeiten vorstellen, auf die ich in diesem Buch besonders eingehe (z. B. Kübler-Ross u. a.).
Für Beratung bei einzelnen Themen danke ich Pastor Nils Christiansen (Christentum) und Rabbi Dr. Walter Rotschild (Judentum), Herrn Dr. Tobias Altmann, der sich wissenschaftlich mit der »Gewaltfreien Kommunikation« auseinandergesetzt hat, für die kritische Durchsicht des Manuskriptes und sein wohlwollendes Geleitwort und Frau Pastorin Kirsten Fehrs, Bischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche Norddeutschlands, für die Bereitschaft, das Manuskript zu lesen und ein Geleitwort zu verfassen. Ein besonders herzlicher Dank gilt Jai Wanigesinghe für die wunderbaren Abbildungen, sein Engagement für das Thema und für seinen überbordenden Ideenreichtum, auch komplexe Themen umzusetzen. Diese Abbildungen sind in den Seminaren immer besonders beliebt und helfen, Zusammenhänge noch besser zu verstehen.
Auch in dieser Arbeit ist mir wieder bewusst geworden, wie sehr ein gutes Lektorat hilft, verworrene Sätze zu entknoten und so zu formulieren, dass das geschriebene Wort für alle verständlich ist – mein Dank gilt daher auch und in besonderer Weise meiner Lektorin Frau Anne-Marie Bergter vom Kohlhammer Verlag.
Ein Letztes: Ich schreibe als Gesundheits- und Krankenpfleger und deshalb beziehe ich in diesem Text häufig diese Berufsgruppe ein, was aber nicht bedeuten soll, dass die anderen Personen, die sich um die Palliativbetreuung verdient machen, nicht gemeint wären.
| Klaus-Dieter Neander | Hamburg, im März 2021 |