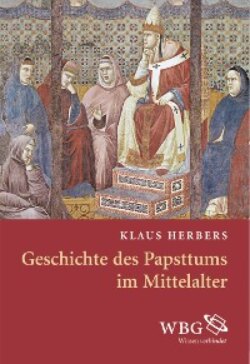Читать книгу Geschichte des Papsttums im Mittelalter - Klaus Herbers - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Konstantinische Wende und die neuen Rahmenbedingungen
ОглавлениеVor dem Hintergrund der Entwicklung der römischen Christengemeinde kann die offizielle Erlaubnis des christlichen Kultes in den Toleranzedikten zwischen 311 und 313 auch als Bestätigung der inzwischen errungenen Machtposition der christlichen Kirche gewertet werden. Es war abgesehen von vielen weiteren Gründen politisch klug und an der Zeit, auf die neuen, offenkundigen Entwicklungen einzugehen. Als Kaiser Konstantin (306–337) im Herbst 312 trotz geringer Truppenstärke gegen den Usurpator Maxentius erfolgreich blieb, soll dies späteren Berichten zufolge aufgrund eines Traumgesichtes geschehen sein: An Konstantin sei, so berichtet Lactanz, die Aufforderung ergangen, das himmlische Zeichen Gottes auf den Schilden seiner Soldaten anbringen zu lassen. Und laut Euseb habe Konstantin im Traum sogar erfahren, dass er unter diesem Zeichen siegen werde.8 In der Konsequenz bedeutete die anschließende Hinwendung Kaiser Konstantins I. zur christlichen Religion, die wahrscheinlich nach der siegreichen Schlacht an der Milvischen Brücke (28. Oktober 312) erfolgte, allein schon aufgrund rechtlicher Begünstigungen eine neue Chance für die Kirche. Die später geprägte Bezeichnung „Konstantinische Wende“ deutet die Tragweite an, obwohl erst die Anerkennung als Staatsreligion (Dekret des Kaisers Theodosius I. vom 27. Februar 380) den entscheidenden Schritt bezeichnet. Die darauf folgenden grundlegenden Änderungen der kirchlichen Strukturen mit dem Aufschwung der Missionierung, dem Mönchtum und weiteren Entwicklungen sind später aber nicht von allen als Fortschritt gewertet worden. Wer in der Urkirche, der ecclesia primitiva, das Ideal kirchlich-gemeinsamen Handelns sah, für den bedeutete die Konstantinische Wende den ersten Sündenfall, wie schon Reformer des hohen Mittelalters, später Martin Luther und weitere Reformatoren unterstrichen. Auch allgemeine Vorbehalte sind formuliert worden, weil erst nach der Konstantinischen Wende Eingriffe des Kaisers verstärkt möglich wurden und damit die Gefahren der Verweltlichung zunahmen. Ohne sich auf Polemik oder extreme Wertungen einzulassen, bleibt unbestritten, dass die Rolle der römischen Bischöfe seit dem 4. Jahrhundert in stärkerem Maße mit den Schicksalen und den Interessen der weltlichen Machthaber verbunden erscheint.
Um die Bedeutung der römischen Bischöfe im 4. und in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts angemessen würdigen zu können, sind deshalb die allgemeinen Rahmenbedingungen im Auge zu behalten, vor allem die Stellung Roms im Gesamtreich und die Entwicklungen der sogenannten Völkerwanderung. Seit Konstantin und seinen Nachfolgern verlor Rom zunehmend sein Gewicht als Reichshauptstadt, denn der Kaiser baute seit 324 das „Neue Rom“ am Bosporus aus, das bald seinen Namen, Konstantinopel, tragen sollte. In der Folge wurde der in Rom zurückgebliebene Senat weitgehend bedeutungslos, profilierte sich zuweilen durch Opposition und ließ noch bis ins 5. Jahrhundert vor allem in Rom Kultstätten des alten Glaubens errichten. Die römischen Bischöfe versuchten hingegen angesichts der entfernt residierenden Kaiser vielfach, ihr eigenes Regiment zu stärken. Einheitstendenzen in Rom kam zustatten, dass die griechischsprachige Bevölkerung Rom zunehmend verließ. Zugleich schrumpfte die Bevölkerung Roms drastisch, man schätzt zuweilen schon für das 4. und 5. Jahrhundert einen Rückgang von 500.000 auf 100.000 Einwohner. Die unterschiedliche Entwicklung in Ost und West sollte große Folgen zeitigen.
Die Mobilität neuer gentes während der „Völkerwanderung“ betraf Rom vor allem 410, als die Westgoten, und 455, als die Vandalen vor der Stadt lagerten. Damals bestanden die römischen Bischöfe Innozenz I. und Leo I. ihre Bewährungsproben und erschienen vielen Zeitgenossen als die eigentlichen Herren der Stadt, denn teilweise führten sie die Verhandlungen mit den „Barbaren“. Allerdings ergab sich verstärkt das Problem, dass die meisten neuen gentes wie die Ostgoten oder später die Langobarden, nicht der katholischen Lehre, sondern einer damals weit verbreiteten, aber als häretisch verurteilten Variante, dem sogenannten Arianismus, anhingen. Arius (Areios), ein Presbyter aus Alexandria († 336), hatte eine auf dem Konzil von Nizäa (325) verworfene Position zur Trinitätslehre vertreten, die davon ausging, dass es nur einen höchsten und wahren Gott als Vater gebe. Christus, dem die Gottessohnschaft abgesprochen wurde, galt als höchstes aller Geschöpfe. Der Sohn sei demnach nicht ewig wie der Vater. Im Westen des Römischen Reiches hatte der Arianismus außer bei den (germanischen) gentes wenig Anhänger. Auf lange Sicht brachte hier wohl der Schritt der Frankenkönige zur römischkatholischen Lehre, der mit der Taufe Chlodwigs erfolgte,9 die entscheidende, wenn auch in mancher Hinsicht nicht unproblematische Konsolidierung des Katholizismus.