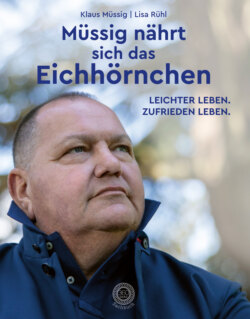Читать книгу Müssig nährt sich das Eichhörnchen - Klaus Müssig - Страница 8
ОглавлениеDas Limbische System
Es gibt einen Grund dafür, dass wir uns an bestimmte Erlebnisse besser erinnern, sie anders verarbeiten und in Handeln überführen können als andere. Diese Erfahrungen sind oft einfach, aber essenziell. Was sie für uns wichtig und besonders macht, ist die emotionale Verknüpfung, sie sind an Gefühl gebunden.
Wie der Name schon vermuten lässt, ist das Limbische System das Zusammenspiel mehrerer Strukturen im Gehirn, die zwischen und unter den beiden Gehirnhälften und wie ein Saum (lat. limbus = Saum) um die Basalganglien und den Thalamus liegen. Diese Strukturen, unter anderem der Hippocampus und die Amygdalae, sind untereinander und mit anderen Hirnregionen verbunden. Im Limbischen System nimmt die Verarbeitung und Steuerung von Emotionen und Affekten, Gedächtnis, Trieb- und Instinkthandlungen ihren Ausgang. Sinneswahrnehmungen und Informationen werden emotional eingeordnet. Diese Prozesse laufen vor dem Bewusstsein ab; Sprache und Logik erreichen dieses emotionale Gehirn nicht, auch nicht im Nachhinein.
Ein Einfluss auf Blockaden, Zuversicht und Lernprozesse ist also nur über das positive und emotionale Erleben möglich. Das Limbische Denken orientiert sich an diesen Erkenntnissen und bietet Strategien für ein leichteres und zufriedeneres Leben.
Immer diese Emotionen …
Angst, Ekel, Wut, Verachtung, Trauer, Überraschung, Freude. Von diesen Emotionen ist eigentlich nur eine klar positiv besetzt: die Freude. Vor allem um sie geht es in meinen Seminaren und auch in diesem Buch. Wie ich sie gefunden habe und jeden Tag neu entdecke. Wie ich anderen Menschen helfen will, sie ebenfalls in sich selbst und der Welt zu finden.
Aber was ist mit den anderen Emotionen? Kein Tag birgt nur Freude. Ich begegne Menschen und Situationen, vor denen ich Angst habe, die mich ekeln oder wütend machen. Überraschungen bringen mich aus dem Takt. Manches stimmt mich traurig. Emotionen kann ich mich nicht entziehen. Sie alle gehören zum Leben dazu.
Und das ist auch gut so. Denn tatsächlich ist keine Emotion schlecht. Emotionen geben unserer Umwelt Bedeutung.
Bis heute gibt es keine einheitliche Definition für Emotionen, was zeigt, wie vielschichtig und komplex dieses Konzept unseres Organismus ist. Deshalb sind Emotionen auch Gegenstand unterschiedlicher Forschungsrichtungen wie Psychologie, Neurologie, Evolutionsbiologie und Soziologie.*
Klar ist, dass Emotionen verschiedene Bestandteile und Funktionen haben. Zunächst einmal beziehen sie sich auf bestimmte Ereignisse, manchmal auch auf Dinge – Emotionen sind also kein Dauerzustand. Das kann ich gut anhand meiner eigenen Erfahrung nachvollziehen. Emotionen sind eben oft nur Momentaufnahmen. Wut verraucht, Angst löst sich auf, Ekel verschwindet. Auch Augenblicke der Freude sind manchmal sehr flüchtig. Nur die Trauer begleitet die Menschen über einen längeren Zeitraum. Aber auch sie verändert sich.
Das, was ich hier beschreibe, ist aber nur eine Komponente der Emotionen, die subjektiv erlebbaren Gefühle.
In meinem Körper passiert gleichzeitig viel mehr. Mein Blutdruck, mein Herzschlag, meine Hauttemperatur und die Konzentration verschiedener Hormone verändern sich. Ich zittere vor Wut, werde blass oder erröte. Und meist gehen mit Emotionen auch Bewegungen einher. Unwillkürlich zucken meine Mundwinkel, heben sich meine Augenbrauen oder verändert sich meine Körperhaltung.
So weit, so nachvollziehbar. Und nun die entscheidende Frage: Warum?
Meine Antwort: Ohne Emotionen läuft einfach nichts!
Klingt übertrieben? Vielleicht.
… aber unwahrscheinlich. Denn Emotionen haben zahlreiche Funktionen und Einfluss auf fast alles. Wahrscheinlich haben sie sogar großen Anteil an der erfolgreichen Entwicklung unserer Spezies. Denn dank ihnen können wir uns an verschiedenste Umweltsituationen anpassen. Sie informieren unseren Organismus über die Bewertung einer Situation.
* Einen guten Überblick über den aktuellen psychologischen Forschungsstand unter Einbezug weiterer Disziplinen geben zum Beispiel Brandstätter u. a. 2018.