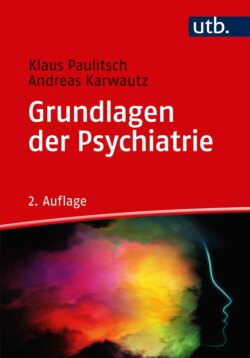Читать книгу Grundlagen der Psychiatrie - Klaus Paulitsch - Страница 74
3.2Psychodynamisches Modell
ОглавлениеDas psychodynamische Modell sucht hinter den körperlichen oder seelischen Beschwerden nach Denkmustern, Gefühlen, Konflikten, die in frühen Lebensperioden wurzeln. Eine zentrale Vorstellung ist, dass viele Verhaltensweisen unbewusst erfolgen und dem Betroffenen nicht verständlich sind. Die von Sigmund Freud begründetet Psychoanalyse gilt als grundsätzliche Theorie für alle psychodynamischen Vorgänge und beobachtet z. B. genau die Beziehung des Klienten zum Therapeuten, deutet Regungen mit Rückgriff auf frühe Beziehungsmuster (Übertragungen, Projektionen) und nützt diese für den Heilungsprozess. Der Therapeut achtet ebenso auf seine eigenen Emotionen dem Klienten gegenüber (Gegenübertragung, Projektionen). Durch die freie Assoziation des Patienten, die Deutung von Trauminhalten und Fehlleistungen, können zugrunde liegende Konflikte bewusst gemacht und therapeutisch bearbeitet werden. Abwehrmechanismen wie Rationalisierung, Verleugnung, Verdrängung, Projektion und Reaktionsbildung werden identifiziert, ihr Einsatz wird durch den Klienten beobachtet und in ihrer Bedeutung und Notwendigkeit reduziert.
Unzählige Schulen mit unterschiedlichen Modellen haben sich nach Freud aus dem psychoanalytischen Modell weiterentwickelt, z. B. die von Alfred Adler, Carl Gustav Jung, Melanie Klein, Viktor Frankl, Manès Sperber, Wilfried Bion, Otto Kernberg, John Gunderson und Glen Gabbard.
Nach Tyrer hat die psychodynamische Sicht vor allem eines eingebracht: „die Anerkennung der Reichhaltigkeit und Vielfalt des Lebens, der Entwicklung und letztendlich der Evolution des Menschen; sie fördert Gefühlsausdruck und Anpassung“. Kritisch fügt er jedoch an: „Die psychodynamische Theorie kann allgemeine Ursachen menschlichen Leids und Konsequenzen von Problemen und Beziehungsstörungen besser erklären als spezifische Symptombildungen“ (Tyrer und Steinberg, 1997, 70).