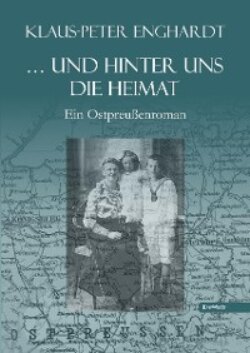Читать книгу ... und hinter uns die Heimat - Klaus-Peter Enghardt - Страница 10
ZURÜCK IN DER NEUEN HEIMAT
ОглавлениеVor dem Bahnhof in Loditten stand ein dunkler Borgwart, dessen Fahrer offensichtlich auf seinen Fahrgast wartete.
Als Katharina mit ihren Koffern am Fahrzeug vorüberging, öffnete der Fahrer die Tür und sprach die junge Frau an.
Es war der Bürgermeister, der seinen Neffen erwartete und Katharina anbot, sie nach Loditten mitzunehmen.
Erfreut nahm die Lehrerin das Angebot an.
Noch als sie ihre Koffer im Gepäckraum des Wagens verstaute, trat ein junger Leutnant an den Wagen, der so gar nicht die Figur seines Onkels besaß, der war nämlich eher klein und untersetzt, der Leutnant dagegen groß und sportlich. Nachdem er Katharina und seinen Onkel begrüßt hatte, nahm er, wie selbstverständlich, auf dem Rücksitz Platz und bot der jungen Frau den Beifahrersitz an. Seinen Koffer legte er im Fond neben sich.
Während der wenigen Minuten war der Leutnant ein sehr amüsanter Erzähler, der Katharina sogar anbot, sie nach Königsberg in das Kino auszuführen. Lachend lehnte sie das Angebot ab, bedankte sich jedoch beim Bürgermeister, als er sie direkt vor dem Haus ihrer Wirtin absetzte.
Als sie das Haus betrat, hörte sie Stimmen. Da fiel ihr wieder ein, dass Marie Schimkus ja Besuch von ihrem jüngsten Sohn erwartet hatte. Offensichtlich war dessen Urlaub noch nicht zu Ende.
Obwohl sie sich bei ihrer Freundin wie zu Hause fühlte, klopfte sie an der Küchentür an. Als sie eintrat, war sie erstaunt, denn Georg hatte mit seinem Bruder wenig Ähnlichkeit. Er hatte zwar die gleichen blauen Augen, doch sein Haar war semmelblond und irgendwie sah er wie ein großer Junge aus, der nicht erwachsen werden wollte. Auch seine Sprechweise ließ eher auf einen Luftikus schließen, als auf einen Piloten der deutschen Luftwaffe, doch er machte auf die junge Frau einen sympathischen Eindruck.
Zwei Tage blieb Georg noch, dann war sein Urlaub vorbei, und wer weiß, wann er seinen nächsten Urlaub bekommen würde. Die Situation hatte sich in Südeuropa und Nordafrika dramatisch zugespitzt und die zweite Abteilung des Kampfgeschwaders 54 war an die Ostfront abkommandiert worden.
Inzwischen hatte Georg seine Kampffliegerausbildung beendet, war zum Unteroffizier befördert worden und flog nun eine einmotorige Ju 87 D. Er war mit seinen Kameraden auf einem Flugplatz im Süden Italiens, in Foggia stationiert.
Der Januar 1943 brachte grimmige Kälte bis unter minus zwanzig Grad Celsius und Unmengen von Schnee. Der Wind blies eisig unablässig aus Nordost und an sternenübersäten Abenden sah der Himmel wie blankgeputzt aus. Um den Mond hatte sich eine helle Scheibe gelegt, und Eiskristalle glitzerten wie kleine Diamanten an den Ästen der Bäume.
Die Flüsse und Bäche waren zugefroren und auf den Häusern lag der Schnee, als wären es Hauben aus Zuckerwatte.
Die Natur war starr vor Kälte und auch den Tieren und den Menschen machten die Temperaturen zu schaffen.
Die Alleen waren tief verschneit, und es war fast unmöglich mit dem Auto nach Loditten oder in die Kreisstadt Heiligenbeil zu gelangen. Die Bauern hatten inzwischen ihre Pferdeschlitten angespannt.
Immer mehr Schüler blieben bei dieser Kälte zu Hause, wer sollte es ihnen verdenken. Der Kachelofen des riesigen Klassenzimmers war überfordert und schaffte es nicht, die Temperatur im Raum über acht Grad Celsius zu bringen. Katharina verbrauchte Unmengen von Holz und entschloss sich eines Tages, auch den verbliebenen Schülern ein paar freie Tage außer der Reihe zu gewähren. Sie erteilte ihnen Schulaufgaben, die die Kinder zu Hause selbstständig erledigen sollten. Nach einer Woche müssten sich alle Schüler wieder in der Schule einfinden, ob es mit dem Unterricht in der Schule weitergehen konnte, wollte die Lehrerin dann entscheiden.
Inzwischen konnte Katharina die Zeit nutzen, um defekte Schulmaterialien auszubessern oder neuen Lernstoff vorzubereiten. Außerdem wollte sie ihren Eltern und Freunden ausführliche Briefe schreiben, das war in den letzten Tagen leider zu kurz gekommen.
Jeden Morgen und jeden Abend ging Katharina in die Schule, um den Ofen in ihrem Klassenraum anzuheizen, damit der Raum nicht völlig auskühlte.
Bauer Roschkat brachte das Holz mit seinem Schlitten und freute sich jedes Mal, über den heißen Tee bei der jungen Lehrerin, die das Getränk stets mit einem Bärenfang verfeinerte. Mit leuchtetenden Augen schlürfte der Bauer dann genüsslich Schluck für Schluck.
Immer wenn Katharina von der Schule nach Hause kam, schaute sie als erstes in den Briefkasten nach Post.
Sie machte sich große Sorgen um ihre Eltern, denn aus dem Radio kamen keine guten Nachrichten. Das Ruhrgebiet war ständig Ziel von Bombenangriffen und in Essen, Dortmund und Gelsenkirchen sollte es verheerend aussehen. Doch auch Köln wurde fast täglich bombardiert.
Als im Februar die Bombenangriffe ein nicht zu begreifendes Ausmaß angenommen hatten, bat Katharina ihre Eltern in einem Brief inständig, Köln zu verlassen und entweder zu ihr nach Loditten zu kommen oder auf das Land zu Verwandte zu ziehen. Es könne doch nur eine Frage der Zeit sein, bis auch Köln-Ehrenfeld dem Erdboden gleich gemacht würde.
Für die junge Lehrerin war es schwer, sich auf die Schule zu konzentrieren, weil sie sich sehr um ihre Eltern und um Wolfgang sorgte. Da kam es ihr sehr gelegen, als Marie sie fragte, ob sie nicht Lust hätte, sich dem Frauenchor anzuschließen, der einmal pro Woche im Pfarrhaus übte.
Jeden Donnerstag um neunzehn Uhr trafen sich dort die Frauen des Landfrauenvereins der umliegenden Dörfer, um das deutsche Liedgut zu pflegen. Zunächst probten sie unter der Leitung des Kantors ihrer Kirche, doch seit der zur Wehrmacht eingezogen war, hatte der Chor keinen Leiter mehr. Herr Graudenz hatte die Chormitglieder zwar ab und zu auf der Orgel begleitet, doch er lehnte es stets ab, die Leitung für den Klangkörper zu übernehmen. Deshalb stand der Chor vor der Entscheidung, sich dem Kirchenspiel Zinten anzuschließen, oder auf eigene Faust weiter zu machen.
Die Frauen entschieden sich für die zweite Alternative, doch sie mussten einsehen, dass ihnen tatsächlich ein Chorleiter fehlte.
Da Katharina in der Schule unter anderem Musik unterrichtete, wären die Chormitglieder durchaus einverstanden, wenn sie die Chorleitung übernehmen würde, zumal sie ja sogar Klavier spielen konnte. Zwar besaß die Dorfkirche kein Klavier, dafür aber eine Orgel, und Marie war der Meinung, dass sich die Lehrerin schnell in die Spielweise einfinden würde.
Außerdem wäre es für Katharina selbst von Vorteil, wenn sie neben ihrer eigentlichen Arbeit eine gesellschaftliche Tätigkeit ausüben würde, die sich der Pflege des deutschen Liedgutes widmete. So bliebe sie vielleicht vor dem Drängen des Kreisleiters unbehelligt, der ihr mehrfach ans Herz gelegt hatte, sich als Gruppenleiterin beim BDM einzubringen.
Zunächst hatte die junge Frau Bedenken, doch Marie überzeugte sie schließlich mit ihrem Argument.
Bereits am nächsten Donnerstag begleitete Katharina ihre Freundin zur ersten Chorprobe.
Ende Februar kam endlich ein ausführlicher Brief von Wolfgang, nachdem er zuvor immer nur kurze Nachrichten geschrieben hatte. Zu Katharinas und natürlich auch zur Freude von Wolfgangs Mutter teilte er mit, dass er im März Urlaub bekommen würde. Zwei Wochen, die er selbst so sehr herbeisehnte.
Katharina war vor Freude außer sich. Beim Lesen des Briefes hatte sie wieder gemerkt, wie sehr sie Wolfgang eigentlich liebte, und das, obwohl sie nur so wenig Zeit hatten, sich näher kennenzulernen. Doch vielleicht liegt es am Wesen des Krieges, dass die Liebe die Menschen schneller erreichte, als in Friedenszeiten, weil man mehr auf das Herz hörte, als auf den Verstand.
Nun zählte Katharina jeden einzelnen Tag, bis Wolfgang endlich auf Urlaub kommen würde, doch einen genauen Termin hatte er nicht nennen können.
Inzwischen hatte sich der Frühling eingestellt. Zunächst verschwand der Schnee von den Äckern und Wiesen, von den Hausdächern rutschten mit Getöse Schneelawinen herab, Bäche und Seen tauten auf, und in den tiefen Wagenspuren der unbefestigten Verbindungswege zwischen den Dörfern bildeten sich kleine Flüsse, die von den Kindern zu einem Kanalnetz ausgebaut wurden, indem sie mit Stöcken kleine Rinnen kratzten. Die Kanäle sammelten sich wiederum in einer riesigen Pfütze, die das gesammelte Wasser nicht mehr fassen konnte und als breiter Strom bergab lief.
Da wurde manches Kind zum Staudammbauer, damit das Wasser nicht über die Ränder schwappte, oder zum Flößer, denn in die kleinen Kanäle hatten die Kinder Stöckchen gelegt, die sich munter fortbewegten. Das war interessant, verzögerte den Schulweg jedoch erheblich und machte gar einen pünktlichen Schulbesuch unmöglich.
Die Lehrerin sah es ihnen nach, denn gerade die Schüler aus den Vorwerken waren im Winter die pünktlichsten ihrer Klasse. Wenn es zu Fuß nicht mehr durch den hohen Schnee ging, dann hatte einer der Bauern einen Wagen oder gar den riesigen Pferdeschlitten angespannt, die ganze Bande aufgeladen und zur Schule gebracht.
Jetzt, im aufkommenden Frühling war dafür keine Zeit mehr, die Bauern bereiteten alles für die Feldarbeit vor.
Als an einem Freitag, Ende März, der Unterricht beendet war, erwartete Katharina eine Überraschung. Wie jeden Freitag räumte sie nach dem Unterricht den Lehrertisch auf, gab den Topfpflanzen Wasser, und verließ erst dann das Schulgebäude. Als sie die Schultür abschloss, hielt ihr plötzlich jemand von hinten die Augen zu. Zuerst war die junge Frau erschrocken, doch sofort hatte sie einen Verdacht und jubelte: »Wolfgang! Ich habe so auf dich gewartet!«
Erstaunt, dass sie ihn so schnell erkannt hatte, drehte er Katharina zu sich herum und gab ihr einen Kuss zur Begrüßung. Sie schaute über seinen Rücken hinweg die Dorfstraße entlang und sagte gespielt vorwurfsvoll: »Man küsst eine Lehrerin nicht einfach so auf der Straße. Was sollen denn die Leute und vor allem meine Schüler von mir denken?« Doch ihre Augen leuchteten vor Freude und sie zog ihn an der Hand vom Schultor fort und lief mit ihm nach Hause.
Ganze zwei Wochen konnte sie nun mit Wolfgang verbringen und ihr Herz machte ein paar freudige Hüpfer. Auch Marie war froh, ihren »Großen« für eine gewisse Zeit bei sich zu haben, doch beim Abschied hoffte sie stets, ihre beiden Söhne gesund wiederzusehen.
Obwohl Wolfgang seine Mutter ermunterte, sich ihm und Katharina anzuschließen, wenn sie nach Königsberg ins Kino fuhren, oder mit den Rädern nach Zinten oder an den Arnsteiner See, lehnte sie diese Angebote stets lächelnd ab.
»Ich war ja auch einmal jung und ich war damals froh, wenn ich mit deinem Vater allein sein konnte. Nutzt beide die Zeit, wer weiß, wann du das nächste Mal nach Hause kommen kannst. Außerdem hat sich Katharina so auf dich gefreut und ich freue mich, wenn es dir gut geht, mein Junge. Viel zu selten kommst du nach Hause.«
Zärtlich streichelte Marie ihrem Sohn über die Wange, da nahm er seine Mutter in die Arme und sagte: »Du bist die beste Mutter der Welt.« In diesen Worten lag all seine Liebe.
Am Samstagmorgen stiegen Katharina und Wolfgang auf die Räder und fuhren durch die erwachende Natur.
Die Vögel hatten sich inzwischen wieder ihre gewohnte Umgebung erobert und jubelten in den Zweigen der Bäume über die wärmende Sonne. Und auch die Menschen waren froh, dass der lange Winter vorüber war. Am Wegesrand blühten violette Märzveilchen und im klaren Wasser des Baches spiegelten sich die gelben Blüten der Sumpfdotterblumen, die den Grabenrand bevölkerten.
Vom Weg aus bot sich den Radlern ein grandioses Bild.
Ein weißer Blütenteppich aus Buschwindröschen bedeckte große Flächen des Waldes und als sie am See ankamen, blühten dort unter den Laubbäumen unzählige Leberblümchen. Der Frühling zeigte sich in seiner schönsten Form und Farbe und die Sonne wärmte nicht nur die Körper, sondern auch die Seelen.
Wolfgang hatte seinen Arm um Katharinas Schulter gelegt und genoss mit ihr den Augenblick. Sie schaute ihn lächelnd an und ihre Münder fanden sich zu einem langen zärtlichen Kuss, ehe sie wieder auf ihre Räder stiegen und ihren Weg fortsetzten.
An der tausendjährigen Eiche, einem Baum, den sechs Männer nicht umfassen konnten, machten sie Rast und verzehrten die mitgebrachten Brote. Dazu tranken sie Kakao aus einer Thermosflasche.
Mit der untergehenden Sonne ging auch dieser schöne Ausflug zu Ende.
Die junge Lehrerin musste abends oft noch die Hefte ihrer Schüler korrigieren oder für vier Klassenstufen den Unterricht vorbereiten, trotzdem verbrachte sie jede freie Minute mit Wolfgang und saß dann oft bis spät in der Nacht über den Heften und sie bedauerte es nicht, dann nur noch ein paar Stunden Schlaf zu finden. Sie schlief in ihrem Zimmer mit dem Gedanken an Wolfgang ein und wachte mit dem Gedanken an ihn wieder auf. Könnte doch die Zeit still stehen, aber die schönen Tage verrannen, wie der Ufersand der Frischen Nehrung zwischen den Händen.
Katharina hatte jeden Kuss genossen, jede Berührung, und sie hatte insgeheim gehofft, dass ihr Liebster den Mut finden würde, noch einen Schritt weiter zu gehen, weil für sie klar war, dass sie und Wolfgang einfach zusammengehörten. Vielleicht hatte ihr Schatz sogar denselben Wunsch, aber er betrachtete sie als etwas ganz Besonderes und wollte diesen Augenblick für einen geeigneteren Zeitpunkt aufheben.
Als der Unterfeldwebel nach diesem Urlaub zurück an die Front fuhr, war in der jungen Frau tagelang eine unfassbare Leere. Nur das Foto, dass sie beide von sich in Zinten bei einem Fotograf anfertigen ließen, erinnerte sie nun an ihren Liebsten und schenkte ihr etwas Trost.
Trost fand sie auch in den Briefen aus der Heimat und aus Berlin.
Ihren Eltern ging es trotz der ständigen Luftangriffe gut, zu einem längeren Aufenthalt in Loditten hatten sie sich bisher noch nicht entschließen können. Und bei Mutter Kleinschmidt war auch alles in Ordnung. Sie schrieb sogar, dass sie das Osterfest bei der Familie ihrer Schwester in Elbing verbringen würde und sich vorgenommen hatte, einen Abstecher nach Loditten zu machen. Darüber freute sich Katharina riesig und auch darüber, dass Marie von sich aus anbot, dass Mutter Kleinschmidt ein Zimmer bekommen könnte, damit die Frau nicht im Gasthaus logieren musste. Marie war bereits neugierig auf Frau Kleinschmidt, die von Katharina in den höchsten Tönen gelobt wurde.
Auch Tante Ida hatte geschrieben, dass sie bisher alles gut überstanden hatten, obwohl Köln nur noch eine einzige Steinwüste war. Erstaunlicherweise fuhren die Straßenbahnen noch. Die Menschen räumten den Schutt von den Straßen und säuberten die Straßenbahngleise. Das hatte eine größere Priorität, als kaputte Häuser wieder aufzubauen.
In Ostpreußen waren überall die Ostervorbereitungen im Gange. Auch bei Katharina in der Schule wurde gebastelt, gemalt und gebacken. Die Kinder brachten gekochte Eier in die Schule, die sie dann im Unterricht bunt bemalten, oder bohrten zwei Löcher in ein frisches Ei und bliesen es aus.
Das war gar nicht so einfach und strengte an.
So mancher machte dicke Backen, doch der Eidotter wollte nicht aus dem Ei herauskommen. Schließlich gelang es mit fremder Hilfe doch und aus den ausgeblasenen Eiern wurden nebenbei für alle Rühreier gebraten. Das war ein Genuss.
Besonders die Kleinen waren emsig bei der Arbeit. Da schaute schon mal vor höchster Konzentration die Zungenspitze aus dem Mund und wanderte von einem Mundwinkel zum anderen. In mühevoller Arbeit entstanden kleine Geschenke für die Eltern und die Großeltern. Die Väter bekamen ihre Geschenke per Post, wenn Mutter das Osterpäckchen an die Front schickte, denn in kaum einer Familie war der Vater noch zu Hause. Nur wer beim Wehrbezirksamt nachweisen konnte, dass ein Einsatz in der Wehrmacht eine nicht zu überbrückende Härte bedeuten würde, und das Verbleiben in der Heimat kriegswichtig war, der bekam eine Sondergenehmigung.
Der Bäcker in Loditten hatte bis auf weiteres so eine Genehmigung erhalten, als auch nach intensivster Suche kein Ersatz für ihn gefunden werden konnte, der den Betrieb weiterführte, denn von der Bäckerei in Loditten wurden die umliegenden Dörfer mit Brot und Backwaren versorgt.
Von einer Wanderung durch den Wald brachten die Schüler Birkenzweige in die Schule mit. Dort wurden die Zweige zu kleinen Sträußen gebunden und in Wassereimer gestellt.
Sie sollten bis Ostern Blätter treiben, damit die Kinder am Ostermontag damit »schmackostern« konnten, das war ein alter und noch immer beliebter ostpreußischer Osterbrauch.
Als die Lehrerin am Gründonnerstag den Klassenraum betrat, saßen ihre Schüler bereits artig in ihren Bänken. Kaum ein Schüler fehlte und alle Kinder trugen ihre guten Kleider.
Die Lehrerin begrüßte die Schüler an diesem besonderen Tag, doch noch bevor sie den Unterricht beginnen konnte, trat die erste Schülerin an das Klassenpult und übergab der Lehrerin einen kleinen Korb mit Eiern. Auch die nächste Schülerin schenkte Eier und dazu ein Stück Speck. Nun gab es kein Halten mehr. Fast jeder Schüler brachte ein Geschenk, meist waren es Naturalien. Die Lehrerin war überwältigt und gerührt. Sie freute sich natürlich, dass sie bei ihren Schülern so beliebt war.
Als sie in all die leuchtenden Augen der Kinder schaute, war ihr klar, dass sie an diesem Tag keinen normalen Unterricht abhalten konnte, außerdem hatte sie für ihre Schüler noch eine Überraschung parat. Deshalb schaute sie bereits ab und zu heimlich aus dem Fenster. Sie sah Marie Schimkus und einige Mütter der Schüler emsig im Schulhof herumlaufen. Auf ein Zeichen Maries verkündete die Lehrerin: »So, nun gehen wir alle hinaus, ich glaube, dass der Osterhase da war, und für jeden etwas versteckt hat.«
Mit lautem Jubel stürmten die Racker auf den Schulhof und da begann das Suchen. Für jedes Kind hatten Marie und die Mütter kleine Osternester mit Naschereien versteckt.
Die herrschaftliche Familie hatte Süßigkeiten spendiert und auch der Gewürzer hatte tief in seine Bonbongläser gegriffen. Die Nester hatte die Lehrerin gemeinsam mit ihrer Freundin Marie und den Müttern an den vergangenen Abenden gebastelt. Das war ein »Hallo«, als jeder sein Nest in den Händen hielt.
Die Lehrerin hatte anschließend Mühe, die Schüler wieder in den Klassenraum zu bekommen. Sie beschloss deshalb, im Freien ein paar Spiele zu machen, und versprach, im Anschluss aus ihrem dicken Sagenbuch Geschichten vorzulesen.
Damit auch die Kinder zu Wort kamen, sollten sie ihre schönsten Ostererlebnisse erzählen.
Das war ein tüchtiger Spaß für alle. Zufrieden mit dem Tag, schickte Katharina ihre Schüler eine Stunde früher nach Hause. Anschließend versuchte sie, ihre Geschenke zu verstauen, um sie nach Hause zu transportieren, doch dieses Ansinnen musste sie erfolglos abbrechen, denn sie hatte Sorge, dass beim Transport Eier zerbrechen könnten.
Notgedrungen musste sie erst nach Hause gehen, sich einen großen Pappkarton besorgen und dann mit dem Fahrrad noch einmal zur Schule fahren, um ihre »Schätze« zu holen.
Beim Verpacken zählte sie einhundertzweiundfünfzig Eier, die könnte sie allein gar nicht aufessen, fuhr es ihr durch den Kopf. Katharina beschloss, mit einem Teil der Eier, gemeinsam mit ihren Schülern Kuchen zu backen, auch dabei konnten die Kinder etwas lernen und sie würden sich sicher freuen. Aus dem anderen Teil der Eier würde Marie sicher mit ihr Eierlikör machen.
Die zahlreichen Speck- und Schinkenstücke könnte sie im Keller von Marie lagern, den Eierlikör natürlich bei einem Verzällche mit Marie und den Nachbarinnen zum Kaffee trinken, einen Teil der Schokolade würde sie selbst essen, sie war halt ein kleines Süßmaul, und den Rest wollte sie ihren Schülern stückweise für gute Leistungen spendieren.
Die Kinder konnten es gar nicht erwarten, dass der Karfreitag und der Samstag vergingen und sie am Ostersonntag zu Hause im Garten auf Ostereiersuche gehen konnten. Tagelang hatten sie geholfen, die Eier zu färben. Auf den Küchenherden brodelte es in den Kochtöpfen wie in einer Hexenküche, denn der Sud, in dem die Eier gefärbt wurden, musste vorbereitet werden.
In einem Topf wurden Zwiebelschalen und Schwarztee gekocht, das gab den weißen Eiern eine kräftige goldbraune Färbung, im nächsten Topf waberte ein Sud aus roter Bete für rotviolette Eier, im nächsten Topf kochten Spinat und Petersilie, das ergab zartgrüne Eier, Brennnesselblätter und einige Safranfäden färbten die Eier gelb und gekochter Heidelbeersaft blau. Ein Zusatz aus Alaun und Pottasche verstärkte die Farben.
Am Morgen des Ostermontags mussten die Kinder sehr früh aufstehen und sich mit dem Schmackosterstrauß zu den Eltern ans Bett schleichen. Dort rissen sie die Bettdecke weg, verabreichten der Mutter und dem Vater ein paar leichte Hiebe auf die nackten Beine und riefen den Spruch:
»Grün Ostern, Schmackostern,
gib Eier und Speck
und vom Kuchen ‘ne Eck’,
eher geh ich nicht weg.«
Der Schmackosterte musste nun einen Teil seiner Eier und seiner Süßigkeiten abgeben. Das war bei den Eltern nicht weiter schlimm, denn die sorgten ja sowieso für die Ostergaben und betrachteten das Schmackostern der Kinder als großen Spaß für alle. Wenn jedoch die Geschwister schmackostert wurden und von ihren Eiern und Süßigkeiten abgeben mussten, schmerzte das doch erheblich und konnte nur ausgeglichen werden, wenn man nun selbst jemanden mit der Osterrute oder dem Osterstrauß überraschen konnte. Heimlich schlich sich derjenige nun zum Nachbarhaus, in der Hoffnung, dort zum Ziel zu kommen.
Auch Marie Schimkus hielt es mit den ostpreußischen Osterbräuchen. Bei ihr kam bereits am Gründonnerstag ein riesiger Osterkringel aus Hefeteig auf den Tisch, der mit Birkenzweigen geschmückt war. Früher versuchte jeder aus der Familie, sich das größte Stück abzureißen, der Sieger durfte sich etwas wünschen. Da außer Marie aber nur Katharina am Tisch saß, schnitten die Frauen den Kringel an und verspeisten ihn gemeinsam. Dabei verriet Marie der jungen Frau noch andere Osterbräuche, zum Beispiel, dass sie die am Gründonnerstag gelegten Eier ihrer Hühner beim Ostergottesdienst segnen ließ, sie verliehen dann Gesundheit. Außerdem war es Brauch, dass die Mädchen des Dorfes am Ostermorgen, weit vor Sonnenaufgang, zum Bach gingen, um Osterwasser zu holen und sich im Bach zu waschen.
Das Wasser der Osternacht sollte den Mädchen ewige Jugend und Schönheit verleihen. Wer es trank, dem schenkte es Gesundheit, außerdem sollten geheime Wünsche erfüllt werden.
Die Mädchen mussten den Bach von Osten nach Westen anlaufen, durften nicht sprechen, nicht lachen und sich nicht umschauen, sonst erfüllten sich die Wünsche nicht und das Wasser verlieh auch keine Schönheit. Die Mädchen mussten dann ein Jahr warten, und es noch einmal versuchen.
Einmal hockten am Bach bereits einige besonders junge Mädchen und wurden dann von den Ankommenden belehrt: »Ihr seid noch viel zu jung, ihr müsst noch ein Jahr warten.« Die Mädchen am Bach protestierten ihrerseits lautstark, bis sie bemerkten, dass sie alle gesprochen hatten, und sämtliche Anwesende brachen in ein großes Gelächter aus.
Nun mussten alle ein weiteres Jahr auf die Wirkung des Osterwassers warten. Die Mädchen am Bach, die ihr Wasser schon geschöpft hatten, gossen es aus ihren Tonkrügen wieder in den Bachlauf hinein, denn »Plapperwasser« hatte keine Heilkraft und verlieh keine Schönheit – sie waren umsonst so zeitig aufgestanden.
Manchmal lauerten die Lorbasse des Dorfes den Schönheiten auf, wenn die ihr Wasser in den schweren Krügen nach Hause trugen. Dann versuchten sie, die Mädchen zu erschrecken oder zum Lachen zu bringen, damit das Wasser seine Wirksamkeit verlor und die Mädchen vergeblich aufgestanden waren.
Dabei wollten die Mädchen doch gerade für diese Burschen besonders schön werden, denn oft hatte sich eines der Mädchen ihren zukünftigen Begleiter bereits ausgesucht.
Manche Bauern trieben sogar ihr Vieh am Sonntagmorgen zum Bach, damit es das Osterwasser saufen konnte.
Man glaubte, dass die Tiere dann vor Krankheiten verschont blieben. Zu Hause verspritzt, sollte das Osterwasser sogar Ungeziefer fern halten.
Der Glaube an alte Überlieferungen war in den Menschen Ostpreußens tief verwurzelt und wurde von Generation zu Generation weitergegeben.
Am Ostermorgen gingen die beiden Frauen gemeinsam in die Kirche. Zum ersten Mal, seit Katharina die Vertretung des Kantors übernommen hatte, würde der Chor nach wochenlangem Proben beim Gottesdienst in ihrer Kirche singen. Katharinas Kollege, Herr Graudenz, sollte sie dazu auf der Orgel begleiten.
Die Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt und sogar auf der Treppe zur Empore, auf der ebenfalls alle Sitzplätze besetzt waren, standen die Leute in Zweierreihe.
Katharina war nun doch aufgeregt, denn mit so vielen Gottesdienstbesuchern hatte sie nicht gerechnet, obwohl Marie sie bereits darauf vorbereitet hatte.
Nachdem der Pfarrer einen Psalm aus dem Alten Testament verlesen hatte, sprach die Kirchengemeinde das ‘Gloria Patri’, »Ehr’ sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist …« Nach dem anschließenden Gebet und der Verlesung eines Episteltextes erklang das erste Lied des Chores »Nun freut euch hier und überall«, da waren die Kirchenbesucher mucksmäuschenstill und jegliche Anspannung fiel von Katharina ab. Der anschließenden Verlesung des Evangeliums folgte das Glaubensbekenntnis, das von der gesamten Kirchengemeinde stehend gesprochen wurde. Daran schloss sich das zweite Lied des Chores an »Freudenvoll ist meine Seele«, das Katharina bereits mit souveräner Leichtigkeit dirigierte.
Nach diesem Lied erfolgte die Osterpredigt.
Noch in die Besinnlichkeitsphase der Menschen hinein erklang ein festliches Orgelstück, das Herr Graudenz mit viel Inbrunst spielte.
Sehr still wurde es, als der Pfarrer der Gefallenen der Gemeinde gedachte und ein anschließendes Fürbittgebet sprach. Hin und wieder war in den Reihen Schluchzen zu hören, weil die Mütter und die Ehefrauen nun ganz besonders an ihre Söhne und Ehemänner dachten.
Das nächste Lied des Chores »Ich geh zu deinem Grabe« verstärkte diesen schwermütigen Augenblick besonders und das »Vater unser« der Kirchengemeinde erklang zunächst recht leise, erst allmählich erhöhte sich die Lautstärke.
»Jauchzet Gott in allen Landen« sang die Kirchengemeinde dann gemeinsam mit dem Chor, danach erteilte der Pfarrer allen Kirchenbesuchern seinen Segen.
Ein letztes Mal ertönte an diesem Morgen die Orgel, bei deren Klängen die Kirchengemeinde das Gotteshaus verließ und am Ausgang dem »Verein zur Pflege verwundeter Krieger« eine reichliche Kollekte bescherte.
Obwohl Marie Schimkus im Chor mitgewirkt hatte, war sie von dem Gottesdienst so ergriffen, dass ihr bei der Nennung des Namens ihres Mannes die Tränen rannen. Katharina hatte das bemerkt, sie konnte ihre Freundin jedoch in jenem Moment nicht trösten. Erst beim Verlassen der Kirche hakte sie sich bei ihr ein und drückte Maries Arm.
Wenige Minuten später war die Schwermut jedoch wieder von Marie Schimkus abgefallen und sie schlug Katharina vor, einen kleinen Spaziergang durch die Wiesen zu machen, bevor sie sich zu Hause den gebratenen Hahn schmecken ließen, den die Lehrerin noch am Gründonnerstagabend von einem Bauern geschenkt bekommen hatte, weil sie sich so sehr für den Kirchenchor engagierte.
Wenige Tage nach Ostern kam die Aufforderung, dass alle Kinder in der Schule Uniformen zu tragen hatten, die Jungs braune Uniformen, die Mädchen weiße, gestärkte Blusen und dunkle Röcke. Damit alle Kinder diese Uniformen kaufen konnten, durften sich deren Mütter beim Bürgermeister des Dorfes melden. Dort bekamen sie neben einer bestimmten Summe Geldes ein Bild von Adolf Hitler ausgehändigt, das gut sichtbar im Haus aufzuhängen war.
Mit dem Geld hatten die Mütter nun in Zinten die Uniformen zu kaufen, in denen die Jungs fast wie kleine SA-Männer aussahen, mit hellbraunem Hemd, schwarzer Hose und Lederkoppel. Zugleich mussten sie Mitglied beim Deutschen Jungvolk werden und durften sich »Pimpf« nennen.
Die Mädchen mussten sich dem BDM anschließen.
Oft wurden diese Uniformen nach der Schule gar nicht erst ausgezogen, sondern zweckentfremdet als Arbeitskleidung im Kuhstall benutzt.
Am Mittwoch kam ein Telegramm für Katharina. Der Postbote brachte es direkt in die Schule. Der jungen Frau drohten die Füße wegzusacken, denn sie ahnte Furchtbares. Mit zitternden Händen riss sie den Umschlag auf und drehte sich zur Seite, damit ihre Schüler nicht ihre Gemütsverfassung sehen konnten. Im Klassenraum war es mucksmäuschenstill.
Katharina las die wenigen Worte und ihr Gesichtsausdruck hellte sich schlagartig auf. Das waren keine schlechten Nachrichten, im Gegenteil, es war etwas ganz Schönes.
Bereits am Freitag wollte Mutter Kleinschmidt sie besuchen kommen. Katharina freute sich riesig. Das war damals nicht nur so von der Witwe dahingesagt, sie besuchte tatsächlich ihre Schwester und wollte von Elbing aus mit der Bahn über Braunsberg nach Heiligenbeil fahren und von dort aus mit der Kleinbahn über Deutsch Thierau nach Zinten. So hatten es die Frauen vor einigen Wochen besprochen. Da der Zug um fünfzehn Uhr zweiundvierzig in Zinten ankam, also nach Schulschluss, wollte Katharina versuchen, Mutter Kleinschmidt vom Bahnhof abzuholen.
Vielleicht hatte jemand aus dem Dorf zufällig etwas in der Stadt zu besorgen, sie würde sich da schon etwas einfallen lassen.
Noch immer war es im Klassenraum still, weil sich auf der Stirn der Lehrerin vom Nachdenken Falten gebildet hatten und die Kinder falsche Schlüsse zogen. Erschrocken legte die Lehrerin das Telegramm zur Seite und rief: »Es ist alles in Ordnung, Kinder. Ich bekomme am Freitag lieben Besuch aus Berlin und hatte gerade überlegt, wie ich zum Bahnhof komme, um meinen Besuch abzuholen, aber lasst uns nun weitermachen.«
Der Freitag kam schneller heran, als die junge Frau eine Lösung für ihr Problem gefunden hätte.
Kurzentschlossen nahm sie ihr Fahrrad und schob es auf die Straße, um wenigstens das Gepäck für Mutter Kleinschmidt von Zinten transportieren zu können, als plötzlich ein Pferdewagen vor dem Hoftor hielt.
»Tachche, ich habe geheert, dass Sie ejne Fahrjelejenhejt nach Zinten suchen. Wenns recht ist, kennse mit mir mitfahrn, ich hett was in de Stadt zu besorjen. Dauert auch nich lange und zurick kennse auch wieder mitfahrn.«
Der Bauer Kruschat lud Katharina vom Kutschbock seines Pferdewagens aus mit einer Handbewegung ein, zu ihm auf den Bock zu steigen. Erfreut stimmte sie zu, rollte ihr Fahrrad wieder in den Schuppen und beeilte sich, auf den Kutschbock zu steigen. Unterwegs erfuhr sie vom Bauern, dass sein Enkel den Opa um diesen Gefallen gebeten hatte, als der erfuhr, dass der Opa in die Stadt fahren wollte.
Die Pferde zogen den leichten Wagen flott in die nahe Stadt und die Lehrerin hatte sogar noch einige Minuten Zeit bis zur Ankunft des Zuges. Als der Zug am Bahnhof einfuhr, war Katharina aufgeregt. Sie freute sich riesig über den Besuch von Mutter Kleinschmidt, fast als würde ihre eigene Mutter sie besuchen kommen.
Der Bahnsteig war mit Menschen vollgestopft, die nach Preußisch Eylau oder gar nach Bartenstein fahren wollten, und Katharina befürchtete schon, Mutter Kleinschmidt zu übersehen.
Dementsprechend hoch war die Freude, als Katharina die ältere Frau aus dem Zug steigen sah, in der linken Hand einen kleinen Koffer.
»Jottchen nee, is det een Jedränge«, rief ihr die Frau statt einer Begrüßung zu, doch als Katharina in Reichweite war, riss Frau Kleinschmidt die junge Frau an sich, küsste sie auf beide Wangen und rief: »Tachchen meene Kleene, lass dir umarmen. Wat hab ick mir uf dir jefreut. Jut siehste aus, nich mehr so spittelig wie bei deinen ersten Besuch.«
Katharina lachte und zog Mutter Kleinschmidt aus der drängenden Masse auf den Bahnhofsvorplatz.
»Wir haben Glück, Mutter Kleinschmidt, wir werden gleich von einem Pferdewagen abgeholt, der uns nach Loditten mitnimmt. Einer meiner Schüler hat seinen Großvater darum gebeten.«
»Da musst du ja bei deinen Schülern ziemlich beliebt sein«, mutmaßte Frau Kleinschmidt.
»Hm, das ist relativ. Die einen können mich immer gut leiden und die anderen nur, wenn ich ihnen keine schlechten Zensuren verpasse«, lachte die Lehrerin.
Inzwischen fuhr Herr Kruschat mit seinem Gefährt auf dem Bahnhofsplatz vor, begrüßte die vornehm aussehende Frau höflich und lud das Gepäck der Berlinerin auf den Wagen. Dann half er der Dame sogar auf den Kutschbock hinauf. Auch die junge Frau setzte sich mit auf die Bank, die für drei Leute natürlich ein wenig eng war.
»Hast du genug Platz?«, fragte Katharina ihren Gast besorgt.
»Na ja, erst sitzt man wie eene Sprotte inne Dose im Zug und nu isses ooch nich ville besser. Aba wie sagt man doch imma, besser schlecht jefahren als jut jeloofen. Nee, nee, lass man, det is schon in Ordnung. So eene Fahrt of dem Kutschbock is ja ooch mal scheen. Man kann viel mehr sehen, als aus dem Auto und die Pferdchen sehen so hübsch aus.«
Bauer Kruschat nahm dies als Lob und schmunzelte vor sich her.
Die Begrüßung durch Marie Schimkus war zunächst etwas steif. Sie hatte ein wenig Berührungsangst vor der vornehm gekleideten Frau, doch die nahm Marie gleich den Wind aus den Segeln.
»Tach, ick bin die Frau Kleinschmidt aus Berlin und Sie sind also die Frau Schimkus, von der unse Kleene so schwärmt. Det is schön, det wir uns ma kennen lernen. Katharina lobt Ihren Kuchen in den höchsten Tönen und ick bin doch so eene olle Kaffeetante. Keen Tach bei mir ohne Kaffe und Kuchen.«
Das war das Stichwort für Marie. »Na, dann nehmen Sie mal Platz, ich habe nämlich für uns eine Eierlikörtorte gebacken.«
»Na, det is een Wort, da saje ick nich nee«, verkündete Frau Kleinschmidt erfreut und alle Dämme waren gebrochen.
Bis auf den für Marie gewöhnungsbedürftigen Dialekt, wurde es eine sehr lustige Gesprächsrunde und was Marie nicht auf Anhieb verstand, wiederholte Frau Kleinschmidt bereitwillig noch einmal auf Hochdeutsch, und das war sogar für Katharina neu.
Der nächste Tag war der 1. Mai, ein Samstag. Die Sonne strahlte und der Tag versprach, wunderschön zu werden. Bereits am Frühstückstisch beschlossen die drei Frauen etwas zu unternehmen.
Am Vormittag machten sie einen Spaziergang durch das Dorf. Jeder Hofeingang war von zwei kleinen Birken flankiert, die in mit Wasser gefüllten Einmachgläsern standen. An den Zweigen spross das erste zarte Grün. Die Bäumchen waren ein Frühlingsgruß und ein Zeichen für die Menschen, dass der harte Winter nun gottlob vorbei war.
Am Mittagstisch verriet Marie den beiden Frauen, dass es nach dem Essen eine Überraschung geben würde.
Marie führte die beiden Frauen wenige Minuten später zum Dorfplatz, auf dem mehrere Kremser standen und die Dorfbewohner zu einer Fahrt abholten. Die Kremser waren mit Birkengrün und bunten Bändern geschmückt und es ging auf ihnen bereits hoch her.
Frauen schnatterten wie die Enten und die Männer unterhielten sich ebenfalls lautstark. Da dampften die Knösel, aber auch Zigarren wurden von den Männern geraucht, deren Qualm die schöne Frühlingsluft »verpestete«, wie Mutter Kleinschmidt leise anmerkte.
Die Fahrt ging vorbei an Wiesen und durch Wälder zum Arnsteiner See. An der Gaststätte »Zum goldenen Hecht« wurde Halt gemacht, denn dort gab es die weithin bekannten leckeren Eierflinsen mit verschiedenster Füllung und Beilage.
Sowohl Frau Kleinschmidt, als auch Katharina hatten so gute Flinsen noch nie gegessen, das mussten sie zugeben, als sie nach einer guten Stunde wieder aufbrachen.
Diese Überraschung war Marie gelungen.
Auf den Kremsern ging der Machandel reihum und sorgte für Frohsinn. Schließlich stimmten die Mitglieder des Chores das Lied: »Hab’ mein Wagen vollgeladen« an. Alle sangen mit, und die Stimmung erreichte bald ihren Höhepunkt. Witze machten die Runde und heiterten die Leute auf.
Der preußische Humor war manchmal hintersinnig und auf jeden Fall sprichwörtlich.
Einmal schrieben zum Beispiel die Gumbinner Stadtbewohner, die sich über den anrüchigen Namen des Flusses »Pissa« ärgerten, der durch ihre Stadt fließt, ein Gesuch an ihren König Wilhelm IV. und fragten untertänigst, ob sie ihren Fluss umbenennen dürften.
Der König ließ dem Bürgermeister Gumbinnens antworten: »Umbenennung genehmigt, schlage meinerseits vor, den Fluss »Urinoko« zu nennen.«
Humor also auch bis in die höchsten Kreise.
Noch vor dem Sonnenuntergang kehrten die Kremser nach Loditten zurück und alle Beteiligten waren übereinstimmend der Meinung, dass dies ein sehr schöner Ausflug war.
Einige der Männer hatten allerdings noch nicht genug vom Frohsinn und vom Machandel und steuerten das Gasthaus an. Dort wurde dann ein »Kehlwaschtag« abgehalten, doch da der nächste Tag ein Sonntag war, konnten die Männer ihren Rausch ausschlafen.
Mutter Kleinschmidt konnte vier Tage bleiben, ehe sie wieder zu ihrer Schwester nach Elbing zurückfuhr.
Marie und Katharina zeigten ihr die Stadt Königsberg und machten eine Dampferfahrt auf dem Frischen Haff, dann war der kurze Urlaub schon wieder vorbei.
Obwohl Marie heftig protestierte, hatte es sich Frau Kleinschmidt nicht nehmen lassen, im Haushalt mitzuhelfen. Die drei Frauen verstanden sich bestens und aus der anfänglichen Eifersüchtelei um Katharina war in kürzester Zeit eine Zuneigung zwischen Marie und Mutter Kleinschmidt entstanden.
Beim Abschied flossen sogar Tränen und wenn auch das Versprechen gegeben wurde, sich gegenseitig zu besuchen, machte die voranschreitende Kriegsentwicklung das Versprechen doch ziemlich fraglich, denn niemand konnte deren weitere Entwicklung vorhersehen.
Katharina bat Mutter Kleinschmidt inständig, vorsichtig zu sein, und die Frau antwortete in ihrer unnachahmlichen Art:
»Ja, ja, ick werde uffpassen, det ick nich über meene Beene stolpere. Mehr kann ick nich machen, außer zu hoffen, det mir der Tommy nich eene Bombe offs Dach haut.«
Obwohl Katharina betrübt war, dass Mutter Kleinschmidt nun wieder fort fuhr, musste sie über ihre Worte lachen.
Der Abschied auf dem Bahnhof war für beide Frauen sehr schwer. Frau Kleinschmidt hatte das Mädchen lieb gewonnen und befürchtete für beide eine ungewisse Zukunft, allerdings wusste sie die junge Frau bei Marie gut aufgehoben.