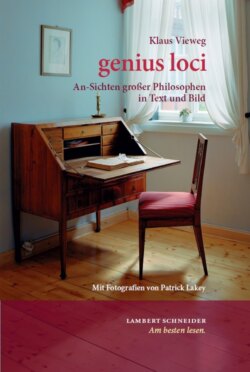Читать книгу genius loci - Klaus Vieweg - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Friedrich Schiller ‚Das Reich der Vernunft ist ein Reich der Freiheit‘ –
Schillers ‚philosophische Bude‘ in Jena
ОглавлениеDrunten liegst du im Tal, auf sonnigen Höhn wächst die Ernte
weinreicher Gärten dir zu: Glück dir dein Name verheißt.
Sei den Studien gewogen, die Kunst und Wissenschaft zeugen,
besser und günstiger fällt wahrlich nimmer dein Los.
Unter der Wissenschaft Schutz erweiterst du Macht dir und Ansehn,
dank ihrer Güter wirst du glückliches Jena genannt.
Auf die Stadt Jena von Professor Johannes Stigel, Hymnus auf die Universitätsgründung in Jena 1558
Wenn man ‚im heutigen Jena umherstreift, so entdeckt man bald an vielen Häusern viereckige kleine Steintafeln, die über Türen eingemauert sind; sie versetzen uns in eine Zeit dieser Stadt zurück, in welcher sie die regste Werkstätte deutscher Kunst und Wissenschaft war, denn wir lesen auf jenen bescheidenen Denksteinen die Namen der großen Geister, die hier zwei Decennien hindurch, den tiefsten Schöpfungen der Phantasie und des Gedankens sich in glühendem Wetteifer widmeten – hier in diesem Gasthof Zur Sonne hatte Goethe sein Absteigequartier, in jenen Häusern wohnten Reinhold, W. v. Humboldt und Fichte, in jenem Zimmer des ersten Stockes eines Eckhauses schrieb Hegel die Phänomenologie des Geistes, hier in diesem Garten dichtete Schiller seinen Wallenstein‘ (K. Rosenkranz).
Im Mai 1797 zog Schiller mit Familie für die Sommermonate in diese ‚Laube‘, gelegen am Flüsschen Leutra, vor den Toren Jenas, mit schönster Aussicht aus der Mansarde, im Garten gedeihen Blumen und Spargel, Zwetschgenbäume sowie Apfel- und Birnquitte. Der von Schiller als besonders angenehm empfundene Duft von überreifen Äpfeln durchzog das Haus. Den Garten zierten ein alter Steintisch, an welchem es die „Butterbrodgesellschaften“ gab und mit Goethe „manches gute und große Wort miteinander gewechselt“ wurde, sowie ein über Treppen zu erreichendes zweites Schreibzimmer, in welchem er am Wallenstein arbeitete – die „schöne Gartenzinne, von wannen er der Sterne Wort vernahm“ (Goethe). Im benachbarten Gasthof Zum Gelben Engel trafen sich Professoren wie Schiller, Niethammer, Fichte und Schelling zum Wein aus Frankreich oder Madeira, aus Franken oder dem Rheinland, das ‚ganze Gebiet des menschlichen Wissens wird bacchantisch taumelnd durchwandert‘, ähnlich Hegels phänomenologischer Entdeckungsreise ins Wissen. Schillers Refugium außerhalb der Stadtmauern zählt zu den in Jena hochgeschätzten ‚philosophischen Gärten‘, neben dem Garten von Griesbach und dem am Gebäude Zur Rose, neben Spaziergängen, Fahrten in die Umgebung oder winterlichen Schlittenfahrten war der Jardin philosophique eine beliebte Freizeitbeschäftigung.
Für Schiller war Mitte der 90er-Jahre das poetische Schaffen wieder ganz ins Zentrum seiner Tätigkeit gerückt, schon 1795 berichtete er an Goethe, dass er „die philosophische Bude schließe“, sechs Jahre nach dem spektakulären Debüt an der Jenaer Academie. Am späten Abend des 26. Mai 1789 war diese ‚Bude in Jena‘ eröffnet worden. Man konnte in der Saalestadt eine Nachtmusik der Studenten hören, es wurde von ihnen dreimal Vivat gerufen – eine Novität für die altehrwürdige hohe Schule und dies zu Ehren der akademischen Antrittsrede von Friedrich Schiller Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? Die Vorlesung des neu berufenen Professors der Philosophie beschreibt in eindrucksvollen Worten die „Weltgeschicht als Weltgericht“ und zeichnet eine faszinierende und zeitlos geltende Charakteristik des Brotgelehrten, die ins Stammbuch aller Nachfolger auf Lehrstühlen geschrieben werden sollte. Dieser Brotgelehrte behindert den Fortgang im Reiche des Wissens am heftigsten, mit Erbitterung und Heimtücke jagt er nach Ehrenstellen statt nach „Gedankenschätzen“, er giert nach „Zeitungslob und Fürstengunst“, er gleicht der „Hyäne Eigennutz“, Dienstwege sind ihm wichtiger als Denkwege, es gibt keinen „unversöhnlicheren Feind“ der Wissenschaft, keinen „bereitwilligeren Ketzermacher“. Mit diesem fulminanten Auftritt begann das für Schiller kreativste Dezennium seines Schaffens; für zehn Jahre prägte er das intellektuelle Geschehen in der ‚Stapelstadt des Wissens‘ wesentlich mit und schuf einen unschätzbaren Beitrag zur klassischen Literatur und Philosophie.
Der 1759 im schwäbischen Marbach am Neckar geborene Schiller hatte sich schon vor seiner Jenaer Zeit im literarischen Betrieb einen außerordentlichen Namen erworben, besonders mit einer Reihe seiner Dramen von den Räubern bis zum Don Carlos, im Sächsischen wird er das Lied an die Freude verfassen, das in seiner Vertonung durch Beethoven zu einer Art Hymne Europas avancierte. Aber der ehemalige Stuttgarter Medizinstudent konnte weder in Mannheim, Bauerbach, Dresden oder Rudolstadt bloß als Dichter seinen Lebensunterhalt bestreiten. Die Buchhonorare waren nicht sehr üppig, es gab in Deutschland noch kein elaboriertes Urheberrecht und die geistige Piraterie war gang und gäbe. Der junge Poet sprach deshalb von der ‚Schriftstellergaleere‘, ähnlich wie Hegel über seine Redakteurstätigkeit in Bamberg von der ‚Zeitungsgaleere‘.
„Noch nie ist mirs in einem fremden Orte so behaglich gewesen“, wie in „einer ziemlich freien und sicheren Republik“ – so die Hommage an Jena nach seiner ersten Stippvisite im Sommer 1787. Das war etwas voreilig und blauäugig; nach seinen ersten Wochen an der Saale fühlt sich der Dichter „wie an eine fremde Küste verschlagen und die Sprache des Landes nicht verstehend“. Die „grimmigen Gesichter der Gelehrten verscheuchen alles, was Freiheit und Freude athmet“. Trotzdem würde ihm kein anderer Ort das sein, was ihm Jena bedeutet, nirgends könne er eine so „wahre und vernünftige Freiheit“ genießen. Nachdem es im September 1788 in Rudolstadt ein noch geistig wenig folgenreiches Treffen mit Goethe gab, wird Schiller im Revolutionsjahr 1789 an die Alma Mater Jenensis berufen; man hatte ihm eine Professio Philosophiae extraordinaria angedeihen lassen. Obschon er ein distanziertes Verhältnis zur Revolution der Franzosen hatte, ernannte der Pariser Nationalkonvent 1792 den Poeten zum Citoyen der französischen Republik: Der Schöpfer des Don Carlos habe durch seine „Schriften und seinen Mut der Sache der Freiheit gedient und die Befreiung der Völker vorbereitet“, so das Begleitschreiben des französischen Innenministers Jean Marie Roland de La Platière.
Obschon er die hochgebildete und geistreiche Caroline von Beulwitz wohl mehr liebte, heiratete Schiller 1792 deren Schwester Charlotte von Lengefeld in der kleinen Kirche von Wenigenjena, in der heutigen ‚Schiller-Kirche‘, die Trauung erfolgte echt schillersch durch einen ‚Kantischen‘ Theologen. Der Neuberufene war ganz in der Saalestadt angekommen und doch begann mit seiner schweren Erkrankung schon Ende 1790 auch die Tragik seines Lebens. Ungeachtet des riesigen Handicaps einer damals nicht heilbaren Krankheit – wie Prometheus an den Felsen des Leidens gekettet – steuerte Schiller mit schier übermenschlicher Anstrengung Entscheidendes zum Aufstieg Jenas zur geistigen Metropole Europas bei, nicht nur auf seinem Hauptterrain der Dichtung, sondern auch auf dem Gebiet der Philosophie. Nach seiner Lektüre der Kantischen Kritik der Urteilskraft gibt er kund, dass „die alte Lust zu Philosophie wieder erwacht sei“. Die metaphysisch-kritische Zeitepoche, welche besonders in Jena herrschte, habe ihn ergriffen. Schiller erkannte die Einmaligkeit dieser geistigen Situation und beschloss ein aktives Eingreifen: „Was man von der Minute ausgeschlagen, gibt keine Ewigkeit zurück“.
Der philosophierende Poet gehörte zu den wichtigen Stimmen in der produktiven intellektuellen Gemengelage von Jena, zum durchaus heterogenen Kreis der dort ansässigen ‚Kantischen Evangelisten‘, dessen Spektrum vom Protagonisten der ‚Philosophie ohne Beinamen‘ Reinhold über die schwäbischen Landsleute Niethammer und Immanuel Carl Diez, den scharfsinnigen Medizinerkollegen Johann Benjamin Erhard, den Klagenfurter Baron von Herbert bis zu den Alt- oder Buchstabenkantianern Schmid und Schütz reichte. Es tobte nun der Streit darüber, wer als ‚wahrhaftiger‘ Kantianer gelten könne. Schiller ist „ganz in den Geist des Kantischen Systems eingedrungen“ (Erhard) und votierte für ein ‚neues Evangelium‘ aus dem Geiste Kants – ‚wer da (an die Königsberger Erleuchtungen) glaubt, der wird selig, wer aber nicht glaubt, der läßt es bleiben‘, so sein ironischer Kommentar über das Warten mancher Buchstabentreuer auf die allerneuesten Verlautbarungen aus Königsberg. Die Resultate seines philosophischen Nachdenkens finden sich in besonders treffender Weise in den 1795 veröffentlichten Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen; der Dichter hingegen sah in dieser Schrift sein philosophisches ‚Meisterwerk‘. Mit fast den gleichen Worten feierte der junge Hegel diese Abhandlung: „[D]er Aufsatz über die ästhetische Erziehung des Menschengeschlechts ist ein Meisterstück“. Ungeachtet seines Lobpreises sah Hölderlin allerdings die ‚Kantische Grenzlinie‘ nicht konsequent und nicht ausreichend überschritten.
Die Briefe sollen auf ‚Kantischen Grundsätzen‘ ruhen und doch versuchte der ‚rechtgläubige Kantianer‘, eine darüber hinausgreifende Konzeption vorzulegen. Freiheit bleibt das Leitmotiv; der Mensch müsse ‚endlich als Selbstzweck geehrt und die wahre Freiheit zur Grundlage der politischen Verbindung gemacht werden‘. Das „vollkommenste aller Kunstwerke“ bestehe im „Bau einer wahren politischen Freiheit“. Der moderne Staat gleiche aber einem ‚künstlichen, lichtscheuen Uhrwerk‘, zusammengestückelt aus ‚unendlichen, aber leblosen Teilen‘. Als solcher Mechanismus, als Machwerk des trockenen Verstandes bleibe der Staat seinen Bürgern fremd. Deshalb müsse das ‚Werk der Not in ein Werk der freien Wahl des Menschen umgeschaffen werden, denn ein Werk blinder Kräfte besitze keine Autorität, vor welcher die Freiheit sich zu beugen brauchte‘. Und mit dem ihm eigenen Pathos rief Schiller aus: „Das Reich der Vernunft ist ein Reich der Freiheit, und keine Knechtschaft ist schimpflicher, als die man auf diesem heiligen Boden duldet.“ In Berufung auf den ‚Riesen‘ Rousseau und auf Fichtes berühmte Jenaer Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten – die Bestimmung des Menschen, insofern er bloß nach dem Begriffe des Menschen überhaupt als vernünftiges Wesen gedacht wird – offerierte Schiller seine Version des Universalismus: Jeder individuelle Mensch hat der Anlage und Bestimmung nach den ‚idealischen Menschen‘ als unveränderliche Einheit in sich, welche durch den Staat repräsentiert wird. Schiller „zerstörte die geistigen Bastillen, er baute an dem Tempel der Freiheit, und zwar an jenem ganz großen Tempel, der alle Nationen gleich einer einzigen Brüdergemeinde umschließen soll“ (H. Heine). Den Pfad zu dieser Freiheit sollen nun die Kunst und die Schönheit bahnen, die Schönheit sei es, so der Jenaer Dichter, durch ‚welche man zur Freiheit wandert‘. Damit hat sich Schiller ein schwer zu lösendes Problem eingehandelt, nämlich die Fixierung der zwei Polarsterne Freiheit und Schönheit, die Spannung zwischen der ‚Ästhetisierung‘ der Philosophie bei gleichzeitiger Beibehaltung des Kantischen Freiheitsgedankens, eine Crux, die durch das Konzept des ästhetischen Staates aufgelöst werden soll. Ist die Architektonik des Staates das vollkommenste Kunstwerk und die Kunst eine ‚Tochter der Freiheit‘ oder sind die Kunstwerke selbst das höchste Lebensprinzip? Vielleicht ist es gerade die Dichtkunst, die ähnlich der Hegel’schen Eule der Minerva ihren erhabenen Flug mit den Schwingen des Genies beginnt, die ein „Licht ist, das gern aus der Finsternis schimmert“ (Schiller). – Gemäß dem Goethe’schen Motto: ‚Frei will ich sein im Denken und im Dichten, im Handeln schränkt die Welt genug uns ein‘.
Die Hölderlin zufolge unzureichenden Grenzverletzungen Schillers im Kantischen Reich werden jedenfalls in den Briefen sichtbar. Der Philosoph als der große ‚Scheidekünstler‘, der Meister der Unterscheidung, muss, so Schiller, die Natur, die, flüchtige Erscheinung schöner Körper in Begriffe zerfleischen und in einem dürftigen Wortgerippe ihren lebendigen Geist aufbewahren‘. Indem der spekulative Geist eines Kant oder Fichte im ‚Ideenreiche nach unverlierbaren Besitzungen strebte, mußte er ein Fremdling in der Sinnenwelt werden‘. Deswegen soll eine Einheit, eine ‚Zwitterart zwischen Begriff und Anschauung, zwischen Leben und Räsonnement‘ gesucht werden und die Natur ‚zum Freunde des gebildeten Menschen‘ erhoben werden. Darauf zielte das Schiller’sche Theorem einer Vereinigung von Stoff- und Formtrieb im Spieltrieb, in einem reinen Vernunftbegriff der Schönheit, in einem ästhetischen Zustand, geprägt von einer Wechselwirkung zweier entgegengesetzter Prinzipien: „[D]er Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“ Im reinen Vernunftbegriff der Schönheit entdeckte Schiller das Absolute und Bleibende der „wandelbaren Erscheinungsarten“, die Symbiose von Einheit und Veränderung. Die Bahn von den „strengen Fesseln der Logik“, von der ‚leeren Subtilität eines kalten Herzens‘ hin zum „freien Gang der Dichtungskraft“ wurde gebahnt, die exorbitante Rolle der Kunst fixiert, allerdings auf Kosten des philosophischen Denkens, der anvisierte Weg via Schönheit zur Freiheit bleibt unbestimmt. Schon 1795 wird der wieder euphorisch auf das Gebiet der Kunst einschwenkende Schiller den Poeten zum ‚einzig wahren Menschen‘ stilisieren, der beste Philosoph hingegen sei „nur eine Karikatur“ gegen den Dichter.
Zu dieser Kehre hatte auch der seit dem legendären Treffen im Kirsten’schen Hause am Jenaer Markt 1794 einsetzende legendäre ‚Ideen-wechsel‘, das Sym-Poetisieren und Sym-Philosophieren von Schiller und Goethe beigetragen. Während der ‚Idealist‘ Schiller zunächst in Goethes Metamorphose keine Erfahrung, sondern eine Idee sah und dem ‚Realisten‘ Goethe vorhielt, dass er zu viel aus der Sinnenwelt betaste, räumte der Jenaer Professor jetzt ein, dass ihm ‚zu der spekulativischen Idee das Objekt, der Körper‘ fehlte, wie die Kantianer sei er „undankbar gegen die große Mutter Natur“ (Goethe). Die philosophische Werkstatt wurde fast vollständig zugesperrt und die Kunst trat wieder ins Zentrum seines Schaffens; es entstehen die eindrucksvollen Balladen, die Xenien, die Dramen Wallenstein und Maria Stuart. 1794 begann das Zusammenwirken der beiden ‚Klassiker‘ der deutschen Literatur, dabei wird Goethe zumeist Gast in Jena sein und nicht nur zu Ostern, wenn die Saale vom Eise befreit ist, mit dem Dichterfreund im Jenaer Paradiespark spazieren. Dort, nicht weit entfernt vom Gartenhäuschen an der Leutra, konnte man illustrer Gesellschaft begegnen, den vom Dichter hoch geschätzten Brüdern Humboldt, den Transzendentalphilosophen Fichte und Schelling, aber auch den ungeliebten Romantikern und Schiller-Kritikern wie Novalis und den Brüdern Schlegel.
Im Mai 1797 zog Schiller für die Sommermonate in das damals noch vor den Toren Jenas gelegene Gartenhaus.
[Garden House 3, Jena, Germany]
Im Rückblick auf seine philosophischen Lehr- und Wanderjahre schätzte Schiller die „metaphysisch-kritische Zeitepoche“ als ein Stück seines Nachdenkens ein, als eine „notwendige Entladung der metaphysischen Materie […] die wie das Blatterngift in uns steckt und heraus muß“. Natürlich ist ‚grau alle Theorie und grün des Lebens goldener Baum‘ (Goethe), natürlich malt der Philosoph grau in grau (Hegel), nur kippte damit die kritische Sicht Schillers auf das Philosophieren in eine hochmütige Abkanzelung um. Die ‚kahlen Sandbänke trockener Abstraktionen‘, die „unfruchtbaren Steppen der Spekulation“, die „hohlen Formeln“ werden jetzt gegeißelt – ‚auf diesem kahlen Gefild des Philosophierens und Theoretisierens findet er keine lebendige Quelle, keine Nahrung mehr‘. Natürlich war sein dichterisches Talent unbestreitbar bedeutender, aber er beschreibt seine früheren metaphysischen Übungen, sein Herumplagen mit Prinzipien zu Unrecht als dilettantisch. Schillers dichterisches Werk seit 1795 ist jedoch ohne diese Gedankenwelt nicht vorstellbar und schließt direkt daran an.
Philosophisch haben drei Jenaer Koryphäen dieser Zeit entscheidende Anregungen durch Schillers Briefe gewonnen – das wohl von Hölderlin, Schelling und Hegel konzipierte sogenannte Älteste Systemprogramm des Deutschen Idealismus atmet unzweifelhaft auch den Schiller’schen Geist: Ziel bleibt die Freiheit als Idee, die absolute Freiheit aller Geister. Der Staat als etwas ‚ Mechanisches‘, als Maschine, als ‚mechanisches Räderwerk‘ soll überwunden werden. Die Idee des alles Vereinigenden liegt in der Idee der Schönheit, der höchste Akt der Vernunft ist ein ästhetischer Akt, Wahrheit und Güte sind in der Schönheit verschwistert, die Poesie wird die wahre und einzige Lehrerin der Menschheit. Die drei großen Tübinger werden eigenständig an die Schiller’schen Briefe anschließen und ihre neuen Entwürfe auch auf dieser Grundfeste bauen. Hegel beendet sein Schlüsselwerk der modernen Philosophie, die Phänomenologie des Geistes, das er ganz im Schiller’schen Sinne als Weltwanderung ins Wissen verstand, keineswegs zufällig mit einem leicht abgewandelten Wort aus Schillers Ballade Die Freundschaft:
aus dem Kelch dieses Geisterreiches schäumt ihm seine Unendlichkeit.
Heute stehen vor dem Hauptgebäude der Alma Mater Jenensis ein Hegeldenkmal und Danneckers Schiller-Büste traut nebeneinander. Den nächtlichen Disputen der beiden Jenaer Giganten würden manche wohl nur zu gern lauschen.
Innenansicht eines Zimmers aus dem ehemaligen Wohnhaus von Johann Gottlieb Fichte im thüringischen Jena.
[Fichte’s House, Jena, Germany]