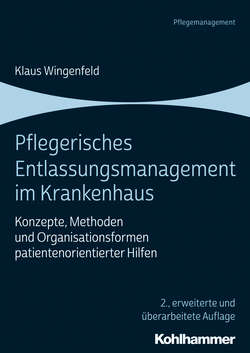Читать книгу Pflegerisches Entlassungsmanagement im Krankenhaus - Klaus Wingenfeld - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
P5/P6: Überprüfung des Stands der Umsetzung
ОглавлениеSpätestens 24 Stunden vor der Entlassung sollen alle Vorbereitungen noch einmal überprüft werden, um etwaige Probleme früh genug zu erkennen und zu bearbeiten bzw. die konkrete Maßnahmenplanung noch einmal anzupassen. Eine zweite Überprüfung soll nach den Vorgaben des Standards innerhalb von 48–72 Stunden nach der Entlassung folgen. Sie erfolgt durch eine Kontaktaufnahme mit dem Patienten und/oder seinen Angehörigen oder, beispielsweise bei demenziell erkrankten Heimbewohnern, mit der Einrichtung. Bei Bedarf wird das Entlassungsmanagement – im Rahmen seiner nunmehr recht eingeschränkten Möglichkeiten – noch ein letztes Mal tätig, um bei der Lösung unvorhergesehener Probleme mitzuwirken.
Diese Bausteine des pflegerischen Entlassungsmanagements werden im Hinblick auf ihre Funktionen und ihre inhaltliche Ausgestaltung näher beschrieben, der Standard verzichtet allerdings auf ganz konkrete Festlegungen. Er schreibt weder ein bestimmtes Organisationskonzept noch bestimmte Einschätzungsinstrumente vor. Anders gesagt: Der Standard beschreibt, welche Aufgaben dem pflegerischen Entlassungsmanagement zuzurechnen und welche Strukturen erforderlich sind, aber bei der Umsetzung müssen alle Bausteine von den Krankenhäusern selbst noch einmal durchdacht, konkretisiert und im Detail ausgearbeitet werden. Dazu gehören vor allem die Entscheidung für eine bestimmte Organisationsform, die Definition von Kriterien für das initiale Assessment und die Entwicklung und Umsetzung von Anleitungskonzepten.
Damit lässt der Standard den Krankenhäusern recht viel Spielraum, ein Konzept zu entwickeln, das auf ihre besonderen Organisationsstrukturen, ihre Patienten und die verfügbaren Ressourcen zugeschnitten ist. Dies kann den Umgang mit dem Standard einerseits erleichtern. Andererseits hat das Fehlen von Festlegungen zur Konsequenz, dass die Krankenhäuser bzw. die dort zuständigen Mitarbeiter selbst eine ganze Reihe von Entwicklungsarbeiten leisten müssen. Diese Arbeiten betreffen nicht allein den Zuständigkeitsbereich der Pflege, es bedarf auch vieler Absprachen mit anderen Berufsgruppen, insbesondere mit den Ärzten und den Mitarbeitern des Krankenhaussozialdienstes. Der Aufbau eines professionellen pflegerischen Entlassungsmanagements ist daher im Regelfall nicht innerhalb von ein oder zwei Monaten zu leisten.
Die wichtigsten Bereiche, in denen die Krankenhäuser Festlegungen treffen und Entwicklungsarbeiten leisten müssen, sind:
• Festlegung eines Organisationskonzepts, mit dem definiert wird, wer für das pflegerische Entlassungsmanagement zuständig ist,
• Arbeitsteilung und Formen der Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Berufsgruppen und den einzelnen Arbeitsbereichen (Fachabteilungen, Stationen) im Krankenhaus,
• Kriterien und Instrumente für das Assessment,
• Arbeitsmaterialien für den Alltag, insbesondere Dokumentationsinstrumente, mit denen beispielsweise die individuelle Maßnahmenplanung festgehalten werden kann,
• Konzepte und Arbeitshilfen für die Durchführung einzelner Schritte des Entlassungsmanagements, insbesondere für die Durchführung von Beratung und Anleitung.
Für diese Entwicklungsarbeiten existiert inzwischen reichhaltiges Material bei den Stellen, die das pflegerische Entlassungsmanagement schon seit vielen Jahren erfolgreich betreiben. Allerdings ist es empfehlenswert, Ansätze und Erfahrungen anderer Krankenhäuser kritisch zu prüfen und auf die Grenzen der Übertragbarkeit zu achten. Das gilt z. B. für Dokumentationsinstrumente oder Assessmentbögen, die in der Praxis des Entlassungsmanagements verwendet werden. Denn verglichen mit anderen pflegerischen Arbeitsfeldern ist das Entlassungsmanagement noch ein sehr junges Aufgabengebiet. Es wird noch immer viel experimentiert, und systematische Darstellungen von Erfahrungen gibt es bislang nur selten. Nicht alle Konzepte und Instrumente, die man in der Praxis vorfindet, sind empfehlenswert. Für ihre Prüfung und Anpassung sollte daher genügend Zeit eingeplant werden.
Es ist außerdem wichtig, dass beim Aufbau oder bei der Weiterentwicklung von pflegerischem Entlassungsmanagement auf Qualität geachtet wird. Bei Innovationen, die eine große Herausforderung darstellen, tendieren manche Krankenhäuser eher zu bequemen Lösungen. Das ist verständlich, weil heute die Ressourcen für alle Arbeitsbereiche in den Krankenhäusern knapp sind. Vermieden werden sollte aber auf jeden Fall, ein Entlassungsmanagement auf niedrigem Qualitätsniveau zu entwickeln. In dem durch Wettbewerb gekennzeichneten Gesundheitsbereich ist es manchmal einfacher, plakative, beeindruckende Formen der Außendarstellung mit modernen Medien zu entwickeln als die Kernprozesse in der Patientenversorgung zu verbessern. Kliniken sollten sich also lieber etwas mehr Zeit nehmen und die für sie anstehenden Entscheidungen oder Entwicklungsarbeiten sorgfältig vorbereiten.
Der Expertenstandard ist im Jahr 2009 in einer aktualisierten Fassung erschienen. Weitreichende Veränderungen gab es dabei nicht, sie blieben im Großen und Ganzen auf Konkretisierungen und die Klarstellung von möglichen Missverständnissen beschränkt. So enthielt der 2009 veröffentlichte Standard eine deutlichere Empfehlung für die Wahl zentralisierter Organisationsformen des Entlassungsmanagements, womit er dem aktuellen Stand der Forschung Rechnung trug. Der Risikogedanke, der für das professionelle Entlassungsmanagement charakteristisch ist, wurde ebenfalls stärker herausgearbeitet, und frühere Empfehlungen von Einschätzungsinstrumenten, die nicht für das Entlassungsmanagement entwickelt wurden, waren nicht mehr enthalten.
Im Jahr 2019 erschien eine nochmals überarbeitete Fassung des Standards. Auch in diesem Falle gab es keine substantiellen Änderungen an den Vorgaben des Standards für die Entlassung aus dem Krankenhaus. Allerdings führte auch diese Aktualisierung zu einigen neuen Akzenten. Die Bereitschaft der Patienten und auch der Angehörigen zur Krankenhausentlassung soll nach den Vorstellungen der Expertengruppe, die über die Aktualisierung des Standards entschieden hat, bei der Planung und Durchführung der Krankenhausentlassung, vor allem bei der Wahl des Entlassungszeitpunkts, besonders beachtet werden. Betont wird außerdem, dass auch bei internen Verlegungen die Versorgungskontinuität sichergestellt sein müsse.
Auffallend sind jedoch mehrere Unschärfen und offene Fragen, die in der zuletzt aktualisierten Fassung des Standards zum Teil durch Formulierungsschwächen, zum Teil durch angedeutete, aber nicht konkretisierte Hinweise in Detailfragen entstanden sind. Mitunter werden Begriffe nicht korrekt benutzt. »Transition« beispielsweise ist ein wichtiger Begriff aus Pflegetheorien und der sozialwissenschaftlichen Forschung, der weitreichende Veränderungen im Lebensverlauf bezeichnet (Meleis 2010, Wingenfeld 2005). Im aktualisierten Standard wird jedoch jeder Patiententransfer, z. B. die Verlegung zwischen zwei Krankenhausstationen, fälschlicherweise als Transition bezeichnet (DNQP 2019: 22). Krankenhausentlassung und interne Verlegung werden, wenn es um die Beschreibung von Schritten des Entlassungsmanagements geht, häufig in einem Atemzug genannt. Aber natürlich kann nicht gemeint sein, dass bei jeder internen Verlegung der komplette Prozess des Entlassungsmanagements vollzogen werden sollte, was zur unsinnigen Dopplung von Prozessen führen würde. Leider erweckt der Text gelegentlich diesen Anschein. Manche Probleme sind offenkundig auch bei der redaktionellen Bearbeitung übersehen worden.
Den Einrichtungen und Mitarbeitern, die mit dem Standard arbeiten wollen, sei empfohlen, sich durch diese Probleme nicht irritieren zu lassen und sich an die Kernaussagen des Standards zu halten. Aufgrund der Unschärfen bei den Formulierungen ist es aber im Falle dieser zweiten Aktualisierung besonders ratsam, den Text des Standards kritisch zu prüfen.