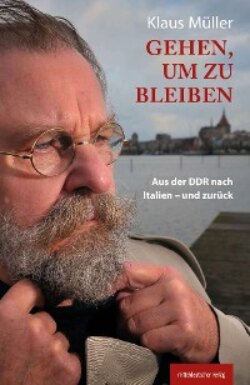Читать книгу Gehen, um zu bleiben - Klaus Muller - Страница 12
Segelsommer
ОглавлениеMit dem Anfang des Jahres 1983 begann auch mein Kursus zum Erwerb des Segelscheines für die Binnengewässer und die Seewasserstraßen, deren praktischen Teil ich am Zicker See schon abgelegt hatte. Der theoretische Teil zum Erwerb des Segelscheins wurde in einem Hörsaal der Rostocker Universität abgehalten, die Teilnehmer waren alle, wie ich meine, Universitätsmitarbeiter oder hiesige Studenten, ausschließlich männlichen Geschlechts.
Ein Dozent brachte uns Kursteilnehmern die theoretischen Grundlagen des Bootsbaus, der Meteorologie, der terrestrischen Navigation und der Segelkunde bei. Das Hauptgewicht der Veranstaltung lag aber auf den Bestimmungen des Seeverkehrs und der Betonung, speziell des Lateralsystems und den Besonderheiten des Grenzsystems an den Seegrenzen der DDR.
Mit einem kecken Unterton sagte der Dozent, mit erhobenem Finger: „Und vergessen Sie nie, die Sicherungskräfte der ‚Grenzbrigade Küste‘ haben das Recht der Nacheile, können also Grenzverletzer auch noch außerhalb der Staatsgrenze der DDR in internationalen Gewässern aufbringen und ihrer verdienten Strafe zuführen!“
Der Winter war noch nicht zu Ende, da hielt ich meinen Segelschein in den Händen, er war DIN A6 (Postkartengröße) groß und auf einem wachstuchähnlichen Gewebe aufgedruckt, den ich nun ständig bei mir in der Brieftasche trug.
Über den Winter 1982/83 war ich, nach einer 14-tägigen Schnellausbildung, als Filmvorführer im Rostocker Filmtheater „Capitol“ tätig, und dort wurde mir eine wichtige Erkenntnis für die Vorbereitung meines Vorhabens zuteil.
Die exakten Ränder des Leinwandbildes werden durch schwarze Stoffvorhänge bewirkt, welche die Leinwand umrahmen. Die äußeren Ränder des Lichtstrahls, der aus der Vorführmaschine in den Zuschauerraum auf die Leinwand fällt, werden durch dieses schwarze Tuch völlig absorbiert, das schwarze Tuch bleibt trotz Lichtstrahl schwarz. So sollten auch meine Segel wirken, wenn ich nachts über die Ostsee segeln würde.
Soweit die Tarnung der Segel gegen Scheinwerferlicht, doch wie stand’s mit dem Radar?
Radar war eine Zaubertechnik, mit der schon die Engländer während des Zweiten Weltkrieges deutsche U-Boote geortet hatten und die von der Sowjetunion und ihren Satrapen zur Aufbringung von Flüchtlingen aller Art genutzt wurde. Die Radartechnik in ihrer Wirkungsweise wurde in jenem Theoriekursus zum Erwerb des Segelscheins zwar erläutert, hauptsächlich aber in ihrer Unüberwindlichkeit angedroht. Es musste aber auch eine militärische Radartarnung geben, dachte ich mir, schaute daher in der militärtechnischen Abteilung der „Norddeutschen Buchhandlung“ in der Kröpeliner Straße in Rostock, in ein entsprechendes Lehrbuch, das für die Ausbildung der Marineoffiziere der „Volksmarine der DDR“ gedacht war und das ich sogar hätte kaufen können. In diesem Buch war tatsächlich ein ganzes Kapitel über Radartarnung vorhanden.
Mit heutigem Wissen muss ich sagen, dass dieses Lehrbuch noch veraltete Techniken unterwies. Immerhin hatte damals schon die US-Airforce ihre Steltbomber und entsprechende Überwasserschiffe, welche das Radar rein formgestalterisch zu unterlaufen suchten. Hier wurden aber Techniken aufgezeigt, die aus dem Zweiten Weltkrieg stammten, wo man die Aufbauten der Überwasserschiffe mit genoppten Gummiplatten belegt hatte, in der Hoffnung, so das gegnerische Radarbild zu stören. Die Erläuterung für die Wirkungsweise leuchtete mir aber ein.
Ich beschaffte mir also gummierten und genoppten Fußbodenbelag von einem Meter Breite, diesen schnitt ich in sieben Streifen von 20 bis 26 Zentimeter Länge, um den Mast von oben sieben Zentimeter bis unten neun Zentimeter Durchmesser belegen und mit einem Spezial-Kunststoff-Haftkleber anbringen zu können. Natürlich musste ich jeden dieser unterschiedlichen Streifen nummerieren und für die am Mast befindlichen Beschläge und die Anbringung mit verschiedenen Ausschnitten versehen.
Es wurde eine langwierige und komplizierte Arbeit, die ich während eines Aufenthaltes bei meinen Bekannten vom Segelverein in Groß Zicker bewältigte. Natürlich wurde die Anprobe der Noppenstreifen am Mast nachts vorgenommen, jeder Zuschauer hätte ja geahnt, was hier von einem „Straftäter“ gegen die DDR geplant wurde.
Die fertiggestellten und maßgerechten Tarnstreifen verpackte ich mit mehreren Büchsen des Spezialklebers und einer Büchse Lösungsmittel, Spachteln zum Bestreichen der Streifen und des Mastes sowie vier Schraubzwingen in einem größeren Plastesack und vergrub das auf dem Hügelkamm des Großen Zicker, exakt zwischen zwei großen Findlingen, die seit der letzten Eiszeit dort lagen. In den Ecken des Rasenausstichs, den ich mit einem Campingspaten gegraben hatte und nach dem Vergraben des Plastesacks wieder einsetzte, pflanzte ich zwei Strauchgewächse aus der Umgebung der Findlinge ein, damit ich das Vergrabene leichter wiederfinden würde, wenn ich es brauchte.
Das Ganze war natürlich eine Schnapsidee, wie ich bald bemerkte, denn das exakte Anbauen dieser Tarnung nur am Mast hätte ohne Tageslicht und ohne Helfer mindestens die halbe Nacht gedauert, und in dieser Zeit sollte ich schon weit draußen sein.
Zuvörderst musste ich aber erst einmal die xy-Jolle allein beherrschen lernen; dafür benötigte ich einen ganzen Segelsommer, ohne von schwerer und fortwährender Arbeit gestört zu werden. In Thiessow im Mönchgut, vis à vis von Groß Zicker, hatte ich einen Büffetleiterjob in einem größeren FDGB-Ferienheim im Blick, wollte das aber nur im Jobsharing betreiben, damit ich immer mal einige zusammenhängende Tage für meine Segelpraxis nutzen könnte. Ich hatte wieder Monsieur Bernard als Partner im Auge, musste aber bei telefonischer Anfrage in Berlin von seiner Mutter erfahren, dass der Bursche leider einsitzt. Er war bei seinem Militariahandel mit der staatlichen Außenhandelsorganisation KoKo des Schalck-Golodkowski in Konkurrenz geraten, hatte westdeutschen Interessenten gegen DM seine Erwerbungen verkauft, und das brachte ihm zwei Jahre Knast ein. Allein wollte ich den Prachtjob in Thiessow aber nicht übernehmen, ich gönnte mir daher einen Segelsommer gänzlich ohne Arbeit. Der Sommer 1983 wurde deshalb für mich auch zu einer perfekten Schule des Segelns. Ich war in allen mir zugänglichen Segelrevieren im heutigen Vorpommern mit meiner xy-Jolle unterwegs, bei jedem Wetter und zu jeder Tageszeit, auch nachts, obwohl das nicht erlaubt war, aber im Großen Jasmunder Bodden nicht kontrolliert und daher auch nicht verfolgt wurde.
Natürlich bin ich auch einmal gekentert, hatte vor Barhöft bei Starkwind aus West eine Halse gewagt, musste dann die relativ große Jolle wieder aufrichten und klitschnass zur Insel Ummanz segeln, wo ich die Jolle und mich selbst wieder in einen ordentlichen Zustand bringen konnte.
Eines anderen Vormittags kam vor der Halbinsel Zudar, bei der Ausfahrt vom Strelasund in den Greifswalder Bodden, ein solch heftiger Nordwest auf, dass ich es nicht wagte, mit einer Jolle im Einhand über das große Gewässer ins anzusteuernde Groß Zicker zu segeln, ich wollte daher bei Palmer Ort mit der Jolle an Land gehen.
Ich war schon gelandet, bei sommerlichen Temperaturen nur in Takelhose und barfuß, hatte die Jolle bereits halb an den Strand gezogen und wollte nun die nass gewordenen Klamotten abstreifen, um sie an Land trocknen zu lassen. Da sah ich, wie eine steife Böe die Jolle in die See trieb. Sofort die Klamotten vom Leib und dem Plasteboot hinterhergeschwommen. Ich konnte sie aber nicht mehr erreichen, war schon selbst in Gefahr, vom Strom hinausgetrieben zu werden. Also mit Kraft zurück an Land geschwommen und die noch feuchten Klamotten auf den Leib gebracht. Glücklicherweise war damit auch meine Brieftasche noch am Mann, mit Geld und allen Dokumenten. Nun fuhr ich über Mittag und Nachmittag jenes Tages barfuß in Bussen und mit der Eisenbahn über Stralsund und Greifswald nach Ludwigsburg an der dänischen Wieck. Von hier aus suchte ich bis zur Steilküste bei Loissin die Küste nach meiner Jolle ab. Dort fand ich tatsächlich das völlig verkrautete Plasteboot am Strand, es war vom Nordwest über den Bodden getrieben worden, konnte ja durch seine seitlichen Hohlkörper nicht untergehen und hatte auch kaum Wasser in der Pflicht.
Zuerst holte ich Schlafsack und Luftmatratze aus dem Heckschapp und baumelte sie an das Luvwant zum Austrocknen, dann säuberte ich den Bootskörper, was bis in die Nacht hinein dauerte. Nach diesem anstrengenden Tag, es war nun schon fast Mitternacht, legte ich mich in meiner wiedergefundenen und noch intakten Wanderjolle zur Ruhe. Der Tag war also nicht sonderlich glücklich gewesen, aber wiederum höchst lehrreich für mich.
Im Laufe dieses Sommers wurde mir klar, dass der Weg mit einer Jolle auf die offene Ostsee hinaus und an westliche Küsten nicht nach Osten, sondern von Hiddensee aus über die Priele an den Sandbänken vor den beiden Ausfahrten Bessin-Bug oder Gellen-Bock führte. Da die dänische Insel Møn von Dornbusch aus in fünfzig Kilometer Entfernung so verlockend zu sehen war, war mein erster Gedanke natürlich, den Weg nach Norden durch den Libben zu nehmen. Es lag nahe, vor dem Bessin über die Priele des Hahnentiefs in den Libben zu schlüpfen, von wo die Ostsee nach wenigen Meilen erreicht war. Seglerisch wäre das aber höchst kompliziert geworden. Ich hätte nachts auf einen Nordnordostwind warten müssen, der dann obendrein noch während der Nacht nach rechts hätte drehen müssen, damit ich bei anbrechendem Tageslicht weiter nach Norden gelangen konnte. Das war äußerst selten, es hätte bedeutet, dass der Kern des Tiefs sich hätte in westlicher Richtung bewegen müssen – was fast unmöglich ist – oder ein Azorenhochkeil sich nach Skandinavien ausbreitet, ohne Mitteleuropa zu berühren – auch selten. Aber zuerst musste ich persönlich überprüfen, ob vor der östlichen Spitze des Neubessin, der ja schon Sperrgebiet war, auch tatsächlich ein Priel verläuft. Bei der westlichen Spitze, dem Altbessin, konnte ich den Priel beim Törn nach Kloster zumindest sehen, wenn auch nicht genau erkunden.
Ich hatte also die Jolle für einige Tage an einem Liegeplatz nahe dem Hafen von Kloster festgemacht und genoss die herrliche Landschaft und die Strände des nördlichen Teils von Hiddensee. Der nördliche Teil des „Söten Lännekens“ ist landschaftlich zweifellos der schönste, wenn auch die Strände des südlichen Teils sich noch paradiesischer ausbreiten. Der über sechzig Meter hohe Dornbusch neigt sich sanft nach Süden und beschreibt in der West-Ostrichtung eine Biege, so dass hier, nach der Gemarkung Grieben zu, eine Kuhle entsteht, die zudem in der Leeseite der sommerlichen Hauptwindrichtung liegt. Verschlungene Wege lassen den Wanderfreund gemächlich am Hang hinabschreiten, nach der langgestreckten Halbinsel Bessin oder in den Ort Grieben. Der Dornbusch, eine Moräne aus der letzten Eiszeit, ragt also mächtig aus der flachen Insel empor, ist bei klarer Sicht schon von der Mole des Stralsunder Hafens zu sehen. Der Dichter Jot Es verglich ihn später mit einer erregten Klitoris.
Für mich waren diese Schönheiten an diesem Tage erst einmal zweitrangig; ich strebte aus dem Hafen von Kloster, zum Bessiner Strand, der sich zum Libben hin, also bis zur offenen Ostsee, erstreckt.
Eines Nachts, Ende Juni 1983, um die astronomische Mitternacht herum, ging ich am Strand des Bessin zum Libben hin nach dem Neubessin, jener Südspitze, die schon Sperrgebiet war. Tatsächlich verlief an dieser Stelle ein Priel, den eine Jolle mit Halbschwert durchaus hätte passieren können.
Am nächsten Vormittag lag ich wieder, mich sonnend, am Bessiner Strand, als eine Motorradstreife der Grenztruppen nahe am Wasser mein Blickfeld passierte. Ein Soldat im Kampfanzug schob keuchend ein Motorrad durch den Sand, und ein Offizier in Sommer-Dienstuniform stapfte voraus. Sie suchten den Strand bis zu jener Südspitze ab. Mir war klar, sie hatten mich in der vergangenen Nacht, trotz Finsternis, eventuell per Infrarotgerät von ihrem Kontrollpunkt auf der Halbinsel Bug aus gesehen. Der Weg nach Norden war also nicht ideal, wenn nicht gar unmöglich.
Ich überlegte nun, ob ich nicht vielleicht doch mittels Spezialtrailer die wenigen hundert Meter Land südlich von Neuendorf zwischen Bodden und Ostsee mit der Jolle bewältigen könnte, hatte einen solchen Trailer schon einmal konstruiert. Es stand aber auch noch die Frage des Tarnsegels. Ich kaufte also in Stralsund in der HO „Spowa“ (Handelsorganisation „Sport und Wandern“) ein Großsegel für eine 420er Jolle, das etwas kleiner war als das für die xy-Jolle, setzte es für einen Probetörn, um zu sehen, ob es die xy-Jolle auch zieht. Später kaufte ich noch eine neue Kreuzbock hinzu. Diese beiden neuen Segel versuchte ich dann in der heimischen Badewanne mit dunkelblauer Textilfarbe einzufärben. Das Polyestergewebe nahm aber keine Farbe an. Die Farbe ließ sich sogar leicht mit der Duschbrause abspülen und verschwand ohne Rückstände im Ausguss. Ich benötigte also fachlichen Rat, wie man ein helles Polyestersegel deutlich dunkel einfärbt.
Während eines sommerlichen Kurzbesuches in Dresden sah ich am Hauptbahnhofsvorplatz an einer hier stehenden Baracke das Schild „Drogerie“. Ich dachte: ‚Hier holst du dir Rat, so weit von der Küste entfernt denkt kein Mensch an die Vorbereitung eines nächtlichen Grenzdurchbruchs über See.‘ Der Drogistin log ich vor, als Bandleader eine helle Polyesterplane dunkel einfärben zu wollen, um die goldenen Sterne, die später aufgenäht werden sollten, besser als Überdachung zur Geltung zu bringen, nun nehme das Polyestergewebe aber das Färbemittel nicht an. Die ahnungslose Verkäuferin gab mir den fachlichen Rat, das Färbebad mit reichlich Essigessenz aufzufüllen.
Mit neuem Färbemittel und einem Karton mit Essigessenz im Rucksack fuhr ich zurück nach Rostock, wo ich die Färbeprozedur mit den beiden Segeln in meiner Badewanne erneuerte. Jetzt klappte es. Die beiden Segel waren schön dunkel eingefärbt, aber klitschnass. Ich ließ die Segel abtropfen und legte sie dann in eine größere Plastewanne. Inzwischen hatte ich unsere Dachkammer, die mit einer lindgrünen Teppichware belegt war, mit einigen Lagen Zeitungspapier bedeckt. Dann brachte ich die Wanne mit den noch immer feuchten Segeln nach oben. Die Dachkammer war sommerlich aufgeheizt. Obwohl ich mich bemühte, die feuchten Polyestersegel vorsichtig über den ausgebreiteten Zeitungen auszulegen, sie waren tatsächlich nach wenigen Stunden trocken, zeigten sich blaue Flecken auf dem grünen Teppich. Wie das Penelope erklären?
Lesern, welche das DDR-System nicht erlebt haben, sei erklärt, dass die Unterlassung einer Anzeige (§ 225 [1] 4. StGB d. DDR) bei Kenntnis der Vorbereitung einer Straftat gegen die staatliche Ordnung der DDR mit bis zu fünf Jahren Freiheitsentzug bestraft werden konnte. Diese Gefahr hatte ich von Penelope genommen, vom ersten Gedanken an einen Grenzdurchbruch an. Naive Leute nannten später meine „Reise“ deshalb einen Vertrauensbruch.
Ich musste Penelope also die blauen Flecken in der Dachkammer logisch erklären. Es gab damals in den HO-Textilgeschäften immer mal polnische Jeans, die aber noch nicht vor- oder ausgewaschen waren wie heute, wo diese amerikanische Arbeitskleidung gern als coole Szeneklamotte getragen wird. Ich kaufte mir also dieses Kleidungsstück und wusch es in der Badewanne vor. Dann legte ich es zum Trocknen in die Bodenkammer, so erklärte ich die blauen Flecken auf dem Fußboden meiner Lebenspartnerin, die das zwar missbilligte, doch nicht anzweifelte, während die Törnsegel nun im Segelsack einsatzbereit ihrer Verwendung harrten.
Der Segelsommer war noch nicht vorüber, ich trieb mich wieder mit meiner Jolle im Hiddenseeer Liegeplatz „Schwarzer Peter“ herum, als ein idealer Nordost als mäßige Brise über den Bodden blies. Der Wind hatte schon einige Dezimeter Hochwasser hereingetrieben. Das war die optimale Situation für einen Segeltörn in südliche Richtung. Ich dachte mir: ‚Jetzt machst du den Test mit der xy-Jolle, dicht unter Land des Gellen nach Süden zu, zwischen der Insel und der riesigen Sandbank Geller Haken hindurchzugelangen.‘ Natürlich war das alles schon Sperrgebiet, aber die Hinweis- und Verbotsschilder waren nur an Land angebracht. Dort stand auch ein verrotteter Stacheldrahtzaun, der das Vogelschutzgebiet Gellen vor den sonnenhungrigen Urlaubern abschirmte. Wenn mein Törn bemerkt werden würde, konnte ich mich immerhin mit Unwissenheit herausreden, wollte ja damals auch gar nicht den Grenzdurchbruch durchführen, war schließlich noch in der ersten Vorbereitungsphase.
Gedacht, getan, die Jolle schoss ideal mit Viertelschwert in Lee und Halbschwert in Luv in den von mir erwarteten Priel hinein. Hin und wieder schleifte das Ruderblatt im Sand des Grundes und gab einen knirschenden Laut von sich. Der Priel war aber da!
Ich dankte im Geiste meinem Heimatkundelehrer, der mir die Existenz eines Priels schon in der Schule vermittelt hatte, denn auf den mir zugänglichen Seekarten des Seehydrographischen Instituts der DDR war es nicht verzeichnet; hier gab es nur die Ein-Meter-Tiefenlinie, da geringere Wassertiefen für die Berufsschifffahrt völlig uninteressant sind.
Die Jolle rauschte also durch den Priel auf die Ausfahrt zwischen Gellen und Bock zu, und ich konnte bei Tageslicht jede Windung des Wasserweges sehen. Da ich immer auf der Luvseite blieb, hätte mich auch eine Grundberührung wenig behindert, weil mich der Wind dann ins Fahrwasser zurückgetrieben haben würde.
Nach ca. einer Stunde überquerte ich die Ausfahrt in die Ostsee und passierte mit südlichem Kurs den Kontrollpunkt Bock der „Grenzbrigade Küste“. Jetzt erst hatten die Grenzsicherungsorgane mich erspäht, weil die östliche Spitze der Insel Bock von ihrem Punkt aus die eigentliche Ausfahrt in die Ostsee versperrte. So hatte ich es auf der Seekarte ermittelt, und so war es.
Die Blinkzeichen von dem Kontrollpunkt ignorierte ich, segelte völlig unschuldig in das Fahrwasser nach Barth hinein. Vor dem Grabow, dort wo kleinere Lücken zwischen den Werder’schen Inseln sind, lag eines der Kanonenboote der „Grenzbrigade Küste“ und brachte mich auf.
Das folgende Verhör an Bord des Kanonenbootes, woher und wohin, gestaltete sich moderat. Ich behauptete, dass ich, vom Neuendorfer „Schwarzen Peter“ kommend, beabsichtigte, nach Barth segeln zu wollen. „Sie sind aber durch das Sperrgebiet gesegelt!“, meinten sie. „Tut mir leid“, kam meine Entgegnung, „ich wollte mir nur den großen Umweg um den Geller Haken herum und durch die Kadettrinne ersparen.“
Telefonate hin und her, Untersuchungen meiner Utensilien und der Jolle nahmen einige Zeit in Anspruch. Nach mehreren Stunden ließen sie mich laufen, heißt, weitersegeln, mit dem strengen Hinweis, künftig das Sperrgebiet zu beachten.
Durch Grabow und Barther Bodden segelnd, war ich noch vor Sonnenuntergang in Barth. Ich hatte nun die glückliche Erkenntnis: Hier geht’s raus, ohne von einem der in der Ostseeausfahrten befindlichen Kontrollpunkte aus direkt gesehen zu werden. Aber die Grenzwächter wussten das nun auch und würden den Priel mit einem Buhnendamm versperren, fürchtete ich.
Mein Versuch, in Barth Mitglied es dortigen Segelvereins zu werden und meine xy-Jolle da über den Winter zu belassen, scheiterte an der Forderung der Vereinsleitung, die von Mitgliedern verlangte, in der Stadt zu wohnen, also hier polizeilich gemeldet zu sein, oder hier zu arbeiten.
Anfang September segelte ich also wieder nach Groß Zicker zurück, wo mich der dortige Vereinsvorstand für einen dicken Schein wieder über den Winter mit meiner Jolle im Vereinsgelände liegen ließ.