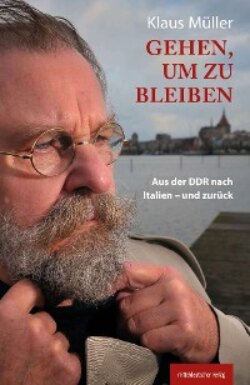Читать книгу Gehen, um zu bleiben - Klaus Muller - Страница 8
Erste Schritte
ОглавлениеFür mich war aber klar, im Sommer 1982 musste ich das Segeln erlernen und ein entsprechendes Boot erwerben, machte mich schon mal theoretisch mit der Sache vertraut. Ich muss voraussagen, dass ich ein Typ bin, der aus dem geschriebenen Wort leicht Kenntnis zu erlangen vermag und der für Kräfte, Größen, Orte und Zeiten äußerst zugänglich ist. Deshalb begriff ich nicht nur die Grundlagen des Segelns aus einem einfachen Segellehrbuch heraus, sondern wurde bald, allein aus dem tagtäglichen Hören des Seewetterberichts, zu jemandem, der zuverlässig die meteorologische Navigation erkannte und bald auch beherrschte.
Seit einigen Jahren hörte ich also schon den Seewetterbericht, den das DLF auf der Mittelwelle 1.289 KHz um 6.40 Uhr zur schönsten Frühstückszeit aussendete. Von den zwanzig Wetterstationen des Seewetterberichts kannte ich elf noch aus dem Erdkundeunterricht, die restlichen neun Stationen lagen zweifellos dazwischen, denn die Orte kreisten gegen den Uhrzeigersinn um die Nordsee, um Jütland herum und im Uhrzeigersinn um die Ostsee bis zur Halbinsel Hel. Bald entstand nach der Meldung des Luftdrucks der einzelnen Stationen ein Bild in meinem Gehirn, das man wissenschaftlich die Isobaren nennt, also die Linien gleichen Luftdrucks. Es genügte nun ein Satz aus dem Segelhandbuch, das auch Grundbegriffe der Meteorologie beinhaltete, wonach der Wind auf der Nordhalbkugel aus dem Hoch heraus im Uhrzeigersinn von der Corioliskraft abgelenkt und gegen den Uhrzeigersinn ins Tief hineinweht, um die Windrichtung vorherzusagen. Als ich dann noch las, dass sich mittels der Isobaren-Abstände der Gradient berechnen ließ, war die Grundlage für die Erstellung der Seewettervorhersage gelegt. Ich kann sagen, dass derjenige, der seine gesamte Lebenszeit nicht ausschließlich mit Erwerbsarbeit vertrödelt, sondern sich ihn interessierenden Wissensgebieten intensiv widmet, durchaus entsprechende Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben kann. In Umkehrung des Ergehens vieler Sanitäter während des Krieges, die mit dem Skalpell auf den Feldsanitätsplätzen agierten, Verwundete behandelten, dabei Erfolge erzielten und nach dem Krieg nicht als Chirurgen tätig sein durften, weil sie die medizinische Theorie nicht an der Universität studiert hatten, hatte ich mir bald autodidaktisch die Navigation beigebracht, ohne jemals praktisch auf der Kommandobrücke eines Schiffes gestanden zu haben und mich nun auch nicht Navigator nennen darf.
Zeitparallel zu meinen theoretischen, nautischen Vorbereitungen eines Grenzdurchbruchs über die Ostsee unternahm ich auch legale Versuche einer Ausreise. Im Dezember 1981 bereits stellte ich einen Antrag auf Mitgliedschaft in der Liga für Völkerfreundschaft, Sektion „Italien“. Das neue Jahr war erst wenige Wochen alt, als ich schon ein Ablehnungsschreiben in meinem Briefkasten fand. Mir wurde darin mitgeteilt, dass die Liga für Völkerfreundschaft nicht für private Interessen gedacht sei, sondern für Delegierte der gesellschaftlichen Massenorganisationen der DDR, welche die Politik von Partei und Regierung in den entsprechenden Ländern zu vertreten hätten. Mir war schon vorher klar, dass ich auf legalem Wege nie aus dem Käfig hinauskommen würde, ich führte aber auch später noch meine Antragsflut fort, nicht in der Hoffnung auf Erfolg, sondern um das Bild des naiven Antragstellers zu festigen, der, unfähig zur couragierten Tat, leicht abzuwimmeln, weil harmlos ist.
Mit dem hereinbrechenden Frühjahr rückte die praktische Vorbereitung meines Planes immer dringlicher in den Fokus. Private Segelschulen gab es in der DDR nicht, ich musste mich also zeitweise einer sogenannten Betriebssportgemeinschaft (BSG) anschließen. Diese gab es jedoch als Segelsparte in den direkt an der Ostsee gelegenen Orten nicht. Der Rostocker Universitätssegelclub oder die in Warnemünde ansässigen Segelvereine waren für mich nicht zugänglich. Ich wollte das Segeln natürlich auch nicht in binnenländischen Gewässern oder in mitteldeutschen Talsperren erlernen und praktizieren.
Es hieß für mich, in den Boddengewässern entsprechenden Anschluss zu finden. In der Betriebssportgemeinschaft des Fischereikombinats Saßnitz, die im Großen Jasmunder Bodden einen kleinen Seglerhafen hatte, wurde ich schon bei meiner freundlichen Begrüßungsrede von einem schrecklichen Rüpel, der dort wohl Vereinsvorstand war, ‚weggebissen‘. In den Rostock nahen, kleinen Hafenstädten Ribnitz und Barth verlangte man von mir, den Hauptwohnsitz im Ort zu haben, was ich in beiden Fällen freilich nicht wollte.
Mehr Erfolg zeigte sich für mich in Groß Zicker, wo die Fischereiproduktionsgenossenschaft (FPG) des Mönchgutes in ihrer BSG ein halbes Dutzend 420er Jollen und eine Baracke für das Segelzubehör zu liegen hatte. Der hier Zuständige machte mir Hoffnung, als vorübergehendes Mitglied am Boddensegeln teilnehmen zu können, wenn ich im Kreis Rügen eine Saisonarbeiterstelle annehmen würde. Das war für mich die Chance. Ich bemühte mich daraufhin um einen Job beim HO-Kreisbetrieb Rügen, das heißt, ich fuhr zum Saisonbeginn in Binz vor und bekam spontan die Barleiterstelle in der Binzer Nachtbar „Fass“. Hier musste ich den Bartresen mit allen in der DDR gängigen Barangeboten und die ca. dreißig Tischplätze des Ladens bedienen. In einer Ecke des dunklen Raumes ‚schaffte sich‘ ein Einzelmusiker mit einem Synthesizer, lärmte aber nicht allzu sehr. Wie überall in den Nachtläden des Ostens war das Haus vom ersten Tag an bis auf den letzten Platz gefüllt. In Binz gab es damals, 1982, schon eine Türsteherszene, welche die Gewalttätigkeiten, die nun mal zum Nachtlokalgeschäft gehören, von mir fernhielt. Binz war schon von jeher das bevorzugte Seebad der Berliner Schickeria, auch zu DDR-Zeiten. Es gab einen Seebädersonderzug, der die Liebhaber des Seebades Binz in zweieinhalb Stunden vom Berliner Bahnhof Lichtenberg nach Binz brachte, er fuhr gegen 18 Uhr in Berlin ab und brachte die Leute kurz vor der Öffnungszeit des „Fass“ nach Binz. Besonders hauptstädtische Künstler und ihr Umfeld, aber auch andere Gestalten der Berliner Lebewelt fielen pünktlich um 21 Uhr vom Bahnhof Binz aus im „Fass“ ein. Die meisten Gäste dort waren aber im Ort ansässige Stammurlauber.
Obwohl diese Leute mir schon in den ersten Tagen meines Jobs bedeutende Einnahmen brachten, haben sie bei mir wenig Eindruck hinterlassen, ich hatte ja andere Ziele im Blick. Nur die „Römerin“ ist mir heute noch gut in Erinnerung. Sie war eine große, stolze Mittvierzigerin, trug eine füllige schwarze Mähne auf dem Haupt, zeigte ein tiefes Dekolleté über ihrem beeindruckenden Busen und wurde immer von einem Halbdutzend blonder Jünglinge begleitet, die der Größe nach geordnet lächelnd wie ein Schwanz hinter ihr hertänzelten, wenn sie das Lokal betrat und später ihre Herrin devot umschwärmten.
Es war also für mich wieder viel zu tun, das Geschäft ging bis zum Morgen um vier Uhr, ich war danach erst immer gegen fünf Uhr im Bett. Nach diesem Knochenjob schlief ich auch zumeist bis in den frühen Nachmittag. Danach fuhr ich mit meinen klapprigen „Mossi“ nach Groß Zicker, wo ich mir bei dem Vorstand des Segelvereins den Barackenschlüssel holte, um mir eine der 420er Jollen aufzutakeln und nach meinem theoretischen Segelwissen die ersten selbstständigen Einhand-Segelversuche im Zicker See zu unternehmen. Von Mal zu Mal wurde das besser. Ich hatte zuerst nur das Großsegel gesetzt, um das Grundgefühl des Segelns zu beherrschen, Gefühl für den Winddruck am Segel und die Balance auf dem kiellosen Boot, aber auch beim Ab- und Anlegen der Jolle, den Druck aus den Segeln nehmen, immer die Windrichtung im Blick, zu erlangen.
Dann setzte ich zusätzlich die Kreuzfock als zweites Segel, was schon schwieriger war. Als ich die Jolle sicher beherrschte, verlangte es mich natürlich nach einem längeren Törn in die größeren Boddengewässer hinein. Doch dazu musste ich auf einen Ruhetag warten, hatte ja jeden Abend noch vor 20 Uhr meinen Dienstpflichten und Vorbereitungsarbeiten zu genügen. Der Job im „Fass“ war natürlich wieder eine Goldgrube für mich, früher hätte ich ihn für einen ausgesprochenen Glücksfall angesehen. Jetzt hatte ich aber andere Ziele, zumal der „Mossi“, nun schon elf Jahre alt, zusammenzubrechen drohte.
Auf meinem Fahrweg zwischen Binz und Groß Zicker kam ich immer in Lobbe, ganz nah am Strand, an einem barackenähnlichen Gasthaus namens „Leuchtfeuer“ vorbei. Eines Tages machte ich hier Halt und ging hinein, traf dort einen ruppigen Typ, der mir aber sofort sympathisch war. Er betrieb den Laden gemeinsam mit seiner Frau, hatte aber kaum Angebote, weil die Maul- und Klauenseuche warenmäßig schon unerbittlich zugeschlagen hatte. Es gab kaum noch etwas, was man in einer Küche zu einem vollwertigen Mittagsgericht zusammenquirlen konnte. Der Typ, der Jochen hieß, nahm das aber locker, zeigte schon die richtige Endzeitstimmung, die sich immer weiter in der DDR ausbreitete. Der Laden befand sich kurz hinterm Strand, war also ideal gelegen, und hier war wenig zu tun. Nach einiger Zeit fragte ich Jochen, ob er für mich hier Quartier und Job hätte. Er war höchst erfreut von meinem Angebot, meinte: „Gern, wenn du auf die dicke Kohle verzichten willst, die das ‚Fass‘ abwirft, kannst du hier immer mal das Abendgeschäft machen und in dem Bungalow am Strand wohnen!“
Die Binzer wollten es erst nicht glauben, dass ich die Goldgrube im „Fass“ mit dem traurigen „Leuchtfeuer“ vertauschen würde, hielten mich wohl für einen verrückten Naturliebhaber.
Nun segelte ich täglich mit der 420er Jolle, war doch das Sommerhalbjahr 1982 wettermäßig eines der schönsten des 20. Jahrhunderts, nur in der zweiten Augustdekade regnete es ungewöhnlicherweise fast ununterbrochen. Hin und wieder blies bei klarem Himmel starker bis steifer Wind (Bf 6 und 7); „Kaiserwetter“, sagt der Seemann, hierbei sollte man aber Jollen an Land lassen. Ich wollte es aber doch wissen und ging mit der 420er Jolle in den Zicker See.
Der Wind blies steif aus Westen, und ich segelte, nachdem ich nur das Großsegel gesetzt hatte, mit diesem in Richtung Süd auf die Halbinsel Klein Zicker zu, hatte das Großschot weit gefiert. Eine hohe See konnte sich in dem kleinen Gewässer natürlich nicht aufbauen, es blies mir aber reichlich Gischt gegen Brust, Rücken und ins Gesicht. Als ich mitten im Zicker See wenden wollte, warf der steife Wind die Nussschale um, ich lag, glücklicherweise ohne Verletzung, aber auch ohne Lifejacket im Wasser. Das Segel drückte mich unter Wasser, ich versuchte, unter dem Segel herauszutauchen, was aber schwierig war, da ich es in der ganzen Länge nach abtauchen musste. Endlich war ich draußen und konnte wieder Luft schnappen.
Kurzzeitig hatte ich Todesangst empfunden, war aber nun belehrt, wie man sich im Falle des Kenterns verhält. Nach dem losgeworfenen Großschot gelang es mir, die Jolle mit Hilfe des Schwertes vor dem Wind wieder aufzurichten, mich in die Plicht zu schwingen und das Boot ans Ufer zu segeln.
Einige Tagestörns, wiederum im „Einhand“ (engl. „single-hands“) um die Insel Vilm herum und durch den ziemlich großen Greifswalder Bodden gaben mir das Selbstbewusstsein; ich war auf dem besten Wege, ein passabler Segler zu werden, der sich später auch auf die hohe See wagen konnte.
In dieser Zeit fochten die Briten im Südatlantik den „Falklandkrieg“ aus, von dem ich aber auf meiner westfernsehenlosen Insel fast nichts mitbekam. Nur bei einem Besuch im heimatlichen Rostock sah ich die Bilder im Fernsehen: von den Kämpfen im winterlichen Südatlantik und später, wie die siegreichen Männer der Royal Navy durch die Straßen Londons marschierten. Ich freute mich, dass eine westliche Macht den exotischen Tyrannen einmal siegreich die Zähne gezeigt hatte.
Ende August 82 teilte mir der Vorstand des Seglervereins mit, dass in den nächsten Tagen ein Instrukteur der BSG hier erscheinen und allen, die sich dafür interessierten, die praktische Segelprüfung für den Segelschein abnehmen würde. Natürlich wollte ich das!
Ich bestand die Prüfung und bekam das entsprechende Zertifikat ausgehändigt, so dass ich mich im Winter 1982/83 in Rostock nur noch um den theoretischen Teil des Segelscheins zu bemühen brauchte. Diesen Schein wollte ich aber auf alle Fälle erwerben.
Jetzt benötigte ich nur noch eine eigene Jolle, um mich auch real an meinen großen Plan zu machen. In einer Sportzeitung, die in der Segelzubehör-Baracke herumlag, fand ich die Anzeige eines Berliners, seine xy-Jolle für 8.200 Mark verkaufen zu wollen. Das war genau das richtige Segelboot für mich. Ich schrieb dem Anbieter und kam mit ihm für die Übergabe noch im laufenden Jahr überein.
Im September fuhr ich dann mit dem „Mossi“ und einem geliehenen Trailer nach Berlin- Köpenick, wo der Anbieter in unmittelbarer Nähe des Müggelsees wohnte. Wir testeten gemeinsam die Jolle bei idealer Brise (Bf 4) auf dem nahen Gewässer, wobei der Verkäufer besonders die Geschwindigkeit des Bootes herausstrich. Er hielt mich wohl eher für einen Sportstypen als für einen Erkenntnissucher, der mit dieser Plasteschale die Seegrenze der DDR durchbrechen wollte.
Die Jolle, eigentlich eine Wanderjolle, hatte zwei Schwerter und zwei Schwertkästen, so dass auf dem Boden des Fahrzeuges eine rechteckige Fläche entstand, auf der eine größere Luftmatratze leicht Platz fand. Zudem hatte die xy-Jolle eine große, die gesamte Decks- und Plichtfläche überspannende Persenning, die wie ein geräumiges Zelt wirkte. Es war also das ideale Fahrzeug für meine Zwecke.
Mit dem Trailer hinter meinem klapprigen „Russenpanzer“ brachte ich die Jolle nach Groß Zicker, wo sie bis zum Segelsaisonbeginn 1983 bleiben sollte. Ich hatte im Jahr 1982 alles erreicht, was ich mir für mein Vorhaben vorgenommen hatte; das Jahr war aber noch nicht vorüber, und es würden sich noch gefährliche Situationen ergeben, die mich zu weiterer Vorsicht veranlassen sollten.