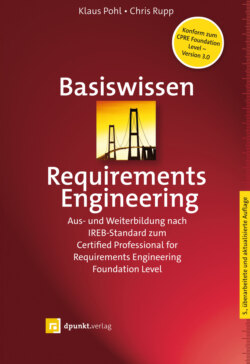Читать книгу Basiswissen Requirements Engineering - Klaus Pohl - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Inhaltsverzeichnis
Оглавление1 Einleitung und Grundlagen
1.1 Requirements Engineering – Was?
Exkurs: Qualitätsanforderungen
Exkurs: Randbedingungen (Constraints)
1.2 Requirements Engineering – Warum?
Exkurs: Kommunikationsprobleme
1.3 Requirements Engineering – Wo?
Exkurs: Ziele und Szenarien
1.4 Requirements Engineering – Wie?
1.5 Die Rolle und Aufgaben eines Requirements Engineer
Exkurs: Persönlichkeitsprofil eines Requirements Engineer
1.6 Was über Requirements Engineering zu lernen ist
2 Grundlegende Prinzipien des Requirements Engineering
2.1 Neun grundlegende Prinzipien
2.1.1 Prinzip 1: Wertorientierung – Anforderungen sind Mittel zum Zweck, kein Selbstzweck
Exkurs: Anforderungen sind kein Selbstzweck
2.1.2 Prinzip 2: Stakeholder – Im Requirements Engineering geht es darum, die Wünsche und Bedürfnisse der Stakeholder zu befriedigen
2.1.3 Prinzip 3: Gemeinsames Verständnis – Erfolgreiche Systementwicklung ist ohne eine gemeinsame Basis nicht möglich
Exkurs: Wichtige Anforderungsquellen zusätzlich zu Stakeholdern
Exkurs: Gemeinsames Verständnis schaffen
2.1.4 Prinzip 4: Kontext – Systeme können nicht isoliert verstanden werden
Exkurs: Probleme mit getrennter Umfang-(Scope-)Abgrenzung
2.1.5 Prinzip 5: Problem · Anforderung · Lösung – Ein unausweichlich ineinandergreifendes Tripel
Exkurs: Twin-Peaks-Modell
2.1.6 Prinzip 6: Validierung – Nicht validierte Anforderungen sind nutzlos
Exkurs: Validierung
2.1.7 Prinzip 7: Evolution – Sich ändernde Anforderungen sind kein Unfall, sondern der Normalfall
Exkurs: Änderungen vs. Stabilität
2.1.8 Prinzip 8: Innovation – Mehr vom Gleichen ist nicht genug
2.1.9 Prinzip 9: Systematische und disziplinierte Arbeit – im Requirements Engineering unverzichtbar
Exkurs: Auswahl von Praktiken und Techniken
2.2 System und Kontextabgrenzung
2.2.1 Systemkontext
2.2.2 System- und Kontextgrenzen bestimmen
Exkurs: Dokumentation des Systemkontexts
3 Arbeitsergebnisse und Dokumentationspraktiken
3.1 Arbeitsergebnisse im Requirements Engineering
3.1.1 Merkmale von Arbeitsergebnissen
3.1.2 Kategorien und Abstraktionsebenen
3.1.3 Detaillierungsgrad von Anforderungen
3.1.4 Aspekte von Arbeitsergebnissen
3.1.5 Allgemeine Dokumentationsrichtlinien
3.1.6 Planung der zu verwendenden Arbeitsergebnisse
3.2 Natürlichsprachige Arbeitsergebnisse
Exkurs: Sprachliche Effekte durch Transformation
3.2.1 Dokumentationsrichtlinien für natürlichsprachige Anforderungen
3.2.2 Sprachliche Effekte, auf die zu achten ist
3.3 Vorlagenbasierte Arbeitsergebnisse
3.3.1 Satzschablonen
Exkurs: Schritt für Schritt zur Anforderung
3.3.2 Formularvorlagen
Exkurs: Vorlagenbasierte Spezifikation von Use Cases
3.3.3 Dokumentvorlagen
Exkurs: Standardisierte Dokumentvorlagen
3.4 Modellbasierte Arbeitsergebnisse
3.4.1 Die Rolle von Modellen im Requirements Engineering
Exkurs: Eigenschaften von Modellen
Exkurs: Modellierungssprachen
3.4.2 Kontextmodellierung
Exkurs: Zielmodellierung im Requirements Engineering
Exkurs: Kontextmodellierung mit SysML-Blockdiagrammen
3.4.3 Modellierung von Struktur und Daten
Exkurs: Fortgeschrittene Modellierung von Struktur und Daten
3.4.4 Modellierung von Funktion und Ablauf
Exkurs: Use-Case-Modelle und -Diagramme
3.4.5 Modellierung von Zustand und Verhalten
Exkurs: Fortgeschrittene Zustandsmaschinendiagramme
Exkurs: Integration der Perspektiven auf funktionale Anforderungen
3.5 Glossare
3.5.1 Grundlagen von Glossaren
3.5.2 Regeln für den Umgang mit einem Glossar
3.6 Dokumentationsstrukturen für Anforderungen
3.7 Prototypen im Requirements Engineering
3.7.1 Explorative Prototypen
3.7.2 Evolutionäre Prototypen
3.8 Qualitätskriterien für Arbeitsergebnisse und Anforderungen
3.8.1 Qualitätskriterien für einzelne Anforderungen
3.8.2 Qualitätskriterien für ein Menge von Anforderungen
4 Praktiken für die Erarbeitung von Anforderungen
4.1 Quellen für Anforderungen
4.1.1 Stakeholder und deren Bedeutung
4.1.2 Der Umgang mit Stakeholdern im Projekt
Exkurs: Personas
Exkurs: Stakeholder-Relationship-Management
4.1.3 Weitere Anforderungsquellen
4.2 Ermittlung von Anforderungen
4.2.1 Anforderungskategorisierung nach dem Kano-Modell
4.2.2 Arten von Ermittlungstechniken
4.2.2.1 Erhebungstechniken
Exkurs: Befragungstechniken
Exkurs: Kollaborationstechniken als Hilfstechniken
Exkurs: Beobachtungstechniken
4.2.2.2 Entwurfs- und Ideenfindungstechniken
Exkurs: Kreativitätstechniken
4.2.2.3 Auswahl der richtigen Ermittlungstechnik
Exkurs: Szenarien
4.3 Abstimmung und Konfliktlösung
4.3.1 Konfliktidentifikation
4.3.2 Konfliktanalyse
4.3.3 Konfliktlösung
4.3.4 Dokumentation der Konfliktlösung
4.4 Validieren von Anforderungen
4.4.1 Grundlagen der Validierung von Anforderungen
Exkurs: Qualitätsaspekte von Anforderungen
Exkurs: Qualitätsaspekt »Inhalt«
Exkurs: Qualitätsaspekt »Dokumentation«
4.4.2 Wichtige Aspekte der Anforderungsvalidierung
Exkurs: Qualitätsaspekt »Abgestimmtheit«
Exkurs: Auswahl der Validierer
4.4.3 Reviewtechniken zur Validierung von Anforderungen
4.4.3.1 Walkthrough
Exkurs: Konzentration auf Aufdeckung von Fehlern
Exkurs: Stellungnahme als Sonderfall
4.4.3.2 Inspektion
Exkurs: Rollen bei einer Inspektion
Exkurs: Assistenztechniken zur Unterstützung des Reviews
4.4.4 Explorationstechniken
4.4.4.1 Prüfung durch Prototypen
Exkurs: Durchführung einer Prüfung mittels Prototyping
4.4.4.2 Prüfung durch kontrollierte Experimente
4.4.4.3 Probe-Entwicklung (Konstruktion von Entwicklungsartefakten)
Exkurs: Wechsel der Dokumentationsform
5 Prozess und Arbeitsstruktur
5.1 Einflussfaktoren
5.1.1 Eignung des Gesamtprozesses
5.1.2 Entwicklungskontext
5.1.3 Fähigkeiten und Verfügbarkeit von Stakeholdern
5.1.4 Gemeinsames Verständnis
5.1.5 Komplexität und Kritikalität des zu entwickelnden Systems
5.1.6 Vorgegebene Randbedingungen
5.1.7 Verfügbare Zeit und Budget
5.1.8 Volatilität der Anforderungen
5.1.9 Erfahrungen des Requirements Engineer
5.2 Facetten der Requirements-Engineering-Prozesskonfiguration
5.2.1 Zeitfacette: linear versus iterativ
5.2.2 Zweckfacette: präskriptiv versus explorativ
5.2.3 Zielfacette: kundenspezifisch versus marktorientiert
5.2.4 Hinweis und Warnungen
5.3 Konfigurieren eines Requirements-Engineering-Prozesses
5.3.1 Partizipativer Requirements-Engineering-Prozess: iterativ, explorativ und kundenspezifisch
5.3.2 Vertraglich regulierter Requirements-Engineering-Prozess: typischerweise linear, präskriptiv und kundenspezifisch
5.3.3 Produktorientierter Requirements-Engineering-Prozess: iterativ, explorativ und marktorientiert
5.3.4 Weitere zu berücksichtigende Aspekte
6 Praktiken für das Requirements Management
6.1 Was ist Requirements Management?
6.2 Verwaltung des Lebenszyklus
6.3 Versionskontrolle
6.4 Konfigurationen und Basislinien
Exkurs: Dimensionen von Anforderungskonfigurationen
Exkurs: Basislinien
6.5 Attribute und Sichten
6.5.1 Attribuierung von natürlichsprachigen Anforderungen und Anforderungsmodellen
Exkurs: Attribuierungsschemata
6.5.2 Sichten auf Anforderungen
Exkurs: Selektive Sicht
Exkurs: Verdichtende Sicht
6.6 Verfolgbarkeit von Anforderungen
Exkurs: Nutzen und Arten der Verfolgbarkeit
6.6.1 Verwendungszweckbezogene Definition der Verfolgbarkeit
6.6.2 Repräsentation der Verfolgbarkeit
6.7 Umgang mit Änderungen
Exkurs: Change Control Board
Exkurs: Änderungsantrag für Anforderungen
6.8 Priorisierung von Anforderungen
6.8.1 Vorgehen zur Priorisierung von Anforderungen
6.8.2 Techniken zur Priorisierung von Anforderungen
7 Werkzeugunterstützung
7.1 Werkzeuge im Requirements Engineering
Exkurs: Nutzung von nicht für das Requirements Engineering entwickelten Werkzeugen
Exkurs: Requirements-Management-Werkzeuge
Exkurs: Spezialisierte Werkzeuge für das Requirements Management
Exkurs: Standard-Büroanwendungen
Exkurs: Modellierungswerkzeuge
7.2 Werkzeugeinführung
Anhang
Videoverzeichnis
Animationsverzeichnis
Kernfaktenverzeichnis
Literatur
Index