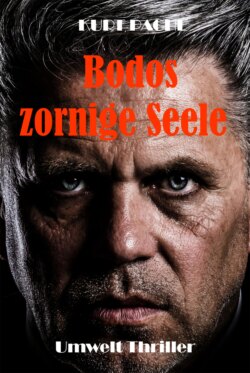Читать книгу Bodos zornige Seele - Kurt Pachl - Страница 8
Kapitel 6
ОглавлениеZwischenzeitlich war eine riesige Maschinerie angelaufen. Allen wichtigen Stellen in Kanada, in den USA, in England sowie in Australien und Neuseeland lagen detaillierte Informationen vor. Alle weiteren Länder, die nicht den Fife-Eyes angehörten, wollte das Innenministerium zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht mit einbeziehen.
Für die Anwesenden stand fest: Die Täter waren ausgesprochene Spezialisten. Spurenleser hatten das Plateau ausfindig gemacht, von wo aus die Schüsse abgegeben worden waren. Eine fast unumstößliche These besagte, dass die Schützen mit dem Kutter unterwegs gewesen waren, welcher in Flammen aufgegangen und kurz danach gesunken war. Allerdings gab es nicht die geringste verwertbare Spur. Als sicher musste weiterhin gelten, dass alle oder ein Teil der Täter ein Flugzeug vom kleinen Flugplatz am Rande der Straße 430 nach Yarmouth genommen hatten.
Das Flugzeug war jedoch gegen 15:00 Uhr vom Radar verschwunden. Bislang fehlte jede Spur der Maschine. Die Auswertungen der Kameras im kleinen Flughafengebäude in Yarmouth ergaben keine verwertbaren Erkenntnisse.
Es stand außer Frage, dass alles nur Erdenkliche unternommen werden musste, um alle Männer dieser grausamen Aktion dingfest zu machen. Der Innenminister hatte diesen Vorgang zur Chefsache erklärt. Gleichzeitig waren seitens der wichtigsten Politiker des Landes am vorigen Abend in einer Telefonkonferenz folgende Beschlüsse gefasst worden: Unter keinen Umständen durfte bekannt werden, dass Robbenjäger auf die vorliegende Art ums Leben gekommen waren. Das Thema Robbenjäger durfte nicht mehr in der Öffentlichkeit breitgetreten werden. Der Hauptgrund bestand darin, den Tourismus nicht zu gefährden. Im Bereich Old Harry, einem Teilstück des St. Lorenz-Golfs war eine wichtige Tiefseebohrung geplant. Die Investoren der Ölplattform durften nicht verschreckt werden. Neufundland hatte immer noch eine Arbeitslosenquote von weit über dreißig Prozent. Man wollte vor allem keinen Ärger mit dem dortigen, äußerst kampfeslustigen Gouverneur haben.
Da ein kleiner Sturm drohte, ging Bradly am Abend des 16. April 2010 in Atlantic Highlands vor Anker. Weit im Norden sahen sie die Skyline von New York. Richtung Osten erstreckte sich eine schmale Halbinsel und schirmte die Bucht, das Gateway National Rec. Area, zum Atlantischen Ozean hin ab.
Marco hatte einige Male ausgiebig im Internet recherchiert. Bei seiner Suche war er äußerst vorsichtig. Er durfte keine Keywords eingeben, welche die NSA oder andere Geheimdienste hätten alarmieren können. Er wurde nicht fündig. Nichts. Totenstille. Bradly sollte nun Zeitungen kaufen. Marco schärfte ihm ein, möglichst nicht alle Zeitungen von einem Stand zu kaufen.
Erst nach einer Stunde, die Sonne war bereits hinter Perth Amboy untergegangen, kam Bradly seelenruhig zur Yacht zurück; bewaffnet mit zwei großen Tüten. In einer Tüte hatte er eine große Anzahl Tageszeitungen, und in der anderen befand sich frischer Proviant. Das sei unauffälliger gewesen, sagte er. Bodo nickte anerkennend. Gemeinsam stürzten sie sich über die The Globe and Mail und über die National Post, den überregionalen Zeitungen. Der gestrige Vorfall existierte für diese Zeitungen nicht. Auch in den Tageszeitungen von Quebec, der Le Devoir und der Montreal Gazette, wurde die gestrige Aktion unterschlagen. Bodo fischte sich die Regionalzeitung von Neufundland, The Western Star aus dem Zeitungsstoß.
»Hier. Hört mal«, sagte Marco. Er hatte die The Chronicle Herald von Nova Scotia vor sich liegen. Er las vor: »Kutter in Flammen aufgegangen. Vorfall wird von der RCMP untersucht.« Der IT-Spezialist runzelte die Stirn und schnaubte: »Aber sonst steht hier nichts weiter.« »Das macht mich etwas nervös, was hier steht«, sagte Bodo und begann vorzulesen: »Mysteriöse Kette von Vorfällen. Sechs Robbenjäger ertrunken. Ein Kutter ausgebrannt. Wasserflugzeug vermisst. Plötzlich vom Radarschirm verschwunden. Die RCMP in Ottawa wurde eingeschaltet.«
»Das klingt nach Nachrichtensperre«, sagte Marco. »Die wollen das Thema totschweigen. Kannst du dir einen Reim darauf machen, Bodo?«
Der Angesprochene warf seine Zeitung auf den runden Tisch des Achterdecks. »Das ganze Thema ist äußerst komplex», begann er. »Wir haben ja Zeit.« Er lehnte sich in seinem gemütlichen Stuhl zurück.
»Ich muss ein bisschen ausholen. Vor Neufundland trifft der eisige Labradorstrom auf den wärmeren Golfstrom. An keiner Stelle der Erde wurde seit hunderten von Jahren mehr Kabeljau gefangen als hier. Das zog vor allem in den 70er- und 80er Jahren riesige Fischfangflotten an; aus den USA, natürlich auch aus Japan und seit alters her aus vielen europäischen Ländern – aber natürlich auch aus Kanada, was immer unterschlagen wurde. Ja, auch kanadische Fischfangflotten fischten den Neufundländern den Kabeljau vor der Nase weg. Das Fischereiministerium in Ottawa hatte alle Bedenken und Untersuchungen von Wissenschaftlern weggewischt, dass die Bestände bedenklich abgenommen hätten. Allein in Neufundland lebten damals 700 Dörfer vom Fischfang. Es gab über 12 000 Fischer und davon mindestens 5 000, die sich ausschließlich auf Kabeljau spezialisiert hatten. In den 80er Jahren ging der Fang von schätzungsweise 200 000 Tonnen Kabeljau pro Saison schlagartig zurück.«
Bodo stand sichtlich erregt auf. Er lehnte sich an die Reling. Viele zum Teil hektische Gesten begleiteten seine weiteren Ausführungen.
»Dummheit und grenzenlose Gier – wie überall auf diesem Planeten. Eine Armada aus weiteren Ländern wollte ihren Anteil am unerschöpflichen Fischreichtum. Früher kamen einige Schiffe und fuhren mit reicher Beute wieder nach Hause. Das änderte sich relativ schnell. Unvorstellbar riesige, hochmoderne Fabrikschiffe ankerten das ganze Jahr über. Unzählige Fangschiffe brachten ununterbrochen neue Fracht. Der Kabeljau wurde auf diesen Fabrikschiffen ausgenommen, filetiert und bereits in verkehrsfähigen Verpackungen schock- und tiefgefroren. Das konnte nicht gutgehen.
Diese Idioten haben erst dann reagiert, als das Kind erkennbar in den Brunnen gefallen war. Der NAFO und das Fischereiministerium in Ottawa erließen ein Fangverbot auf unbestimmte Zeit. Das hatte für Neufundland dramatische Auswirkungen. Es entstand eine Arbeitslosenquote von über vierzig und mehr Prozent. Viele wanderten aus, verdingten sich auf Bohrinseln oder fingen vor Langeweile an zu saufen.
Das Fischereiministerium fand, zumindest zum Teil, einen Ausweg. In Kanada schätzte man den Bestand an Robben auf 5,8 Millionen Tiere; Tendenz steigend, sagte man. Sie gaben 300 000 Robben zum Fang frei. Die Robbenfelle erzielten am Anfang relativ hohe Preise. Aus vielen ehemaligen Fischern wurden Robbenjäger. Sie gingen mit den Robben artähnlich um, wie mit dem Kabeljau. Beim Kabeljaufang musste es schnell gehen. Niemand war sensibilisiert, ob ein Fisch bereits tot war, wenn man ihn aufschlitzte. Die Fischer sahen die Robben ohnehin als Wettbewerber. Die Robben fraßen ihnen die Fische weg. Warum sollte man zart mit diesen Biestern umgehen, meinten viele von ihnen. Oftmals war ihr Kopf ohnehin vom Alkohol umnebelt, wenn sie mit Kuttern und den Hakapiks loszogen. Das waren keine Robbenjäger, wie die Eingeborenen von früher. Sie hatten keine Achtung vor diesen Kreaturen. Viele von ihnen wurden zu seelenlosen Schlächtern. Schnell musste es gehen. Und die Felle durften nicht beschädigt werden.
Ja – und dann kamen die Naturschützer. Sie demonstrierten und liefen zwischen ihnen und den Robben herum. Sie fotografierten, und überall auf der Welt wurden die ehemaligen Fischer als Robbenschlächter geächtet. Dabei wollten sie doch nur ihren Lebensunterhalt bestreiten – war in den Veröffentlichungen des Fischereiministeriums zu lesen. Sie ignorierten, dass drei oder vier Wochen alte Robbenbabys ebenfalls abgeschlachtet wurden. Mit den Whitecoats, den Robbenbabys, ließ sich noch mehr Geld verdienen. 1987 wurde dies zwar offiziell verboten, aber wer kontrollierte dies da draußen in der Einöde? Sie ignorierten Fakten, woraus hervorging, dass Robben bei lebendigem Leib das Fell über die Ohren gezogen wurde. Und irgendwann kam es sogar unter den Robbenschützern zum Eklat. Einer der Gründer von Greenpeace, Paul Watson, warf kurzerhand die Felle und die Hakapiks einiger Robbenjäger ins Wasser. Das ging seinen Gefährten zu weit. Greenpeace schloss ihn aus. Aber Watson wollte sich nicht auf das Beten verlegen, und gründete die Sea Shepherd Conservation Society. Robbenfänger und vor allem die japanischen Walfänger, welche sich nicht an das geltende Gesetz hielten, mussten fortan mit der Gegenwehr Watsons und seinen Mitstreitern rechnen.
Die Lage verschärfte sich, als vor allem die EU eine Einfuhr von Robbenprodukten verbot. Weitere Länder folgten.
Der Absatz der Robbenfelle ging um fast siebzig Prozent zurück. Die Robben-Quoten wurden auf über 450 000 heraufgesetzt. Es gab ja angeblich genug. Diese dummen Sprüche kannten viele von den ach so unerschöpflichen Kabeljaubeständen. Allerdings wurden die Robben-Quoten zunehmend nur um ein Drittel genutzt. Der Aufwand für Diesel und Zeit rechnete sich nicht mehr. Und hier zeigt sich wieder, wie bodenlos dumm Politiker sein können. Lumpige fünfundzwanzig oder dreißig Millionen Kanadische Dollar erzielten die Jäger noch mit dem Verkauf der Robbenfelle. Anstatt den Fischern anderweitige Perspektiven aufzuzeigen, riskierten diese Dummbolzen eine schlechte Presse, welche viele Jahre zu Lasten eines aufkommenden Tourismus ging.«
Bodo ließ sich in seinen Stuhl sinken. Er wirkte urplötzlich müde.
»Damit sind wir beim heutigen Thema. Diese Deppen können keine schlechte Presse gebrauchen. Ein bekannter Politiker, der aus Neufundland gekommen ist, hat sich hier auf sein Altenteil zurückgezogen und hat sich zum Gouverneur wählen lassen. Ihm ist es gelungen, viel für den Aufbau des Tourismus zu erreichen. Als Pragmatiker musste er sich allerdings auf die Seite der Robbenjäger schlagen. Er hatte rechtzeitig den Riesentrawlern den Kampf angesagt. Vergeblich. Damals hätte man noch viel retten können. Er versucht nun, die nächste Katastrophe zu verhindern. Vor der Küste von Neufundland soll eine riesige Ölplattform entstehen. Wenn hier, in diesem kalten Wasser des Old Harry Öl in großen Mengen auslaufen würde, wäre dies das Ende für Neufundland. In letzter Zeit blühte der Fang von hochwertigem Hummer, und auch der Tourismus nimmt von Jahr zu Jahr zu. In diesem Umfeld braucht man keine toten Robbenjäger und keine weltweiten Schlagzeilen. Und genau das ist der Grund, warum sie alles unter den Teppich kehren wollen.«
»Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht Jagd auf uns machen werden«, unterbrach Marco.
»Geld wird für diese Typen keine Rolle spielen«, erwiderte Bodo stirnrunzelnd. »Sie werden jeden Stein umdrehen. Hierbei stoßen sie voraussichtlich auf den Vorfall von vor zehn Jahren. Die Recherche wird ergeben, dass Ewald damals niedergeschlagen wurde, und lange im Krankenhaus lag. Sie werden hierbei auf den Namen Bodo Cron stoßen. Sie werden feststellen, dass ich und Marco bei den Eco Warriors und lange in Little Guantanamo geschmort haben. Über die Fife-Eyes werden sie im Zusammenhang mit den Aktionen gegen den Walfang auf weitere Namen stoßen. Vielleicht. Auf alle Fälle dürfen wir dies nicht ausschließen.« Bodo seufzte. »Eigentlich wollte ich einige Wochen mit euch bei Bradly verbringen.«
»Aber als Bodo Cron, wird das etwas kompliziert werden«, sagte Ole mit sorgenvoller Miene.
»Jetzt wird mir klar, warum du dich seit zwei Wochen nicht mehr rasiert hast«, sagte Marco grinsend. »Hast du überhaupt die entsprechenden Utensilien dabei?«
Bodo nickte.
Bradly sah die drei Männer fragend an.
»Ihr sprecht chinesisch für mich.«
»Wir haben ja Zeit«, sagte Bodo und legte seine Hand auf Bradlys Schulter. Er lächelte.
»Du musst es ohnehin erfahren, damit du dich nicht verplapperst. Schade, dass du Ewald nicht persönlich kennengelernt hast.«
Marco und Ole nickten zustimmend. Schließlich kannten sie diese Geschichte.
Ewald bestand darauf, das Krankenhaus in Montreal zu verlassen. Allerdings hatten die Ärzte mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass die inneren Verletzungen noch nicht voll verheilt waren. Bei falschen Bewegungen oder Anstrengungen könnten die Nähte reißen, hatten sie Ewald sorgenvoll ans Herz gelegt. Die Folge wären innere Blutungen. Nach spätestens einer halben Stunde könnte sein Leben an einem seidenen Faden hängen.
Doch Ewald fühle sich wieder fit genug. Er wollte schließlich nicht an einem Marathonlauf teilnehmen. In den ersten Tagen seines Krankenhausaufenthaltes hatte er mit seinem Leben abgeschlossen. Dieses Leben war zwar nur kurz gewesen. Doch es war schön. Die herrlichen Bilder, die er gesehen und aufgenommen hatte, halfen ihm über die dunklen Tage des Krankenhausaufenthaltes hinweg. Jetzt wollte er unbedingt zur Hudson Bay. Nur das schien ihm wichtig. Die Jagd nach neuen Impressionen war wichtiger als alles andere auf dieser Welt. Es war wie eine Sucht.
Bodo bat Ewald, ihn begleiten zu dürfen. Er hatte die Worte der Ärzte weitaus ernster genommen als sein Freund. Deshalb wollte er auch den großen Jeep fahren. Damit war Ewald gerne einverstanden. Er und Bodo zu zweit durch Kanada – Das war ein Traum.
Bodo hatte sich die Route auf der Landkarte angeschaut, und Bedenken angemeldet. Sollte es zu einer inneren Blutung kommen, würde es äußerst gefährlich werden. Selbst der beste Hubschrauber würde die Strecke zum Abholpunkt und von dort bis zu einem Krankenhaus innerhalb einer halben Stunde niemals schaffen. Doch Ewald war euphorisch. Das Wetter war ideal. Er hatte viel nachzuholen.
Fast hinter jeder Wegbiegung tauchte ein neues Foto-Motiv auf. Ewald verhielt sich in dieser Hinsicht wie ein kleines Kind.
Am sechsten Tag passierte es dann. Knapp einhundert Kilometer südlich der Hudson Bay befand sich Ewald wie in einem Foto-Rausch.
»Halte da vorne Bodo. Schau dir diesen Wasserfall an.«
Bodo parkte den Jeep am Straßenrand und Ewald stürmte mit seiner Kamera auf den Wasserfall zu. Dieser rauschte über viele Kaskaden herab, über riesige Felsen, über und unter vielen Baumstämmen und Wurzeln. An den Rändern wucherte mannshoher Farn.
Ewald hatte immer schon Gegenlichtaufnahmen geliebt - oder zumindest, wenn die Sonne von der Seite auf das Motiv schien.
»Bodo, Bodo. Komm. Schau dir das an.« Er winkte hastig und lachte.
In diesem Augenblick rutschte er aus. Er hielt die Kamera nach oben. Die Kamera war für ihn immer das Wichtigste gewesen. Ihr durfte nichts passieren.
Aber genau dies sollte in diesem Moment der größte Fehler seines Lebens werden. Die linke Hand reichte nicht aus, um den Sturz abzufedern. Er war nicht mehr zu sehen.
Bodo hastete heran. Ewald hatte bereits versucht aufzustehen. Sein Gesicht war schmerzverzerrt. Er setzte sich am Rand des Wasserfalles auf einen Felsen.
»So eine Scheiße«, sagte er und blickte sich suchend um.
»Wo ist meine Kamera. Bodo, wo ist meine Kamera«, sagte er, dabei immer wieder hustend.
»Vergiss diese blöde Kamera. Du hast doch noch zwei in Reserve!«, erwiderte Bodo grob und kniete dabei vor Ewald.
»Wo genau hast du Schmerzen?«
Ewald bewegte suchend den Kopf.
»Ich brauche meine Kamera. Es ist meine Lieblingskamera«, sagte er fast weinend. Bodo nahm Ewalds Kopf in seine beiden Hände und zwang seinen Freund, ihm ins Gesicht zu sehen.
»Hast du dir was getan?! Du darfst nicht stürzen!! Kannst du gehen? Versuche es. Komm!«
Er versuchte, seinem Freund beim Aufstehen zu helfen. Hustend kam dieser endlich auf die Beine.
»Aber ich brauche trotzdem meine Kamera«, bettelte er.
»Okay, ich suche sie«, sagte Bodo und wühlte sich durch den mannshohen Farn. Nach zwei Minuten hatte er die Kamera schließlich gefunden. Er hob sie hoch und rief Ewald zu:
»Ich habe sie gefunden. Können wir jetzt weiterfahren?«
Ewald hatte sich wieder auf den Felsen gesetzt und zufrieden gelächelt. Bodo hängte sich die Kamera um, und half seinem Freund beim Aufstehen.
»Mist. Bodo, ich glaube, das ist doch keine Kleinigkeit«, sagte Ewald leise ächzend.
Bodo nahm ihn in die Arme und schüttelte seinen Freund leicht.
»Du musst noch viele schöne Aufnahmen machen. Lass uns in die nächste Stadt fahren. Du schaffst das.«
Gemeinsam brauchten sie fast fünfzehn Minuten, bis sie wieder beim Jeep angelangt waren; ewige und wertvolle Minuten, dachte Bodo und half dem Verletzten auf den Beifahrersitz. Ewald hustete und wischte sich den Mund ab.
Entsetzt musste er sehen, dass sein Handrücken voller Blut war. Bodo fuhr rasch. Die Straße ging steil bergauf. Oben, auf der Kuppe, hatte man einen weiten Blick über ein Meer von Bäumen.
»Stopp. Stopp. Fahre da vorne links in den kleinen Weg«, sagte Ewald aufgeregt.
»Bist du blöd«, entfuhr es Bodo.
»Wir müssen rasch in ein Krankenhaus.«
Ewald legte seine linke Hand auf Bodos Arm am Steuer und blickte ihn bittend an.
»Halte hier. Diesen herrlichen Ausblick will ich noch einmal genießen. Den will ich mitnehmen - auf die Reise, die vor mir liegt.«
Gegen seinen Willen bog Bodo in die kleine staubige Straße ab.
»Hier, ja hier ist es gut«, sagte Ewald leise.
»Das ist der schönste Ausblick, den ich jemals gesehen habe.«
Der Jeep stand inzwischen. Bodo beugte sich zu Ewald hinüber und versuchte, ihn in die Arme zu nehmen. Doch Ewald schob ihn sanft zurück.
»Lass uns aussteigen, mein Freund«, bat er leise.
»Hier bringen mich keine zehn Pferde mehr weg. Akzeptiere das. Bitte.«
Mit Tränen in den Augen hastete Bodo zur anderen Wagenseite, um Ewald beim Aussteigen zu helfen. Dieser biss die Zähne zusammen. Ganz offensichtlich versuchte er, den Schmerz zu verdrängen, und deutete mit dem Kopf nach vorn zu einem großen, flachen Felsen. In der Mitte des Felsens war eine Vertiefung gewesen; kniehoch und knapp zwei Meter breit.
»Wie ein riesiger, großer Sessel«, flüsterte Ewald. »Das ist ein Zeichen. Den hat Gott für mich gemacht. Enttäuschen wir ihn nicht.«
Er schleppte sich mit Bodos Hilfe zu diesem riesigen Stein und ließ sich mit einem zufriedenen Seufzer nieder.
Bodo nahm neben Ewald Platz und tastete nach dessen Hand. Dicke Tränen rannen über sein Gesicht. Er konnte sich nicht erinnern, wann und ob er überhaupt jemals geweint hatte. Nein, noch nie in seinem Leben hatte er geweint; noch nicht einmal auf der Beerdigung seiner Mutter.
»Heul nicht«, sagte Ewald leise in seinem leicht hessischen Dialekt.
»Jede Reise geht irgendwann zu Ende. Es hätte mir nichts Schöneres passieren können, als genau an diesem Ort ade zu sagen. Schau mal da runter mein Freund. Ist diese Erde nicht herrlich. Jetzt verstehe ich die Indianer, wenn sie sich die schönste Stelle des Tales für ihre letzte Ruhestätte ausgesucht haben.«
»Nichts, nichts«, krächzte Bodo mit belegter Stimme. »Das kann doch noch nicht alles gewesen sein. He, du darfst dich jetzt noch nicht davonmachen. Bitte. Ich brauche dich. Verdammt, in den letzten Jahren haben wir viel zu wenig zusammen unternommen. Erinnerst du dich noch?«
Ewald lächelte wieder sanft.
»Wir hatten wahnsinnig schöne Touren unternommen - in den Vogelsberg, in die Wälder bei Büdingen und Wächtersbach. Und in den Spessart. Ohne dich hätte ich das nie gesehen. Und vor allem: Ohne dich wäre ich kein Fotograf geworden. Ich danke dir für deine Freundschaft Bodo.« Er hielt kurz inne, um danach noch leiser fortzufahren: »Aber ich bin auch traurig darüber, dass es mir nicht gelungen ist, mehr Farbe in deine Seele zu locken. Wenn du die Natur liebst, dann musst du auch dich lieben können. Du bist schließlich auch ein Teil der Schöpfung. Dann musst du auch Gottes andere Garnitur lieben lernen.« Er versuchte krampfhaft ein Lächeln aufzusetzen.
»Zum Beispiel Iris … und die anderen herrlichen Frauen. Bitte Bodo, versprich mir, darüber nachzudenken.«
Mit einer ärgerlichen Miene schüttelte Bodo Ewalds Schulter.
»Du darfst nicht aufgeben!«, schrie er. »Komm, lass uns fahren. Wir schaffen das. Komm!«
Ewald versuchte, seine beiden Hände auf Bodos Schulter zu legen.
»Ich habe ein schönes Leben gehabt. Keine Stunde möchte ich missen. Diese herrlichen Landschaften. Diese Wunder unseres Schöpfers. Die Sonnenaufgänge. Diese Jahreszeiten. Diese einzigartigen Lebewesen. Ich werde diese Bilder mit auf die Reise nehmen. Das macht es mir leichter Bodo.«
»Nein. Nein. Nein«, jammerte Bodo und riss sich von Ewald los.
»Was soll ich ohne dich?! Scheiße. Ich hätte mehr Zeit mit dir verbringen müssen. Komm. Bitte. Lasse und das nachholen. Es gibt bestimmt noch so viel Schönes, was du mir zeigen kannst. Ich habe vieles falsch gemacht.«
Ewald versuchte ein Lächeln aufzusetzen. Blut rann aus seinen Mundwinkeln.
»Sei vernünftig Bodo«, keuchte er. »Mein Weg war mein Weg. Und der war richtig und wundervoll.«
Jetzt legte er wieder seine beiden Hände auf Bodos Schulter.
»Ich habe deinen Weg zuweilen kritisch gesehen. In den letzten Tagen hatte ich Zeit, darüber nachzudenken.«
Ewald blickte Bodo tief in die Augen.
»Bodo, mein Freund. Auch dein Weg ist richtig. Er ist weitaus wichtiger als der Weg, den ich gegangen bin. Wer weiß … Vielleicht gibt es da oben eine Macht, die wir beide nicht begreifen. Vielleicht gibt es einen Plan. Und sollte es diesen Plan geben, so ist es dein Weg … so ist es dein Schicksal, deine Kraft dich für den Erhalt der Schöpfung auf unserer Erde einzusetzen. Wer weiß … Vielleicht hat dich der Schöpfer bereits in deiner Kindheit sensibilisiert. Du hast es wahrscheinlich oft als Fluch eingestuft. Ohne Zweifel war es schon ein Segen für viele Lebewesen, die du in den letzten Jahren gerettet hast. Gehe diesen Weg weiter Bodo. Ich hoffe, dass er nicht dort enden wird, wo ich mich gerade befinde. Ich hoffe, dass du dann ähnlich fühlst wie ich in diesem Moment.«
Ewald strich sanft über Bodos Kopf.
»Sei nicht traurig mein Freund. Es war eine schöne Zeit. Und nur das zählt.«
Als Bodo im Begriff war zu antworten, unterbrach ihn Ewald barsch:
»Lass uns nicht streiten. Und lass uns vor allem keine Zeit verlieren. Wir müssen noch einiges besprechen. In aller Ruhe. Einverstanden?«
Bodos Arme sackten müde nach unten.
Der hünenhafte Mann wirkte wie ein Häuflein Elend; fast wie ein Kind. Er blickte nun Ewald bittend an.
»In meinem Leben gab es doch nur meine Mutter … und dich. Bitte Ewald. Ich brauche dich. Du darfst nicht …«
»Bodo lasse uns vernünftig miteinander sprechen«, bat Ewald mit erstaunlich fester Stimme.
»Wir haben nicht mehr so viel Zeit!«
Bodo konnte nur noch stumm nicken.
»Versprich mir zunächst, dass du dich um meine Mutter kümmerst. Für sie bist du ihr zweiter Sohn geworden. Das weißt du.«
»Das ist doch selbstverständlich«, antwortete Bodo und blickte dabei Ewald in die Augen. »Du kannst dich auf mich verlassen.«
Ewald lächelte dankbar. »Halte mich jetzt nicht für verrückt Bodo. Ich will in dir weiterleben – zumindest ab und zu.«
Bodo sah seinen Freund irritiert und fragend an. Dieser machte eine beruhigende Handbewegung.
»Im Krankenhaus habe ich es mir genau überlegt. Nimm bitte dann meine Identität an, wenn diese für dich und deine Ziele hilfreich ist. Wir haben die gleiche Statur. Und wenn du genau hinschaust, sehen wir uns sogar ähnlich. Du bist clever genug, alles Übrige in die Wege zu leiten. Nimm meinen Pass, meine Schlüssel und meine Kameraausrüstung. Wir haben früher viel zusammen fotografiert. Du wirst am Anfang vielleicht keine so guten Aufnahmen wie ich machen. Dafür werden deine Texte bei weitem besser sein, als meine. Das wird dir viele Türen in vielen Ländern öffnen, wo du sonst Schwierigkeiten hättest. Du wirst sehen.«
Ein Hustenanfall unterbrach jäh Ewalds weitere Ausführungen. Er hielt sich die rechte Hand vor den Mund. Blut rann zwischen seinen Fingern hervor. Bodo suchte rasch einige Taschentücher und kniete sich vor Ewald, der dankend die Taschentücher nahm, und sich das Blut von seinen Lippen und von seinen Händen wischte.
»Du siehst, eine Weiterfahrt hätte absolut nichts gebracht. Wir hätten keine Zeit gehabt, noch einmal miteinander zu sprechen. Das wäre unentschuldbar gewesen.« Seine Gesichtszüge begannen, sich zu verkrampfen. Als Bodo etwas sagen wollen, bat Ewald mit entsprechenden Handbewegungen, ihn weitersprechen zu lassen.
»Zuhause habe ich alle Unterlagen mit den Verlagen genau geordnet. Du schaffst das.« Er machte eine Pause, als wollte er sicherstellen, dass Bodo alles verstanden hatte.
»Die Idee ist zwar verrückt«, sagte Bodo. »Aber …«
»Kein aber. Du musst es mir versprechen! Ich werde immer bei dir sein. Immer - bei meinem Freund.«
Ein neuer und stärkerer Hustenanfall kostete Ewald viel Kraft. Bodo hielt die Schulter seines Freundes. Plötzlich wurde ihm voll bewusst, dass er nicht mehr helfen konnte. Ewald streckte seine rechte Hand aus und deutete mit dem Zeigefinger zum Rand des Plateaus. Dann sank sein Kopf nach unten. Bodo fühlte, wie alle Kraft aus dem großen Körper entwich. Sanft zog er Ewald an seine Schulter.
Er wusste später nicht mehr, wie lange er den leblosen Körper in den Armen gehalten hatte. Es begann zu dämmern. Die blutrote Sonne hatte gerade den Horizont erreicht. Bald würde es dunkel werden. Bodo ließ seinen Blick über das Meer an Bäumen gleiten. Noch immer konnte er keinen klaren Gedanken fassen. Doch plötzlich, plötzlich wusste er, was Ewald ihm mit seiner letzten Handbewegung sagen wollte. Dort vorn, am Rande des Plateaus mit einem herrlichen Blick in die Weite, war eine tiefere Mulde. Daneben stand eine uralte kanadische Eiche mit weit ausladenden Ästen. Die Spitze der Eiche war bereits kahl gewesen. Dort, unter dieser Eiche, mit einem weiten Blick in das Tal, wollte Ewald seine letzte Ruhestätte haben. Und diesen letzten Wunsch musste er ihm jetzt erfüllen.