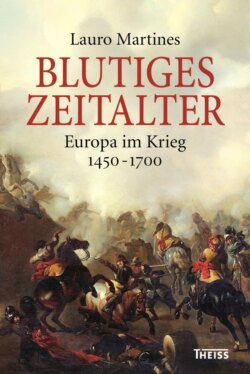Читать книгу Blutiges Zeitalter - Lauro Martines - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Rekruten und Fahnenflüchtige
ОглавлениеAls Erstes zeigte sich die Notwendigkeit, Menschen zu den Waffen zu zwingen, im England des ausgehenden 16. Jahrhunderts, dann in Spanien, in den 1620er-Jahren in Schweden und danach in Frankreich und Deutschland – und das, obwohl jene Länder weiterhin Söldnerarmeen unterhielten.
Die Venezianische und die Niederländische Republik waren immer von Söldnertruppen abhängig. Sie standen im Ruf, ein wenig großzügiger zu sein als andere Staaten, was die Bezahlung betraf, insbesondere im 17. Jahrhundert, als auf dem internationalen Söldnermarkt starke Konkurrenz herrschte. Frankreich, Spanien und die deutschen Fürsten wollten ebenfalls ihren Anteil am verfügbaren Pool kampfbereiter Männer.
Ich betone die Zwangsrekrutierung deshalb in besonderem Maße, weil dieses Vorgehen (genau wie das Anheben der Steuern und das Erfinden immer neuer Abgaben) den Weg hin zur sich entwickelnden Staatsmacht kennzeichnet.
In den 1580er-Jahren, als Königin Elisabeth I. von England einen Feldzug anstrengte, um das katholische Irland dem Protestantismus zu unterwerfen, begann ihr Geheimer Rat damit, immer mehr Zwangsrekruten über die Irische See zu schicken. Der Krieg dort hatte sich zu einer grauenvollen Katastrophe ausgewachsen: Walisische und englische Soldaten beschrieben Irland als einen regelrechten Friedhof, einen Ort, wo nichts als Hunger und tödliche Krankheiten herrschten. Das hatte sich herumgesprochen, und so war kaum noch jemand bereit, dorthinzugehen. Man musste die Soldaten mit Waffengewalt in den Dienst Ihrer Majestät zwingen. In Chester gab es damals ein Sprichwort: „Besser zu Hause aufgehängt, als wie ein Hund in Irland sterben.“
Ein Beispiel: Im Jahr 1600 lebten in den Garnisonen von Derry von ursprünglich 4000 Mann, die erst im Jahr zuvor bei diesen Außenposten eingetroffen waren, nicht einmal mehr 1500. Der Rest war von Ruhr, Typhus und anderen Ursachen dahingerafft worden. Kein Wunder, dass die Zwangsrekrutierung für den Irland-Feldzug „in der Nähe von Chester in den Jahren 1574, 1578, 1580, 1581, 1594 und 1596“ Meutereien provozierte. Die Meuterei war die erste Stufe des entschlossenen Widerstands; die zweite waren Massendesertionen. Obwohl die Zwangsrekruten gut bewacht und häufig auch eingesperrt wurden, gelang immer wieder einigen die Flucht, mitunter sogar noch, bevor die Segel gehisst wurden.
Schätzungen zufolge wurden zwischen 1585 und 1602 etwa 30.000 bis 40.000 Menschen aus England und Wales nach Irland verschifft. Dazu zählten auch ein paar wenige Söhne von Kleinbauern, die sich freiwillig gemeldet hatten, um sozial aufzusteigen, und die die Offizierslaufbahn anstrebten. Doch die große Mehrheit waren zwangsrekrutierte Soldaten, und ihr Zustand, physisch wie moralisch, trieb die Offiziellen oft zur Verzweiflung. Ein Bericht aus Bristol beschreibt die Neuankömmlinge folgendermaßen: „Die meisten von ihnen [sind] entweder lahm, krank, jung oder gemeine Schurken. Nur wenige ihnen besitzen überhaupt Kleidung; kleine, schwache, verhungerte Körper, die auf Jahrmärkten und Straßen aufgegabelt wurden, um den Platz besserer Männer einzunehmen, die man daheim ließ.“
Die für Musterungen zuständigen Offiziere kehrten mitunter mit ganzen Trupps zu ihren Stützpunkten zurück. Ein Zeitgenosse behauptete, die Zwangsrekrutierung werde dazu verwendet, ganze Gemeinden „von Schurken, Bummelanten, Trinkern und solchen, die nicht anders leben können“, zu reinigen. Ein anderer schrieb, er hätte eine Gruppe von Rekruten gerne gemalt – wann sähe man schon einmal „so viele seltsame, hinfällige Menschen“, die aussahen, als „gehörten sie in ein Spital“. Im März 1595 erreichten etwa 1500 Mann, die in der Bretagne gedient hatten, das irische Waterford. In Dublin besah sie sich William Russell, der neue Stellvertreter der englischen Krone in Irland, und merkte an: „Was … sind das bloß für Soldaten? Sie sehen aus, als kämen sie direkt aus den Londoner Gefängnissen.“ Und tatsächlich wurden manchmal so dringend Soldaten benötigt, dass man verurteilte Verbrecher aus dem Gefängnis entließ, um sie direkt ins Ausland in den Militärdienst zu schicken.
Die englische Praxis der Zwangsrekrutierung kam in der Mitte jenes Jahrhunderts auf, unter Heinrich VIII., und dauerte bis ins 19. Jahrhundert fort. Das Vorgehen dabei, von den illegalen Methoden bis hin zu den Auswahlkriterien, roch stets nach sozialer Säuberung. Während des Englischen Bürgerkriegs in den 1640er-Jahren akzeptierte sogar das Parlament die Praxis der Zwangsrekrutierung.
Ins Visier gerieten dabei zuallererst „herrenlose Männer“: Arbeitslose, Obdachlose, „Faulenzer“ und Bettler, aber auch einfach arme Leute aus Stadt und Land. Solche Menschen galten stets als Freiwild, und das wichtigste Zentrum der überzeugungsstarken, aber vor allem gewalttätigen Rekrutierer war London.
Noch härter als England und Wales traf es die armen Landstriche Schottlands. Schätzungen gehen davon aus, dass während des Dreißigjährigen Kriegs (1618–1648) 25.000 bis 50.000 Schotten in fremden Armeen dienten. In den Niederlanden und in Deutschland waren sie so zahlreich, dass sie mitunter (um mit einer bösartigen zeitgenössischen Hyperbel zu sprechen) „auf den Schlachtfeldern Europas so allgegenwärtig waren wie Läuse und Ratten“. Viele von ihnen waren Freiwillige, angetrieben von ihrem Glauben an den von Schottland getragenen calvinistischen Kampf gegen das „Papsttum“ – oder von quälendem Hunger und der Hoffnung auf Beute auf dem Kontinent. Aber weitaus mehr Soldaten wurden zwangsrekrutiert, und einige ließ man vor der Abreise sogar schwören, dass sie nie wieder nach Schottland zurückkehren würden (unter Androhung der Todesstrafe). Doch nicht nur die Briten griffen zum Mittel der Zwangsrekrutierung, es gab sie auch auf dem Kontinent, vor allem in Spanien.
Im Achtzigjährigen Krieg (1567–1648) machten die habsburgischen Könige von Spanien ihren dynastischen Anspruch auf die Niederlande mittels Armeen deutlich, in denen vor allem ausländische Söldner dienten. Es scheint, als seien in diesen Armeen kaum mehr als 15 Prozent der Soldaten spanischer Herkunft gewesen. Letztere stammten fast zur Gänze aus Kastilien, so dass dort bis Ende des 16. Jahrhunderts fast keine erwachsenen Männer mehr lebten. Aufgrund des chronischen Mangels an Soldaten entschied sich die Krone nun für ein Vorgehen, das für explosive emotionale Szenen sorgte – auch wenn man sich dabei der lokalen Unterstützung der klassenbewussten Gemeinden bediente, die das Ganze ihrerseits zur sozialen Säuberung missbrauchten: Im Bemühen um Fairness hielt man in den Städten Spaniens Lotterien ab, bei denen Männer für den Kriegsdienst ausgewählt wurden. Doch abgesehen von den Massendesertionen, zu denen diese Lotterien führten, waren sie geradezu prädestiniert für die Stadtoberen, sich Gesetzeslücken, Listen, Betrügereien und persönlicher Beziehungen zu bedienen, um ihre Günstlinge aus dem Kriegsdienst herauszuhalten. Häufig bezahlten auch die Besserverdienenden andere Einheimische, um an ihrer statt in den Krieg zu ziehen. Wenn das nicht klappte, warben sie irgendwelche Fremden an, um die Quoten ihrer Gemeinde zu erfüllen. Bestimmte Gruppen waren zunächst vom Wehrdienst befreit: Adlige, städtische Beamte, Zöllner, Studenten der Universitäten, Bedienstete der Adligen und der Inquisition, aber auch Schafhirten und bestimmte Arbeitergruppen. Doch der Druck der königlichen Politik wuchs, und ab den 1630er-Jahren wurden auch bestimmte zuvor freigestellte hidalgos (Adlige) rekrutiert, obgleich viele von ihnen so arm waren, dass sie nicht einmal ein Pferd unterhalten konnten.
Für den Kriegsrat des Königs war es ganz selbstverständlich, dass 18–25 Prozent der Männer, die gemustert wurden, auf dem Weg zur Einschiffung desertierten; laut I. A. A. Thompson „eine grobe Fehleinschätzung“, denn „die Kompanien verloren auf dem Marsch meistens die Hälfte oder sogar zwei Drittel ihrer Männer“. Im September 1636 merkte der Erzbischof von Burgos in einem Brief an König Philipp IV. an, dass in seiner Diözese die meisten der (durch die Lotterie oder mit Gewalt) Rekrutierten „Hungers sterben, bevor sie die Garnisonen erreichen“. In Zamora und Salamanca würden zwangsrekrutierte Männer „in Stricken und Handschellen abgeführt“. Üblich war es zudem, die neuen Rekruten ins Gefängnis zu stecken, bevor man losmarschierte. Im Sommer 1641 saßen in der Stadt Béjar 17 Mann im Gefängnis, die für eine Garnison bestimmt waren. Nur drei von ihnen waren Einheimische, die anderen „gekaufte“ Ortsfremde.
Im frühen 17. Jahrhundert müssen täglich tausende Deserteure auf der Flucht die Iberische Halbinsel durchstreift haben, die versuchten, der Obrigkeit zu entgehen, sich zu verstecken und nach Hause oder an einen anderen Ort zu gelangen. Andere wollten zu ihren Kommandos zurückkehren oder saßen in den Gefängnissen und warteten auf ihren Prozess. Ganze Städte rebellierten gegen die Zwangsrekrutierung, so der Küstenort Murcia, und die Einwohner waren durchaus bereit, die Anwerber des Königs zu massakrieren. Im August 1641 befreiten in Alburquerque 200 bewaffnete Männer eine Gruppe von Rekruten, nahmen ihnen die Handfesseln ab und ließen sie fliehen, während sie ihren militärischen Begleitern mit dem Tod drohten. Und im September desselben Jahres befreite eine bewaffnete Bande gleich hinter der Grenze zu Portugal ebenfalls eine Gruppe an den Händen gefesselter und angeketteter Rekruten.
Dabei war der Widerstand gegen die Zwangsrekrutierung in Kastilien noch vergleichsweise harmlos gegenüber dem in Katalonien, einer Provinz des alten Königreichs von Aragón. Im Jahr 1636 konnten die königlichen Agenten hier, wie der Historiker Luis Corteguera ausführt, lediglich „Verbrecher“ rekrutieren, „deren Todesurteil in Militärdienst umgewandelt worden war“. Im Juni jenes Jahres wurden in Barcelona sechs Erntehelfer ins Haus eines Rekrutierers gelockt und mit Gewalt dort festgehalten, um sich in die Armee einzuschreiben. Bald kamen ein paar ihrer Kollegen, um gegen das Vorgehen zu protestieren; sie wurden von Bewaffneten begrüßt, die vom Regionalgouverneur dorthin beordert worden waren. Die Kollegen der Gefangenen kamen mit 500 Erntehelfern zurück. Sie erstürmten und plünderten das Haus.
Erst der drohende Krieg mit Frankreich brachte die Katalanen dazu, ihre Region militärisch zu verteidigen, wenn auch mit wenig Begeisterung. Im August 1639 gelang es den Beamten, eine Armee von 10.000 Mann aufzustellen, um den Vormarsch einer französischen Armee in der Provinz Rosselló im Nordosten Spaniens aufzuhalten. Doch beinah sofort desertierten 2000 von ihnen, und bereits im November „fehlten“ mehr als 9000 katalanische Soldaten des Rosselló-Feldzugs; natürlich fiel eine große Zahl jener Männer auch Krankheiten zum Opfer oder starb in der Schlacht. Als die Franzosen Anfang Januar 1640 nach der Belagerung von Salses kapitulierten, waren „4.000 bis 10.000 Katalanen“ gestorben, darunter „ein Viertel des Adels“; alle waren „Krankheit und Wunden“ erlegen. Noch vor Ende des Jahres brach in Katalonien eine Revolte ungekannten Ausmaßes aus, als bekannt wurde, dass die königliche Regierung vorhatte, in Rosselló Truppen einzuquartieren, die im Frühjahr gegen die Franzosen zu Felde ziehen sollten.
Die wütenden Katalanen kündigten dem König von Spanien im Januar 1641 die Treue auf und „wählten Frankreichs Ludwig XIII. zu ihrem neuen König“. Und damit begann eine ganz andere Geschichte, die der Historiker J. H. Elliott in seinem Werk The Revolt of the Catalans meisterhaft erzählt hat.
In Osteuropa, jenseits der Elbe, wo die Leibeigenschaft eine Renaissance erlebte und ohnehin tiefer verwurzelt war, war es vor allem eine äußerst brutale Angelegenheit, Männer zum Kriegsdienst zu verschleppen. Im zaristischen Russland gab es in den 1630er-Jahren eine Wehrpflicht, bei der sich von je zehn oder zwanzig Haushalten ein Bauer melden musste, darunter auch Knaben von gerade einmal 14 oder 15 Jahren. Auch Adlige, vor allem verarmte, wurden eingezogen, und sie fast immer entschieden sie sich für die Kavallerie. Unter Peter I., um 1700 herum, musste auf 50 bis 150 Haushalte ein Mann zur Armee gehen, je nach Bedarf.
Die Bedingungen in der russischen Armee waren genau so, wie man es erwarten würde. Die Soldaten mussten oft frieren und hungern, und sie wurden nur selten, wenn überhaupt, rechtzeitig oder in voller Höhe ausbezahlt. Abgesehen davon, dass man routinemäßig die Hälfte ihres Solds für Kleidung einbehielt, wurden sie teilweise bloß in Naturalien bezahlt. Hauptleute schlugen ihre Soldaten wie Herren ihre Leibeigenen. Fahnenflucht war weit verbreitet, und Anfang des 18. Jahrhunderts terrorisierten organisierte Banden von Deserteuren gelegentlich die ländlichen Gemeinden.
Peter I. ließ sie in Eisen legen; sie mussten mit den beschwerlichen Fesseln mitunter hunderte Meilen marschierten, bis sie ihr Ziel erreichten. Die Strafen für Deserteure waren äußerst hart: Sie wurden geschlagen, gehängt oder zu einem Leben in Zwangsarbeit verurteilt. „Auf dem Rückmarsch vom Pruth im Jahr 1711“, erfahren wir bei Hughes, „wurden im Lager jede Nacht Galgen aufgestellt, um potenzielle Deserteure an das Schicksal zu erinnern, das sie erwartete.“ Die Jagd auf Fahnenflüchtige konnte auch zu schweren Repressalien gegen ihre ganze Gemeinden führen oder ihre Familien – die Gemeinden zwang man, Ersatz oder Garantien bereitzustellen, und Familienmitglieder „wurden als Geiseln genommen, bis sie [die Deserteure] sich ergaben“. John Keep stellt fest, dass die Rekrutierung in Russland für eine wütende öffentliche Debatte sorgte, „denn jeder wusste, dass ein Rekrut … seine Familie wahrscheinlich nie wiedersah.“
Die Gründe für den leidenschaftlichen Widerstand gegen die Zwangsrekrutierung sind nicht schwer zu ergründen. In Spanien wie in England war diese Praxis eine äußerst einseitige Angelegenheit und lud geradezu dazu ein, seine Beziehungen spielen zu lassen. Wo die Auswahl der notwendigen Rekruten den örtlichen Feudalherren oder Gemeinden anheimfiel, wie in Schweden, Brandenburg oder Russland, kamen Eigeninteressen und lokale Vorlieben oder Abneigungen ins Spiel. Im Europa der Frühen Neuzeit mit seinen „natürlichen“ Hierarchien und Privilegien hatte man dies zu tolerieren.
So war das Leben eben. Was kein Leben war, zumindest in der Überzeugung des rebellischen Volkes, das war das Dasein des einfachen Soldaten. Ob Lotterie, selektive Wehrpflicht oder Entführungen, die Zwangsrekrutierung galt oft als eine Art Todesurteil. Die Männer wussten – das hatte sich durchaus herumgesprochen –, dass das Heer ein Hort von Krankheiten, Hunger und vielen anderen Auswüchsen des Elends war, nicht zuletzt eisiger Kälte und sadistischer Offiziere. Und was folgte daraus? Dass es besser war, zu Hause zu sterben, in der eigenen schmutzigen Armut, als noch elender in einem fremden Land. Der Teufel, den man kannte, war besser als einer, den man erst noch kennenlernen musste.
Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts wurde der Agrarstaat Schweden vom notleidenden Adel und den über allem stehenden Zielen der Wasa-Könige in eine dichte Abfolge von Kriegen gezwungen. Besonders akut wurde der Bedarf an Rekruten (sprich: Bauern) im Dreißigjährigen Krieg; es gab einen Zeitpunkt, als die Bauernschaft für jede acht Haushalte einen Sohn stellen musste. Der König brauchte immer mehr Nachschub. Zwischen 1626 und 1630 stellten die Schweden und Finnen (damals unter schwedischer Herrschaft) Gustav Adolf 51.367 Wehrpflichtige, von denen bis 1630 35.000 bis 40.000 ums Leben kamen, vor allem durch Krankheiten. Die bäuerlichen Gemeinden waren zu weit verstreut, um organisierten Widerstand zu leisten, stattdessen arbeiteten sie offenbar mit der Obrigkeit zusammen. Immerhin behielten sie die Entscheidungsgewalt darüber, wen sie auswählten, damit er in fernen Gegenden im Krieg sterben würde. Wohlhabende Bauern nahmen arme kleine Jungen in ihren Häusern auf, ernährten und kleideten sie, ließen sie für sich arbeiten, und dann, wenn das Heer anklopfte, übergaben sie sie als Ersatz für ihre eigenen Söhne. So mussten weder die Bauern noch ihre Kinder nach Deutschland in den Tod ziehen. Im Zusammenhang mit dieser Praxis kommt der Historiker Robert I. Frost zu dem Schluss, dass im Hinblick auf „ein wachsendes landloses Proletariat“ in Schweden und Finnland, aus dem „der Militärstaat sein Kanonenfutter zog“, das eben erwähnte System „für alle von Vorteil war: Die Regierung bekam ihre Soldaten, der Bauer musste nicht in den Krieg ziehen, und Kinder aus armen Haushalten konnten besser aufwachsen“. Ja, er meint sogar, die armen Familien „profitierten ebenfalls: Sie hatten ein hungriges Maul weniger zu füttern“. Zu dumm, dass er dabei vergisst, dass der auserwählte junge Mann bald auf dem Weg in Richtung Krankheit, Hunger und Verwundung war.
Im 16. Jahrhundert wuchs die Bevölkerung Europas von etwa 62 Millionen im Jahr 1500 auf etwa 78 Millionen um 1600. Doch aufgrund von Epidemien, schlechtem Wetter und Ernteausfällen verringerte sich die Wachstumsrate in den 1590er-Jahren wieder.
In Spanien, Deutschland und Italien schrumpfte die Bevölkerung. Auch Kriege behinderten das Wachstum, indem sie Krankheiten verbreiteten und die Produktionszyklen der Landwirtschaft zerstörten. Mit ihrer Forderung nach größeren Armeen, die länger dienten, griffen die Fürstenstaaten immer tiefer in den Pool der Männer, die in der Lage waren, Spieße und andere Waffen auch nur zu tragen. In den frühen 1630er-Jahren, auf dem Höhepunkt des Dreißigjährigen Kriegs, der ganz Europa erfasste, sahen die Feldkommandanten eine so dramatische Verschwendung von Soldaten, dass es geradezu unmöglich wurde, die benötigten Freiwilligen finden – oder sogar genügend Männer, die man zwangsweise rekrutieren konnte. Deshalb endeten die Schlachten nun für gewöhnlich mit der Zwangsrekrutierung einer großen Zahl der feindlichen Soldaten, die nun auf der Gewinnerseite weiterkämpfen sollten. Im Zuge ihres glänzenden Siegs bei Breitenfeld (1631) verleibte sich die protestantische Armee von Gustav Adolf die Regimenter des besiegten kaiserlichen Feldherrn Tilly ein. Aber zu ihrem eigenen Glück „desertierten sie alle im folgenden Jahr, sobald sie in Sichtweite der Alpen kamen“. Obwohl es ein religiöser Konflikt war, der den Dreißigjährigen Krieg ausgelöst hatte, war er bald nicht mehr als ein blutiger Kampf um Territorien und Beute, der nur nach außen hin als Konflikt um dynastische, religiöse oder sicherheitspolitische Fragen verkauft wurde. Dass man den besiegten Feind zwang, ab sofort bei einem selbst mitzumarschieren, kam daher weit weniger selten vor, als man meinen sollte.
Frankreich trat 1635 in den Dreißigjährigen Krieg ein, unter Führung von Kardinal Richelieu, angeblich um die Expansion der spanischen und deutschen Herrscherhäuser einzudämmen. Von diesem Zeitpunkt an bedienten sich die Franzosen der Praxis der Zwangsrekrutierung. Dank des Einflusses der Aristokraten in den Gemeinden waren viele (adlige) Offiziere zunächst zwar in der Lage, ganze Kompanien Freiwilliger zusammenzutrommeln: ihre eigenen Pächter, Diener, Mandanten und viele andere mehr. Doch für die ambitionierten Ziele der Krone reichten die Zahlen nicht aus.
In den 1640er- und 1650er-Jahren wandten französische Rekrutierer Alkohol und diverse Tricks an, um ihre Opfer einzufangen. Sie machten sie betrunken, lockten sie mit Hilfe von Prostituierten an oder steckten ihnen Münzen in die Tasche, nur um später zu schwören, dass der Mann eine Anwerbeprämie akzeptiert habe. Aber die Quoten erfüllte man meist leichter, indem man Gewalt anwandte. Rekrutierer hielten Reisende fest, griffen Männer auf der Straße auf, brachen in Häuser ein und fanden ihre Opfer manchmal sogar in der Kirche. Auf dem Land war es leichter, Gewalt zu brauchen, als in der Stadt, aber bei Landbewohnern war es wiederum wahrscheinlicher, dass es ihnen gelang, vor den Anwerbern zu fliehen oder sich zu verstecken. In den 1670er-Jahren berichteten Beamte, „dass aufgrund eine drohenden Zwangsrekrutierung die Märkte wie leergefegt waren und die Bauern nicht wagten, ihre Häuser zu verlassen“. Während des Pfälzischen Erbfolgekriegs (1688–1697) behauptete ein Offizier der Krone in einem Brief aus Orléans, dass „die Märkte voll sind von Männern, die andere mit Gewalt fortschleppen“. Der Spanische Erbfolgekrieg (1702–1714) führte ebenfalls zu einer regelrechten Flut von Zwangsrekrutierungen. Ab und an taten sich aber auch Bauern zusammen, die die Rekrutierer ihrerseits tätlich angriffen und die Entführten wieder befreiten. In den 1690er-Jahren gab ein führender Minister ganz freimütig zu: „Die Anwerbungen werden noch immer fast alle auf betrügerische Weise herbeigeführt“. Im Jahr 1706 wiederholte er dieses Eingeständnis noch einmal.
Die Aktivitäten der Anwerberbanden waren für die Regierung ziemlich peinlich, und es wurden Edikte gegen derlei Strategien erlassen. Aber die Anforderungen des Kriegs und die aggressive Außenpolitik Ludwigs XIV. setzten voraus, dass die Minister die Praxis trotz allem stillschweigend billigten. Die größte Stütze des Systems waren hinterhältige Offiziere: „Sie zwangen persönlich Männer und Knaben in die Armee, darunter auch Mönche, Notare, Greise und sogar Ladenbesitzer, denen ihr relativer Wohlstand wenig Anlass gab, das Silber des Königs zu nehmen.“ In einem Fall musste einer der leitenden Polizeifunktionäre von Paris einschreiten, als ein Kavalleriehauptmann einen Schuhmacher mit Gewalt in die Armee zwingen wollte. Dessen Forderungen basierten auf einer Unterschrift, die unter Vorspiegelung falscher Tatsachen eingeholt worden war, und der Hauptmann drohte, den Schuster zu töten, wenn er sich weigerte, seinem Regiment beizutreten.
Rekrutierungsoffiziere arbeiteten auch mit Schlägertrupps zusammen, den sogenannten racoleurs („Anwerber“), die ihr Handwerk in Städten wie Paris und Lyon versahen. Ihre Opfer sperrten sie ein und verkauften sie als neue Rekruten an die Offiziere. So landete das Geld, das der König für die Rekrutierung bereitstellte, in zahlreichen Händen.
Der Dreißigjährige Krieg brachte Deutschland ein so furchtbares Gemetzel und Blutvergießen, dass die regionalen Eliten nach Ende des Kriegs 1648 mit Steuererhöhungen auf den Druck der Fürsten reagierten, die nun permanente Armeen einrichten wollten. Diese würden – so lautete das Argument – in erster Linie die Sicherheit eines Landes garantieren. Aber schon bald erwies sich die Rekrutierung als problematische Angelegenheit. Die deutsche Wirtschaft erholte sich nach dem Krieg wieder, und die Menschen waren wieder in der Lage, mit ihrer täglichen Arbeit in der Stadt und auf dem Land ihren Lebensunterhalt zu bestreiten; die Territorialfürsten indes stellten fest, dass sie nicht über die Summen verfügten, die nötig waren, um die notwendige Anzahl von Männern in die neuen Armeen zu locken. Dazu reichten die Steuern nicht, und ohnehin gab es selten genug Freiwillige. Kam es hart auf hart, konnte es zumindest eine Teillösung sein (die wir aus Frankreich, England und Spanien kennen), Männer aus der Haft zu entlassen und dafür in die Armee zu stecken. Im Herzogtum Wolfenbüttel wurden Schwerverbrecher bereits vor den 1630er-Jahren regelmäßig „zum Kriege verurteilt“ oder aus dem Gefängnis freigelassen, um an der Front zu dienen; ihre Reise ging dann in die Niederlande oder in das ungarischtürkische Grenzgebiet. Später wurde es regelrecht üblich, dass fürstliche Regierungen in Deutschland den Militärdienst als Ersatz für Gefängnisstrafen anboten und gelegentlich sogar für die Todesstrafe.
Generell jedoch griffen die Rekrutierer, zum Beispiel Brandenburg und Sachsen, weit häufiger zu Listen oder setzten ihre Opfer kurzerhand auf brutale Weise fest. Der Anwerber tauchte mit seinen Helfern, die ihre Identität verbargen, in einer billigen Absteige oder zwielichtigen Spelunke auf, wo es kein großes Aufsehen erregte, wenn einer der Gäste „verschwand“. Wenn die Anwerbeprämie als Anreiz nicht ausreichte, taten Wein und Branntwein das Ihrige, und daneben „halfen Heimtücke und Schläge“. So in Ostfriesland im Jahr 1665, wo die arme Hilke Wessels klagte, wenn ihr Mann nicht so brutal angegangen worden wäre, „hätte er sich nie träumen lassen, Soldat zu werden!“
In Preußen war der Heeresanwerber bis in die 1730er-Jahre „das am meisten gefürchtete Individuum im ganzen Land“. Um einem – wie sie es sahen – Leben der Misshandlung zu entgehen, verstümmelten junge Bauern sich selbst oder flohen von zu Hause; mitunter nahmen sogar ganze Dörfer Reißaus. Angesichts solchen Widerstands gegen die Rekrutierung „war das Töten von [preußischen] Subjekten … keine Seltenheit“. Manchmal trafen die Rekrutierer geheime Vereinbarungen mit bestimmten Kneipen oder Gastwirten. Aber manchmal wurden ihre Signale missverstanden, und gelegentlich kam es so zu Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Anwerbern und deren Gefolge, die sich um ein und dasselbe Opfer stritten. Die Rekrutierung war ein Geschäft, und es bestanden scharfe Rivalitäten, die Agenten der Werber feilschten um ihre Beute. Sie sprachen davon, dass sie die Männer „ablieferten“, „schuldeten“, „ausliehen“ und „borgten“; neue Rekruten „verkauften“ sie an Hauptleute und Offiziere. Und neben all ihren rücksichtslosen Betrügereien und üblen Machenschaften hielten die Offiziere ihre Regierungen dazu an, mit großer Härte gegen Fahnenflüchtige vorzugehen. Sie bestanden auf ihrem Recht gegenüber den Deserteuren, brachen mitten in der Nacht in ihre Häuser ein, zerrten ihre Opfer auf die Straße und schleppten sie fort.
Im Deutschland des 16. Jahrhunderts hatten die Landsknechte, professionelle Pikeniere, einen recht zweifelhaften Ruf. Mit ihren grellbunten Kleidern und Hosenbeuteln galten sie als Störenfriede, als Teufel, Vielfraße und Aufschneider, die ein geordnetes Leben ablehnten. Aber diese Sichtweise machte sie nicht zwangsläufig zu „Abschaum der Unterschicht“. Später, in den Wirren des Dreißigjährigen Kriegs, galten sie bei einigen Zeitgenossen rückblickend sogar als Patrioten. Nach 1650 jedoch begann man in Deutschland Soldaten generell in einem anderen Licht zu sehen, und zwar vor allem wegen der Rekrutierung Krimineller und der Zwangsverpflichtung von Subjekten aus den untersten Niederungen der Gesellschaft – Landstreicher, Bettler, Außenseiter und Arme, mit denen keiner etwas zu tun haben wollte. Kein fleißiger Bauer oder Handwerker wollte neben solchen Menschen in Reih und Glied stehen, es sei denn, er war auf der Flucht vor den Zuständen in seiner Heimat oder stellte sich naiverweise vor, ihn erwarte ein Leben voller Abenteuer und einfacher Beute.
Doch die Banden, die die Zwangsrekrutierung durchführten, bekamen durchaus auch solidere Männer in die Finger, mit dem Ergebnis, dass in den deutschen Armeen (genau wie in denen Ludwigs XIV.) immer mehr Soldaten desertierten. Bereits im Dreißigjährigen Krieg gab es massive Wellen der Fahnenflucht, und hier waren die Gründe vielfältig – Furcht, Hunger und mangelhafter Sold gehörten ebenso dazu wie religiöse Überzeugungen. Nach 1650 indes war die Fahnenflucht (und die Zahl der Deserteure stieg das ganze 18. Jahrhundert hindurch an) die natürliche Folge der Zwangsrekrutierungen und der tendenziös-selektiven Wehrpflicht. Um potenziellen Fahnenflüchtigen die Flucht zu erschweren, gingen einige preußische Offiziere bald sogar dazu über, ihre Soldaten nicht mehr des Nachts marschieren zu lassen. Sie vermieden es, Feldlager in der Nähe von Wäldern aufzuschlagen, und wenn der Weg ausnahmsweise durch einen Wald führte, wurden die Reihen der Marschierenden von Husarenreitern in Schach gehalten. In diesem repressiven Klima waren dafür die Zivilisten nun eher bereit, entlaufenen Soldaten zu helfen – trotz der Androhung schwerer Strafen, trotz der Tiraden gegen die Fahnenflucht in den Sonntagspredigten und trotz der Veröffentlichung langer Listen von Deserteuren in den Zeitungen.
Das ständige Heer von Wehrpflichtigen war da, und die Rekrutierung erhielt eine neue Richtung – vor allem durch erzwungene Eingliederung (Un-)Freiwilliger ins Heer, unter der Ägide des Staates. Der prominenteste Vertreter dieser Richtung war der schwedische König Gustav Adolf, der solche Zwangsmaßnahmen ab 1620 einführte.