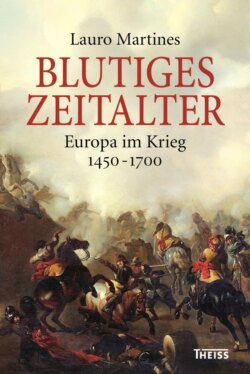Читать книгу Blutiges Zeitalter - Lauro Martines - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Offiziere und Unternehmer
ОглавлениеJan Werth (1591–1652) war einer der führenden Generäle des Dreißigjährigen Kriegs. Geboren als Bauer in der Gegend von Köln, schloss er sich um das Jahr 1610 herum der spanischen Armee an. Er wurde zu einem furchtlosen Reiter und entwickelte sich – entgegen allen sozialen Schranken – zu einer Schlüsselfigur der bayerischen und der kaiserlichen Kavallerie. In den Verwicklungen des Dreißigjährigen Kriegs gelang es mehreren solcher „Nobodys“, General zu werden, beispielsweise Johann von Aldringen (1588–1634), Peter Melander (1589–1648) und Guillaume Gil de Haas (1597–1657): Aldringen war der Sohn eines Stadtschreibers aus Luxemburg. Melander stammte aus einer calvinistischen Bauernfamilie in den Niederlanden, und ihm gelang es, an der Universität zu studieren, bevor er zu einem der wichtigsten Generäle des Kaiserreichs avancierte. Und Gil de Haas, ursprünglich Steinmetz aus Ypern, beschloss sein Leben, wie Aldringen, als General der bayerischen Armee.
Aber an der Tagesordnung war das beileibe nicht. Mit wenigen Ausnahmen in Italien (prominenten condottieri aus der Unterschicht wie Niccolò Piccinino und Erasmo „Gattamelata“ da Narni) kam so etwas zuvor und auch später kaum jemals vor, zumindest bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Die Offiziere stammten in überwältigender Mehrzahl aus dem Adel, vor allem in den oberen Dienstgraden. Doch auch innerhalb des europäischen Adels gab es große Unterschiede: Auf der einen Seite standen diejenigen, die über ausgedehnte Landstriche, über ganze Städte und viele Menschen verfügten; das andere Extrem waren preußische Junker mit einem kleinen Häuschen auf einem kleinen Bauernhof oder spanische hidalgos, die Mühe hatten, das Geld für ein neues Paar Schuhe zusammenzukratzen. Dennoch besaßen sie alle ein Familienwappen (oder strebten zumindest eines an) und klammerten sich an ihre Privilegien, die sie von den Heerscharen der Bürgerlichen absetzten, vor allem im Hinblick auf Besteuerung und Militärdienst. Die Steuergesetze wirkten sich zumeist zu ihren Gunsten aus, und in vielen Teilen Europas zahlten Adlige von einer (indirekten) Umsatzsteuer abgesehen überhaupt keine Steuern.
Daraus folgt jedoch nicht automatisch, dass es ausschließlich verarmte Edelleute waren, die in der militärischen Laufbahn ein gesichertes Einkommen suchten. Auch viele Söhne wohlhabender Adliger waren darunter.
Einer von ihnen war Caspar von Widmarckter (1566–1621) aus Leipzig. Väterlicherseits stammte er aus einer langen Reihe von Offizieren. Was für einen Offiziersanwärter durchaus ungewöhnlich war: 1580 bis 1586 studierte er in Paris Philosophie und Jura. Dann trat er in Frankreich in die Dienste eines deutschen Generals ein, der für die Hugenotten kämpfte, und Ende der 1580er-Jahre wurde er Soldat und Diplomat König Heinrichs IV. Caspar von Widmarckter hatte großen Anteil an der Rekrutierung deutscher Söldner für die Hugenotten. Im Zuge dessen verlieh ihm König Heinrich den Status eines französischen Edelmannes, später war er als Botschafter für König Jakob I. von England und König Ludwig XIII. tätig. Im Juli 1597 stellte ihn Moritz, der Landgraf von Hessen-Kassel, als Diplomaten und Soldaten an; bis 1609 war er ein führendes Mitglied von Moritz’ Geheimem Rat.
1598 heiratete Caspar von Widmarckter eine junge Witwe, häufte ein großes Vermögen an (ein Großteil davon aus Kriegsgeschäften) und baute sich ein großes Haus im thüringischen Vacha. 1614 wollte er den Dienst des Landgrafen verlassen und in den Ruhestand gehen, aber man überredete ihn, beim Militär zu bleiben, indem man ihm weitere Beförderungen versprach. Drei Jahre später führte der bemerkenswerteste Feldzug seines Lebens – er hinterließ Notizen darüber – ihn und sein Regiment nach Frankreich, Savoyen, Piemont und in die Nähe von Mailand. Frankreich und Spanien stritten um Teile Norditaliens, und Moritz kämpfte auf Seiten der Franzosen. Caspar von Widmarckter war jemand, der sich nicht alles bieten ließ, auch nicht vom Landgrafen, und so gab es durchaus Spannungen zwischen den beiden. Sein Tagebuch des Feldzugs zeichnet das Bild eines Offiziers, der nicht davor zurückschreckte, schwere Strafen zu verhängen, so ließ er einen meuternden Soldaten öffentlich erwürgen, um den anderen eine Lektion zu erteilen. Während des Feldzugs, der von Ende März bis November 1617 dauerte, traf der Sold für das Regiments oft zu spät ein, und die Truppen mussten manchmal hungern; zum Teil sahen sie drei Tage lang nicht einmal ein Stück Brot. Die Männer wurden immer unzufriedener, und es kam zum offenen Aufruhr. Gleich hunderte Soldaten erkrankten schwer, so dass Widmarckter und sein Regimentskommandant, Caspar von Schomberg, während des Marschs nach Italien 500 kranke Soldaten zurücklassen mussten. Ein Großteil (wenn nicht die überwiegende Mehrheit) von ihnen starb, und einige wurden von Dorfbewohnern getötet, die versprochen hatten, sie zu pflegen. Nach ein paar blutigen Gefechten mit spanischen Truppen ließen sie auch zahlreiche Schwerverletzte zurück.
Es war ein schwieriger Feldzug, und im nächsten Jahr versuchte der schwer angeschlagene Caspar erneut, sich aufs Altenteil zurückzuziehen. Aber der Landgraf bestand wieder darauf, dass er seinen Dienst fortsetzte, und 1619/20 ließ er Widmarckter hessische Truppen mustern. Im Zuge dessen hatte dieser seinen ersten heftigen Rheumaanfall, der im September 1621 zu seinem Tod führte. Immerhin hatte Caspar von Widmarckter noch Glück, in seinem eigenen Bett sterben zu dürfen – in einer Zeit, in der so viele Oberste und Oberstleutnants im Kampf umkamen.
Wenden wir uns zu einer anderen großen Persönlichkeit zu, Bernhard von Sachsen-Weimar (1604–1639), dem jüngsten von elf Brüdern, allesamt Herzöge von Weimar und ziemliche Draufgänger. Er wuchs in einem militärischen Umfeld auf und entwickelte sich schon bald zu einem hervorragenden Kommandanten, der unter seinen loyalen Männern einen guten Ruf genoss. Daher war er in der Lage, Soldaten in großer Zahl zu rekrutieren. Da er selbst kein Land besaß, fiel es ihm leicht, in die Rolle des militärischen Unternehmers zu schlüpfen, der sich in Kriegszeiten mit seinen Truppen (und sich selbst als General) in den Dienst anderer Herrscher stellte. Sein Ziel war es vor allem, Geld zu verdienen, um damit immer größere Truppen um sich zu scharen und am Ende ein eigenes großes Fürstentum erwerben zu können – seinen eigenen Staat.
Ende Oktober 1635 unterzeichnete er einen Vertrag mit dem französischen König Ludwig XIII., der gerade in den Dreißigjährigen Krieg eingetreten war, um gegen die Habsburger aus Österreich und Spanien vorzugehen. Bernhard versprach, binnen knapp drei Monaten „eine Armee von mindestens 6000 Berittenen und 12.000 deutschen Fußsoldaten“ auszuheben; im Gegenzug sollte er eine Summe von vier Millionen Livres pro Jahr erhalten, zahlbar vierteljährlich. Er musste eine ganze Reihe erfahrener Offiziere stellen und einen „aus mindestens 600 Pferden bestehenden“ Feldartilleriezug. Das Geld, das er erhielt, war für Gehälter, Versorgung, Pferde und Kanonen gedacht. Seine Fußsoldaten sollten mit „guten Musketen und Schulterriemen oder mit Spießen und Harnischen“ ausgestattet werden, die Kavalleristen mussten je zwei Pistolen und einen Lederpanzer tragen. Bernhard wurde nahegelegt, mit dem Geld des Königs so sorgsam umzugehen, als sei es sein eigenes. Da es allzu häufig zu Betrugsfällen kam, weil „der Gier der Offiziere, die versuchen, ihre Kompanien am Tag der Musterung [oder dann, wenn es erforderlich ist] mit passevolants [bestellten Betrügern] aufzufüllen, … muss sich die Armee in Kampfaufstellung präsentieren, wenn sie neu beurteilt werden soll … Für jeden fehlenden Reiter soll der Betrag zugunsten Seiner Majestät um 14 Livres, für jeden fehlenden Infanteristen um 12 Livres gekürzt werden“. Dies ist ein für die Frühe Neuzeit geradezu klassisches Beispiel für eine Vereinbarung zwischen einem mächtigen Herrscher und einem militärischen Unternehmer und damit für ein Wechselspiel zwischen Machtpolitik und wirtschaftlichen Interessen eines Einzelnen. Was die Summe von vier Millionen Livres (umgerechnet etwa 1, 67 Millionen Taler) stillschweigend beinhaltete, war, dass Bernhards Truppen gezwungen wären, ihren Unterhalt durch „Beiträge“ der umliegenden Zivilbevölkerung zu bestreiten. Denn beide wussten, dass diese Summe eigentlich viel zu niedrig war.
In der damaligen Welt setzte man voraus, dass Adlige von ihrem Grundbesitz lebten oder ein Amt oder eine Stellung beim Militär bekleideten und dass es ihnen dabei um die Ehre ging beziehungsweise insgesamt um „höhere“ Dinge – nicht um Handel oder so etwas „Anrüchiges“ wie unternehmerische Gewinne. Und doch galt es durchaus als ehrenhaft, eine Söldnertruppe zu besitzen, sie wie ein Unternehmen zu behandeln und damit Gewinne einzustreichen. So lebte das traditionelle Metier des mittelalterlichen Edelmannes, das des Kriegers, im Europa der Frühen Neuzeit fort – auf eine Art und Weise, die alle unternehmerischen Tricks im militärischen Bereich rechtfertigte.
Wie viel Reichtum oder „Sozialkapital“ (Ehre, Prestige, öffentliches Ansehen) man sich im Krieg verschaffen konnte, zeigt die Tatsache, wie sehr sich alteingesessene Adelsfamilien in Norditalien um 1700 herum bemühten, ihre männlichen Angehörigen als Offiziere im spanischen Heer oder in den Armeen der Republik Venedig unterzubringen. Wenn eine Familie reich genug war, kam es durchaus vor, dass sie große Summen für ganze Kompanien von Söldnern ausgaben, wenn einer ihrer Angehörigen dadurch im Gegenzug einen hohen Offiziersrang erhielt. In Frankreich kämpfte der aufstrebende Amtsadel, die noblesse de robe, mit allen Mitteln um die Posten von Hauptleuten und Obersten, soll heißen: den Ankauf von Kompanien und Regimentern. Und darüber beschwerte sich vor allem die alte noblesse d’épée, der Geburtsrechts- oder „Schwertadel“, der vielfach glaubte, seiner angestammten Pfründen beraubt zu werden.
Selbst in den größten Bankiersfamilien gab es Männer, die sich für den Krieg und die Waffen entschieden. Das beste Beispiel: der Genueser Milliardär Ambrogio Spinola (1569–1630). Während seiner Tätigkeit als Kommandant der Flandernarmee in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts war er ein paar Jahre lang Gläubiger der spanischen Krone für ein Darlehen von fünf Millionen Gulden – das war mehr, als das Königshaus binnen zweier Jahre an seinen westindischen Besitzungen verdiente. Noch mehr als die Männer um Spinola war das berühmte katholische Kaufmannsgeschlecht der Fugger aus Augsburg darauf aus, sich im Krieg und unter Waffen Ruhm und Geld zu verschaffen. Drei der Söhne Hans Jakob Fuggers traten in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts als Obristen in die Flandernarmee ein. Und während des Dreißigjährigen Krieges dienten mindestens sieben Fugger in den Armeen des Kaiserreichs und des Herzogs von Bayern, als Hauptmann, Feldmarschall oder sogar General. Diese jungen Männer verführte der Krieg nicht nur durch das damit verbundene Sozialkapital, sondern auch, weil sie erwarteten, für ihre Verpflichtung (und das investierte Kapital) ansehnliche Renditen einzustreichen – durch Beute, Sold und „Beiträge.“
Ott Heinrich Fugger (1592–1644) wurde von den Jesuiten in den Alten Sprachen ausgebildet und besuchte die Universitäten Ingolstadt, Perugia und Siena. Er begann seine militärische Karriere 1617 als eigenfinanzierter Oberst in der spanischen Armee, und 1618/19 kämpften er und sein Regiment von 3000 Mann in der Lombardei und in Böhmen. Danach diente Ott Heinrich Fugger in Österreich, Ungarn und den Niederlanden, später – für die Katholische Liga und den Herzog von Bayern – wieder in Norditalien, in Franken, Schwaben und anderswo. Zwei der lukrativsten Posten seiner Karriere bekleidete er in Augsburg, 1635 als Militärgouverneur und 1636–1639 als Stadtkommandant. Während er dadurch sein Vermögen mehrte, wuchs auch seine umfangreiche Kunstsammlung weiter an.
Otts Biografin Stephanie Haberer hat herausgefunden, dass er im Laufe der 1620er- und 1630er-Jahre tausende von Gulden verdiente, an Sold, „Beiträgen“ und in anderer Form, die sein Buchhalter nicht verzeichnet hat. Zudem strich er umfangreiche Gewinne aus der kaiserlichen Beschlagnahme von Feindesland ein, das er dann billig an wohlhabende Insider verkaufte. Auf diese Weise erlangte Ott die Herrschaft über das hessische Speckfeld, später auch über andere Gegenden. Seine Einkünfte ermöglichten ihm einen geradezu prunkvollen Lebenswandel.
Alles in allem kann man kaum behaupten, dass er als Bankier besser gelebt hätte als beim Militär. Im Jahr 1620 bestätigte der Kaiser den Adelstitel der Fugger, und 1627 wurde Ott Heinrich Fugger vom spanischen König zum Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies geschlagen.
***
Zu den ersten gut organisierten Söldnertruppen gehörten die Kompanien der professionellen Elite-Soldatenführer in Italien, der Condottieri. Diese Truppen wurden von Angehörigen bekannter Adelsfamilien rekrutiert und befehligt und dann an Fürsten und Stadtstaaten vermietet. Diese Aktivitäten brachten viel Geld ein und ebenso viel Ehre. Und ab 1450 verwendeten diese italienischen ‚Warlords‘ (wie man mit Blick auf heutige Entwicklungen etwa in Afrika sagen könnte) immer mehr und immer modernere Arten von Feuerwaffen.
Aber im Herbst 1494, als König Karl VIII. von Frankreich mit rund 25.000 Mann in Italien einmarschierte, standen die condottieri – Hauptleute von Familien wie den Orsini, Vitelli, Baglioni und Dal Verme – einem Feind gegenüber, dem sie nichts entgegenzusetzen hatten. Allzu groß war die Übermacht der Kanonen des Königs und der Söldner aus der Schweiz, aus Deutschland, Schottland und Frankreich. Wenn es um Kriegführung in größerem Maßstab ging, gaben von nun an knallharte Profis den Ton an: Unternehmer, die ihre Armeen nicht nur zusammenstellten, um an ihnen zu verdienen, um Land oder Fürstentitel zu erwerben – die Armeen mussten auch in der Lage sein, in ferne Länder einzumarschieren. Die französische Invasion war da nur ein Vorgeschmack gewesen. In Friedenszeiten waren ihre Garnisonen für sie vollkommen nutzlos; Geld floss nur im Krieg. Und wenn der Krieg (und mit ihm die Beute und die sogenannten „Beiträge“ der Besiegten) ausblieb, dann wurden solche Armeen oft genug wieder aufgelöst, und ihr Befehlshaber ging zurück nach Schottland, in die Gascogne, nach Kastilien, in die Schweiz, nach Sachsen, Böhmen, auf den Balkan oder in die Bergregionen Italiens.
Europa sah zu, wie ganze Dynastien von Adligen, die früher untätig zuhause gesessen hatten, ins Militär drängten. Zwischen 1500 und um 1680, als eine neue auf Steuereinnahmen basierende Staatsform entstand, lag die Rekrutierung der Soldaten vor allem in den Händen von Unternehmern. Und die erfolgreichsten beteiligten sich selbst aktiv in der Armee. Sie hatten direkten Kontakt zu Obristen und Hauptleuten, Männern, die über ihre eigenen Netzwerke von Freunden und Bekannten in Stadt und Land verfügten. Und sie verwendeten diese Kontakte, um Regimenter von Söldnern auszuheben, wenn sich ein Fürst oder das Patriziat einer Stadt bei ihnen meldete. Auf dem Höhepunkt des Dreißigjährigen Krieges gab es mindestens 1500 solcher Unternehmer, die auf die Bedürfnisse der Fürsten reagierten. Dazu zählten die schottischen Adligen Sir Donald MacKay, Colonel Robert Monro und Alexander Leslie, die Armeen in Schweden und sogar in Russland mit Freiwilligen und Zwangsrekrutierten bestückten.
Einige dieser Unternehmer waren selbst Fürsten, wie der Herzog von Sachsen-Weimar, Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel (1599–1626) und Karl IV. von Lothringen (1604–1674). Sie waren in der Lage, Armeen von bis zu 20.000 Kavalleristen und Infanteristen zu rekrutieren, und handelten dann mit noch mächtigeren Herrschern profitable Mietbedingungen aus. Noch bemerkenswerter ist, wie brillante Generäle wie Pappenheim und Wallenstein ihre Armeen in private Unternehmen verwandelten und dabei sogar in der Lage waren, noch auf dem Vormarsch die Zahl ihrer Soldaten zu verdoppeln. Das lag vor allem daran, dass sie ihre Männer nicht daran hinderten, sich durch Plünderungen und Erpressung zu bereichern. Außerdem war es ihr hervorragender Ruf (Pappenheims sogar auf dem Schlachtfeld), der die Rekruten anzog. Ende der 1630er-Jahre war auch der führende schwedische General, Johan Banér, kurz davor, seine ganz persönliche Armee bewaffneter Desperados zu besitzen.
Am unteren Ende der Skala gab es kleinere Unternehmer, die Einheiten von 200 bis 2000 Mann um sich scharten und befehligten. Im Januar 1525 schlossen Kaiser Karl V. und Giovanni Maria da Varano, Herzog der Stadt Camerino, einen Vertrag, laut dem der Italiener Karl mit „1500 gut ausgestatteten Infanteristen und einem kleineren Kavalleriekontingent“ versorgen sollte. Im Mai 1484 verpflichtete sich ein anderer kleiner Warlord, aus der Familie da Varano, Venedig eine Truppe von 1200 Reitern und 50 berittenen Bogenschützen zu liefern. Der Vertrag galt für zwei Jahre und garantierte eine Summe von 50.000 Golddukaten. Mitunter wurden auch noch kleinere Einheiten vermietet. Im Jahr 1490 kam es zu einem Krieg zwischen der Stadt Metz und Herzog René II. von Lothringen; die Stadt mietete 2300 Söldner an: „Burgunder, Franzosen, Langobarden, Spanier, Basken, Gascogner, Hennegauer und Picards sowie Deutsche, Slawen und Albaner, und jede „Nation‘ hatte ihren eigenen Hauptmann“. In anderen Worten: Dieses Sammelsurium war das Produkt von zehn oder zwölf unternehmungslustigen Hauptleuten, die hier wahrscheinlich unter dem Kommando beziehungsweise im Auftrag eines höherrangigen Offiziers als Subunternehmer tätig waren.
Aber all das setzte voraus, dass es genügend Freiwillige gab, um die Nachfrage zu befriedigen; ansonsten kam die hässliche Praxis der selektiven Zwangsrekrutierung ins Spiel. Das 17. Jahrhundert war dermaßen von Kriegen und Epidemien gekennzeichnet, dass der Bevölkerungsschwund die Rekrutierer vor gravierende Probleme stellte. Und diese machten vor keinem Unternehmer halt. Hier ein besonders anschauliches Beispiel:
Anfang 1644 beschloss Frankreichs regierender Minister, Kardinal Mazarin, Soldaten für Amalie Elisabeth, die Landgräfin von Hessen-Kassel, auszuheben, die sich von kaiserlichen Truppen bedroht sah. Er beauftragte den Grafen von Marsin, einen Oberst, im neutralen Bistum Lüttich und in anderen Teilen des Westfälischen Reichskreises 4000 Söldner zu rekrutieren (je zur Hälfte Kavallerie und Infanterie). Doch sofort gab es Ärger für Marsins Hauptleute: Sie mussten feststellen, dass genau zur selben Zeit bereits ein spanischer General und ein französischer Feldmarschall in der Region Soldaten rekrutierten. Das Resultat: Die Bonuszahlungen schnellten in die Höhe, potenziellen Kandidaten wurden Bestechungsgelder gezahlt, und Marsin konnte seine Mission nicht erfüllen. Der Franzose musste auf die Zwangsrekrutierung zurückgreifen.
Die Schlüsselfiguren im Rekrutierungsgeschäft waren die Hauptleute. Sie sollten sich um die Soldaten kümmern, Soldzahlungen abwickeln, für Nachschub sorgen, und in Kriegszeiten waren sie dazu da, über Leben und Tod ihrer Untergebenen zu befinden. Idealerweise befehligte ein Hauptmann eine Kompanie mit einer Stärke von bis zu 100 bis 300 Infanteristen oder etwa 100 Kavalleristen. Aber wenn Krieg und Krankheiten ihren Tribut zollten, sanken die Zahlen, und im 17. Jahrhundert bestanden viele Infanterie-Kompanien auf einem Feldzug aus kaum mehr als sechzig bis achtzig Mann. Ein Leutnant und ein Fähnrich unterstanden dem Hauptmann, und auch diese waren in der Regel adlig, selbst wenn es hier und da einen Bürgerlichen in diesen Rängen gab.
Armeen bestanden aus Regimentern und diese wiederum aus Kompanien. Ab etwa der Mitte des 16. Jahrhunderts unterstand ein Infanterie-Regiment in der Regel dem Kommando eines Obersten. Ein Regiment zählte bei voller Stärke in der Regel 800 bis 3000 Mann; aber es waren die Kompanien, in denen die Offiziere, vor allem die Hauptleute, ihre Männer wirklich kannten. Daher waren sie bei der Rekrutierung in Dörfern und Stadtvierteln die zentralen Figuren. Zusammen mit ihren Leutnants hatten sie den direkten Kontakt mit den Kandidaten und brachten die Vereinbarungen unter Dach und Fach.
Am wichtigsten für die Fürsten und anderen großen Kriegsherren indes waren die Obersten. Sie waren die eigentlichen Unternehmer, die oft das Verfügungsrecht über ein oder zwei Regimenter hatten – oder denen diese Regimenter rundheraus gehörten.
In den 1590er-Jahren gab die finanziell angeschlagene spanische Krone mehr und mehr Autorität in die Hände lokaler Eliten und Hauptleute, während sie verzweifelt neue Soldaten benötigte. Hier geschah der Übergang „vom Offizier als Funktionär, der durch die Krone ernannt wurde, hin zum Offizier, der als Unternehmer von der Krone anerkannt wurde“. In den Niederlanden lag die Rekrutierung neuer Soldaten komplett in Händen solcher Unternehmer. Auch wenn sich die Umstände änderten, setzte sich die spanische Armee zu achtzig bis neunzig Prozent aus Söldnern aus Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, der Schweiz, Österreich und den südlichen Niederlanden zusammen. Bereits in Kompanien und Regimenter organisiert, wurden sie aus dem Ausland von findigen Offizieren herangekarrt, denen es vor allem um das Geschäft und ihren Gewinn ging.