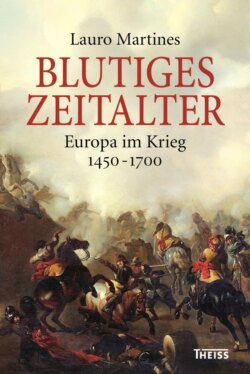Читать книгу Blutiges Zeitalter - Lauro Martines - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Sold und Profit
ОглавлениеWas die Lebensmittelrationen beim Militär betraf, gab es genaue Vorschriften. Doch trotz dieser Vorschriften mussten die Soldaten durchaus manchmal hungern (von dem, was man ihnen versprochen hatte, ganz abgesehen). Überall in Europa war vorgeschrieben, dass Soldaten täglich eineinhalb bis zwei Pfund Brot erhielten (in Osteuropa Hafergrütze), 8 Unzen bis zu einem Pfund Fleisch, Fisch oder auch Käse, dazu bestimmte Mengen Bier oder Wein sowie Salz, Essig und Öl. Die Regierungen wussten genau, was die Mägen ihrer aktiven Truppen brauchten. In Russland und weniger dicht besiedelten Teilen Osteuropas führten die Armeen oft genügend Nahrungsmittel in ihren Wagen mit, um in Kriegszeiten die grundlegenden Bedürfnisse der Truppen abzudecken. Im Westen war das ganz anders: Hier unternahm man in Kriegsgebieten zwar auch einige Anstrengungen, um Nahrung mitzuschleppen oder wenigstens Getreide und Öfen, um Brot zu backen – dennoch setzte man ganz selbstverständlich voraus, dass Soldaten auf einem Feldzug der Lage waren, sich unterwegs zu verköstigen. Wenn die Armee die Nahrung nicht komplett oder zum Teil selbst übernahm, sollte der Sold die Kosten für die täglichen Lebensmittelrationen abdecken. Soweit die Theorie – doch wie war es wirklich?
Über den Sold der Soldaten wissen wir ziemlich gut Bescheid. Im 16. Jahrhundert verdiente beispielsweise ein deutscher Landsknecht einen Grundbetrag von 4 Gulden pro Monat. Ein spanischer Frontsoldat erhielt in den 1590er-Jahren einen Sold von 45 Maravedís pro Tag. Im Jahr 1699 bekamen die russischen Soldaten unter Peter dem Großen 5–11 Rubel im Jahr. Um 1700 herum verdiente ein Musketier in Frankreich in Friedenszeiten 5 Sous pro Tag. Und in Venedig bezahlte man Fußsoldaten im 16. Jahrhundert nominell etwa 3 Dukaten pro Monat, doch in Wahrheit war es weit weniger, denn die Summe wurde nicht in Golddukaten ausgezahlt, sondern in geringerwertigen Münzen.
Doch all diese Zahlen sind an sich ohne Bedeutung, bis wir den Soldaten in das direkte soziale Umfeld seiner Zeit einordnen: landlose Bauern, niedere Handwerker, Lohnarbeiter. Erst dann ergibt sich aus dem Sold ein bestimmter Lebensstandard, und wenn man auf diese Weise den Soldaten mit einem niedrig gestellten Zivilisten vergleicht, dann – so sind die Historiker überzeugt – stand der Zivilist in der Regel besser da. Hungersnöte, wie in Frankreich in den Jahren 1694 und 1709 oder in Teilen von Deutschland während des Dreißigjährigen Kriegs, trieben Bauern und Handwerker in den Militärdienst. In Zeiten äußerster Knappheit waren gut 40 Prozent der Bevölkerung auf Almosen angewiesen und mussten am Straßenrand betteln. In Frankreich gaben die armen Leute die Hälfte ihres Geldes für Brot aus. Geoffrey Parker hat festgestellt, dass wahrscheinlich auch in den Niederlanden „die Hälfte der Einkommen der ärmeren Durchschnittsfamilie für Brot“ ausgegeben wurde, das „Hauptnahrungsmittel [war] eine Schüssel gesalzener Suppe mit Roggenschwarzbrot“. Insgesamt gaben die Menschen 75 Prozent ihres jährlichen Einkommens für Lebensmittel aus. Diese Statistiken können einem ein gutes Gefühl dafür vermitteln, wie der Überlebenskampf in den sozialen Milieus aussah, aus denen die meisten Soldaten kamen. Kein Wunder, dass das Essen für sie eine so große Rolle spielte. Warum sonst sollte man sich freiwillig fürs Militär melden?
Die Lösung lag auf der Hand: Sie hieß Nahrung statt Sold; so machte es die schwedische Armee in Deutschland während des Dreißigjährigen Kriegs. Gustav Adolf hatte das im Jahr 1632 ganz offen so festgelegt – es erschien ihm als bester Ausweg aus seinen finanziellen Problemen.
Aber es gab aber auch eine andere Möglichkeit, die noch ein wenig perfider war. Ihr Urheber war der schwedische Reichskanzler Axel Oxenstierna im Jahr 1633. Er schätzte, wenn die Armee auf monatlicher Basis 78.000 Soldaten bezahlte, dass sich dies zu einer jährlichen Summe von etwa 9, 8 Millionen Reichstalern summieren würde. Wenn man die Männer aber bloß für einen Monat bezahlte, man den Rest einbehielte und jedem Soldaten ein Pfund Brot pro Tag gab, plus gelegentliche kleinere Geldbeträge, dass der Staat dann in der Lage wäre, die jährlichen Zahlungen auf 5, 4 Millionen Reichstaler zu kürzen. Und genau das tat er. Innerhalb von zwei Jahren war es bereits einmal zu einem Aufstand unter den Soldaten gekommen, und nun, 1635, sah sich Oxenstierna wieder mit einer Massenmeuterei konfrontiert, so dass er schließlich doch mit den Offizieren verhandeln musste.
Ende des 16. und während des 17. Jahrhunderts standen die Söldnerheere der Niederlande im Ruf, die bestbezahlten Europas zu sein. Und dennoch war „die Bezahlung die Hälfte des Verdiensts eines Tagelöhners“, und die Niederländer hatten kein Problem damit, gerade erst rekrutierte Söldnerkompanien kurzerhand aus dem Dienst zu entlassen, ohne sie zu bezahlen, wenn sie feststellten, dass sie nicht mehr gebraucht würden; ein solcher Fall ereignete sich im Jahr 1658. Die herrschenden Eliten der Vereinigten Niederlande verfuhren mit ihren Armeen alles andere als großzügig; überhaupt kein europäischer Staat tat das, denn in Kriegszeiten Soldaten zu bezahlen war der mit Abstand teuerste Posten in einem Staatshaushalt. Daher gab es stets Unruhe unter den schottischen, englischen und deutschen Söldnern der Niederländer, die oft mit ihren Soldzahlungen in Verzug waren. Dennoch waren die Niederländer dank der boomenden Wirtschaft des 17. Jahrhunderts in der Lage, immer noch regelmäßiger zu zahlen als die Fürstenhäuser, und so hatten sie auch nie Probleme damit, genügend Söldner zu rekrutieren. Sogar Handwerksgesellen, die auf der Walz trotz des Booms oft am Rande der Arbeitslosigkeit lebten, schlossen sich hier und da einem Regiment an, aus dem einfachen Grund, dass es „ein kontinuierliches Einkommen in Aussicht“ stellte. Aber genauso wie wirtschaftlich schwierige Zeiten die Armeen füllten, konnte ökonomische Entspannung zu Massendesertionen führen. Zur Armee ging man, wenn es gar nichts anders ging.
Militärhistoriker weisen darauf hin, dass die Soldaten einer Garnison weiterhin ihr angestammtes Handwerk ausüben durften, wenn sich ihnen die Gelegenheit dazu bot; so konnten sie sich ein wenig zusätzliches Einkommen verschaffen. Dies war aber nur in Friedenszeiten möglich, und dann musste der arbeitende Soldat dieses Extraeinkommen, das er in die Garnison mitbrachte, unter Umständen noch mit seinem Kommandanten teilen. In Kriegszeiten beziehungsweise auf einem Feldzug indes gab es kaum Möglichkeiten, zu arbeiten.
Der Frieden von Cateau-Cambrésis (1559), mit dem die Italienkriege endeten, entließ tausende französische Soldaten, auch Offiziere, wieder in das zivile Leben, und viele kämpften schon bald in den Hugenottenkriegen (1562–1598). Dieser Konflikt, der der „höheren Sache“ diente, ließ das Bestreben, Soldaten einen existenzsichernden Sold zu zahlen, schnell wieder verkümmern. Innerhalb weniger Wochen nach dem Beginn eines Feldzugs mussten katholische wie protestantische Fürsten feststellen, dass sie die fälligen Beträge gar nicht zahlen konnten. Ihre Armeen mussten hungern oder plünderten auf Nahrungssuche die Gegend. Die praktischste Lösung – zu der es immer wieder kam, vor allem auf Seiten der Regierung – war, einen Waffenstillstand auszurufen und die Armeen kurzerhand aufzulösen. Die Krone und die hugenottische Opposition suchten dann zunächst nach neuen Mitteln und Wegen, ihre Finanzen aufzubessern, bevor die nächste Runde des Krieges eingeläutet werden konnte.
Dieses Vorgehen führte oft zu besonders unschönen Resultaten. Trotz der flehentlichen Bitten der Königinmutter, Katharina de Medici, plünderte eine unbezahlte königliche Armee im Oktober 1562 drei Tage lang Rouen, die zweitgrößte Stadt Frankreichs. Einige Hauptleute stahlen sich mit Silber davon, mit dem sie ihre Soldaten ausbezahlen wollten.
Gehen wir zurück zum Ende des 15. Jahrhunderts, in das Italien der Renaissance und die Welt der Sforza-Herzöge von Mailand: Hier finden wir eine der am besten organisierten Söldnerarmeen der Halbinsel. Und doch wurden die Sforza-Soldaten so schlecht bezahlt, dass sie ihre Einnahmen mit Plünderung und Schmuggelware aufstocken mussten (zumal der offizielle Sold oft zum Teil in Stoffballen bestand). Die Herzöge beschwerten sich darüber, aber es lag durchaus in ihrem finanziellen Interesse, nicht so genau hinzuschauen.
Im frühen 16. Jahrhundert schienen die deutschen Landsknechte, zumindest auf dem Papier, ein komfortableres Leben zu führen als viele fahrende Gesellen. Daher meldeten sich stets mehr als genug freiwillige Rekruten. Doch musste man für seine Erstausstattung als Landsknecht selbst aufkommen, und so waren neue Rekruten sofort verschuldet. Die Kosten betrugen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts beispielsweise einen Gulden für eine lange Pike, drei Gulden für einen Helm, dreieinhalb Gulden für eine Arkebuse und ganze zwölf Gulden für eine einfache Rüstung. Nahrung, Kleidung und Schuhe mussten sie selbst bezahlen und bekamen dafür immerhin einen monatlichen Sold von vier Gulden, doch die galoppierende Inflation des 16. Jahrhunderts machte ihnen bald einen Strich durch die Rechnung. Schließlich wurden junge Leute in Deutschland allein durch das Versprechen von Kriegsbeute in die Kompanien der Landsknechte gelockt. Sie wollten allein von dieser Beute leben.
Mit dem leuchtend weißen Pferd, der kreisförmigen Brücke und den Rauchwolken tritt Philips Wouwerman in seinem Kriegsgemälde ein wenig aus dem tatsächlichen Schlachtengetümmel heraus. Kopie nach Philips Wouwerman (1619–1668): Reiterschlacht auf einer Brücke, 1665–1668 (© Veneranda Biblioteca Ambrosiana/De Agostini/Getty Images)
Louis XIV., der König von Frankreich, bekannt als der „Sonnenkönig“, blickt auf seine Soldaten hinab, die wie ein Heer von Ameisen aussehen, während sie am 12. Juni 1672 den Rhein überqueren. Stich (© Getty/Leemage)
Trotz der wie eingefroren wirkenden Gestalten gelingt es dieser Szene, die Gewalt der Bartholomäusnacht (23./24. August 1572) zu vermitteln. Im Zeitalter der Reformation verstärkte die religiöse Komponente die Intensität der Konflikte in Europa. François Dubois (1529–1584): Bartholomäusnacht (De Agostini/Getty Images)
Bei Dürers reitendem Tod von 1505 verhungert sogar das Pferd. Trotz des Gemetzels in den Schlachten starben zu jener Zeit die meisten Menschen an Hunger und Krankheiten. Albrecht Dürer (1471–1528): Reitender Tod, 1505 (Privatsammlung/Bridgeman Art Library)
Die Hinrichtung von zwanzig führenden Adligen einschließlich der Grafen von Egmont und Horn durch den Herzog von Alba in Brüssel, 1568. Achten Sie auf die Musketen auf der linken Seite und die Länge der Piken der im Halbkreis stehenden Soldaten. Schule von Zacharias Dolendo (1561– ca. 1604) (Privatsammlung/Stapleton Sammlung/Bridgeman Art Library)
Der Widerstand des eingekesselten Naarden endete, als die Stadt gestürmt und auf barbarische Weise geplündert wurde. Die Gewalt in den Kriegen in Europa war oftmals besonders schlimm, wenn lange Zeit belagerte Städte schließlich doch noch eingenommen wurden. Franz Hogenberg (1540– ca.1590): Das Massaker in Flandern unter der Regierung von Fernando Alvarez de Toledo, dem Herzog von Alba, am 30. November 1572 (Bibliothèque Nationale, Paris/Giraudon/Bridgeman Art Library)
Es brennt und raucht bereits in Magdeburg, als kaiserliche Soldaten im Mai 1631 eine Bresche in die Stadtmauer schlagen. Deutsche Schule (18. Jahrhundert): Die Eroberung Magdeburgs durch die kaiserliche Armee (November 1630 bis 20. Mai 1631). Zwischen 1726 bis 1727 (Deutsches Historisches Museum, Berlin/© DHM/Bridgeman Art Library)
Überfalle auf Dörfer, Bauernhöfe und Landbevölkerung mit Mord und Raub waren ein universeller Aspekt des Krieges in Europa. Französische Schule (17. Jahrhundert): Plünderung eines Bauernhofs (Musée Bargoin, Clermont-Ferrand, France/Giraudon/Bridgeman Art Library)
Doch dass die Staaten nicht in der Lage waren, kontinuierlich den Sold ihrer Armeen zu bezahlen, war nur eines der Probleme. Wie wir bereits gesehen haben, organisierten Militärunternehmer ihre Regimenter so, dass sie in Kriegszeiten so viel Gewinn wie möglich erwirtschafteten. Im Folgenden soll es um die einzelnen Kompanien gehen und um die Hauptleute, die diese Kompanien als ihr Eigentum betrachteten.
Die notorisch schlechte finanzielle Lage der Regierungen führte dazu, dass Herrscher oft annahmen – oder glauben wollten –, dass ihre Hauptleute genug Kapital zur Hand hatten, um Rekrutierungszahlungen zu leisten, um den Soldaten das Geld für ihre Ausrüstung zu leihen (oftmals sogar für Schuhe) und für Nahrung und Futtermittel zu bezahlen, wenn die Regierungsgelder ausblieben. Von Regimentschefs (Obristen), die mitunter mehrere Kompanien besaßen, erwartete man dies ebenfalls, denn bei diesen handelte es sich ja immerhin oft um Adlige mit Landbesitz.
Doch wenn sie die Bedürfnisse ihrer Männer aus eigener Tasche bezahlten, verwandelten sich die Hauptleute und Obristen schnell in Geldverleiher, die Zinsen für ihre Kredite verlangten. Und auch ihr Primärgeschäft sollte Gewinne abwerfen: ihre Kompanien und Regimenter.
In diesem finanziellen Verwirrspiel versuchten unsere Militärunternehmer (die stets Angst haben mussten, dass die Regierungen nicht pünktlich zahlten) alle Möglichkeiten, ihren Profit zu maximieren – vor allem Offiziere, die nach Höherem strebten, nach mehr Dienstboten, besserer Kleidung, einer vornehmeren Bleibe oder Überschüssen für die Bedürfnisse ihrer Familien und ihrer Ländereien zu Hause. Einige von ihnen hatten durch ihre Auslagen Schulden angehäuft, so für Kleidung, Nahrung und Pferde oder sogar, um eine ganze Kompanie Soldaten zu kaufen. Bei jeder Münze, die durch ihre Hände ging, stellte sich die Frage: Durften sie sie behalten?
Der gleiche Gedankengang betraf alle Zahlungen für Sold, Nahrung, Waffen, Lasttiere und andere Bedürfnisse der Armeen. Hier setzten manche Hauptleute mit einem echten Taschenspielertrick an: Die Quellen sind voll von Berichten über hungernde Soldaten, die neben Offizieren marschieren, die gut genährt sind und wie aus dem Ei gepellt aussehen. Als die Hugenottenkriege auf ihrem Höhepunkt waren, gab es viele Offiziere, die sich mit dem Sold ihrer Soldaten aus dem Staub machten. Wer für Gott kämpfte, war nicht unbedingt ein ehrlicher Mann. Kein Wunder, dass massenhaft Rekruten desertierten, wie es in Spanien geschah, als eine Gruppe Soldaten entdeckte, wie sich ihr Hauptmann auf ihre Kosten bereicherte.
Wenn es um die Musterung ihrer Truppen durch Regierungsbeamte ging, wurden betrügerische Offiziere besonders erfindungsreich: Schließlich war im Rahmen einer Musterung dem Kompaniechef eine bestimmte Summe auszuzahlen – der Sold der Soldaten nämlich –, und diese setzte der amtliche Kontrolleur auf Basis der Zahl der Fußsoldaten und Reiter fest, der bei dieser Musterung zugegen waren. Fast überall, so scheint es, wurden die zu musternden Reihen durch Betrüger, sogenannte passevolants, aufgestockt – sozusagen Statisten, die einfach dazugestellt wurden und dafür einen kleinen Teil des Solds erhielten. In Deutschland kursierte in diesem Zusammenhang das Sprichwort: „Nicht jeder, der eine Lanze trägt, ist ein Lanzenträger.“ Die Herrscher wussten genau, wie weit verbreitet dieser Trick war, doch Einhalt gebieten konnten sie ihm nicht; die kommandierenden Offiziere lebten weiter auf ihre Kosten. Darüber hinaus führten die Offiziere wann immer möglich, zum Beispiel auf einem Feldzug oder nach einer Schlacht, auch Tote und Deserteure in ihren Heereslisten auf. Und wenn ihre Kompanien ihnen selbst gehörten, wurde aus der Versuchung eines solchen Betrugs geradezu eine Notwendigkeit.
Daneben blühten noch viele andere Betrügereien, wie eine der detaillierteste Untersuchungen soldatischer Korruption im Europa der Frühen Neuzeit erahnen lässt, eine Studie der Mailänder Garnison in den frühen 1580er-Jahren.
Mailand war das Hauptquartier der Truppen des spanischen Italien, obwohl die Garnison seiner großen Festung, des Castello Sforzesco, kaum mehr als 1000 Mann umfasste, von denen lediglich 600 Soldaten waren. In der dortigen Gemeinschaft waren Günstlingswirtschaft und Bestechung an der Tagesordnung. Der Wachdienst galt als ehrenvolle Aufgabe, war aber nicht wirklich beliebt. Die Lebensmittel im Kastell waren teurer als in der Stadt und nicht annähernd so gut, auch wenn sie von Verbrauchssteuern befreit waren. Aber da sie so gut wie nie pünktlich ihren Sold erhielten, mussten die meisten Soldaten ihre Nahrung auf Kredit kaufen – und das ging nur im Kastell. So waren sie ständig verschuldet. Ein Teil des Solds wurde regelmäßig für ein Krankenhaus in der Stadt einbehalten, und den Großteil des Geldes strich der Kastellan ein. Wer neu in der Festung eintraf und eine eigene Waffe mitbrachte, war dennoch gezwungen, eine überteuerte zweite Waffe zu kaufen, oftmals eine, die man ein wenig aufpoliert hatte, damit sie neuer aussah, als sie war. Die Soldaten mussten sogar jeden Monat eine bestimmte Menge Schießpulver kaufen, für Salutschüsse bei der Ankunft Prominenter im Kastell. Natürlich wurde auch das Schießpulver mit Gewinn verkauft.
Hinter diesen betrügerischen Machenschaften steckten der Kastellan, Don Sancho de Guevara Padilla, und Leutnant Bartolomé Palomeque. Der Leutnant zwang sogar den Gastwirt des Kastells, 200 Scudi Gold von ihm zu leihen, zu 30 Prozent monatlichen Zinsen. Was die Gerechtigkeit betrifft, so ergab die 1586 abgeschlossene Untersuchung, dass den Kastellan in puncto Korruption keine Schuld traf, und der Leutnant starb, bevor man ihm Sanktionen auferlegen konnte – so viel Zeit verging, bevor das juristische Verfahren abgeschlossen war. Zwar kann man nicht behaupten, dass die Bedingungen, die in der Mailänder Garnison herrschten, typisch waren. Aber im Zuge der galoppierenden Inflation des 16. Jahrhunderts und der stark schwankenden Brotpreise offenbaren die Vorgänge im Castello Sforzesco, welcher rücksichtslose Zynismus herrschte und wie man aus dem überall herrschenden Mangel Profit schlug. Dabei lag Mailand selbst nicht einmal direkt in einem Kriegsgebiet. Doch die Offiziere versuchten eben überall, Möglichkeiten aufzutun, sich mit illegalen Mitteln zu bereichern, und die herrschenden Eliten, die von den privilegierten Kasten manipuliert wurden, waren nicht in der Lage, der Versuchung einen Riegel vorzuschieben.
Und doch muss man den Offizieren auch etwas zugutehalten: Vor allem in Kriegszeiten, wenn die staatlichen Mittel schnell erschöpft waren, kam es durchaus vor, dass auch Offiziere auf einem Feldzug hungern mussten und mitunter sogar komplett verarmten, wenn der Staat seine Verträge mit ihnen nicht einhielt. Vor allem im Frankreich des 17. Jahrhunderts gab es Fälle von Hauptleuten und Obersten, die in ihre Einheiten so viel investiert hatten, dass es sie schließlich in den Ruin trieb und zum Betrug geradezu anstiftete, wenn sie sich sanieren wollten. Das Krebsgeschwür der Korruption hatte also zu einem großen Teil mit dem Versagen des Staates zu tun. Ende des 17. Jahrhunderts verschwand der militärische Unternehmer wieder von der Bildfläche. Dennoch versuchte man auch noch im 18. Jahrhundert, aus der Finanzierung von Regimentern und Kompanien private Gewinne zu ziehen.
Preußische Adlige machten als Offiziere Karriere und wurden mit dem begehrten Einkommen reich. Adlige in Frankreich kauften und verkauften Kompanien, um Gewinne zu erzielen. Und spanische Obristen in den Niederlanden besetzten die angenehmeren Positionen in ihren Regimentern mit Kunden, Mandanten, Verwandten, Freunden und Dienstboten aus ihrer Heimat.