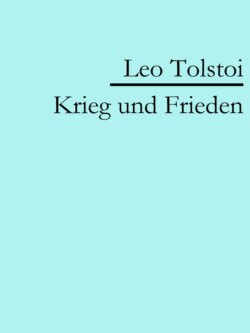Читать книгу Krieg und Frieden - Leo Tolstoi - Страница 27
XXV
ОглавлениеIn Lysyje-Gory, dem Gut des Fürsten Nikolai Andrejewitsch Bolkonski, wurde täglich die Ankunft des jungen Fürsten Andrei und seiner Gemahlin erwartet; aber durch diese Erwartung wurde die regelmäßige Ordnung, nach der sich das Leben im Haus des alten Fürsten abspielte, nicht gestört. Der General en chef Fürst Nikolai Andrejewitsch, der in den höheren Gesellschaftskreisen den Spitznamen »der König von Preußen« führte, wohnte, seitdem er unter der Regierung des Kaisers Paul aus den Residenzen verwiesen war, auf seinem Gut Lysyje-Gory, ohne es jemals zu verlassen, und mit ihm seine Tochter, Prinzessin Marja, und deren Gesellschafterin Mademoiselle Bourienne. Auch unter der neuen Regierung war er, obgleich ihm die Erlaubnis zur Rückkehr in die Residenzen erteilt worden war, beständig auf dem Land wohnen geblieben; er sagte, wer etwas von ihm wolle, der werde auch die hundertfünfzig Werst von Moskau nach Lysyje-Gory fahren; er selbst aber brauche niemand und nichts. Er war der Ansicht, alle Fehler der Menschen entsprängen nur aus zwei Quellen: Müßiggang und Aberglauben; und ebenso gebe es nur zwei Tugenden: Fleiß und Klugheit. Die Erziehung seiner Tochter hatte er selbst übernommen; er gab ihr, um diese beiden Tugenden bei ihr zur Entwicklung zu bringen, immer noch, obgleich sie schon zwanzig Jahre alt war, Unterricht in der Algebra und der Geometrie und hatte ihre ganze Zeit so eingeteilt, daß immer eine Beschäftigung die andere ablöste. Er selbst war unaufhörlich tätig: bald schrieb er an seinen Memoiren, bald beschäftigte er sich mit Aufgaben aus dem Gebiet der höheren Mathematik, bald drechselte er Tabaksdosen auf der Drehbank, bald arbeitete er im Garten und beaufsichtigte die Bauten, die auf seinem Gut niemals aufhörten. Da die wichtigste Voraussetzung beim Fleiß die Ordnung ist, so war auch die Ordnung in seiner Lebensweise bis aufs äußerste getrieben. Sein Erscheinen zu den Mahlzeiten erfolgte stets in genau derselben, unveränderlichen Weise, und nicht nur zu derselben Stunde, sondern sogar zu derselben Minute. Mit den Personen seiner Umgebung, von der Tochter angefangen bis zu der Dienerschaft, verkehrte der Fürst in scharfem Ton und stellte an einen jeden hohe Ansprüche, von denen er nie abging; so kam es, daß er, ohne grausam zu sein, allen eine Furcht und einen Respekt eingeflößt hatte, wie sie selbst der grausamste Haustyrann nicht leicht hätte hervorrufen können. Obwohl er nicht mehr im Dienst war und jetzt keinerlei Einfluß auf die Regierungsangelegenheiten besaß, so hielt es doch jeder Chef des Gouvernements, in welchem das Gut des Fürsten lag, für seine Pflicht, sich ihm vorzustellen, und wartete geradeso wie der Baumeister und der Gärtner und die Prinzessin Marja in dem hohen Geschäftszimmer auf den Zeitpunkt, für welchen der Fürst sein Erscheinen in Aussicht gestellt hatte. Und jeder empfand in diesem Geschäftszimmer das gleiche Gefühl des Respektes, ja sogar der Furcht, wenn sich nun die gewaltig hohe Tür des Arbeitszimmers öffnete und die ziemlich kleine Gestalt des alten Herrn erschien, mit gepuderter Perücke, mit den kleinen, dürren Händen und den grauen, überhängenden Brauen, die manchmal, wenn er sie zusammenzog, den Glanz seiner klugen und noch ganz jugendlich blitzenden Augen verdeckten.
Am Vormittag desjenigen Tages, an welchem die Ankunft des jungen Ehepaares nachher wirklich stattfand, betrat Prinzessin Marja wie gewöhnlich zu der für den Unterricht angesetzten Stunde das Geschäftszimmer zum Zweck der Morgenbegrüßung, bekreuzte sich mit einer gewissen Bangigkeit und sprach im stillen ein Gebet. So trat sie täglich hier herein und betete täglich, daß diese Begegnung glücklich vonstatten gehen möge.
Der alte, gepuderte Diener, der im Geschäftszimmer saß, stand leise auf und sagte flüsternd: »Haben Sie die Güte einzutreten.«
Durch die Tür war das gleichmäßige Geräusch einer Drehbank zu hören. Die Prinzessin zog schüchtern an der leicht und glatt sich öffnenden Tür und blieb an der Schwelle stehen. Der Fürst arbeitete an der Drehbank; er sah sich um und fuhr in seiner Tätigkeit fort.
Das ungewöhnlich große Arbeitszimmer war mit lauter Gegenständen angefüllt, die augenscheinlich fortwährend benutzt wurden. Ein großer Tisch, auf welchem Bücher und Pläne lagen, hohe, mit Büchern vollgestellte Glasschränke, in deren Türen die Schlüssel steckten, ein Stehpult, auf dem ein aufgeschlagenes Heft lag, eine Drehbank, auf der die nötigen Instrumente handgerecht geordnet waren und um die ringsherum der Boden mit Abfallspänen bedeckt war: alles zeugte von einer beständigen, mannigfaltigen, wohlgeordneten Tätigkeit des Bewohners. Und aus den Bewegungen des kleinen Fußes, den ein silbergesticktes tatarisches Stiefelchen umschloß, sowie aus dem festen Andrücken der sehnigen, mageren Hand konnte man ersehen, daß in dem Fürsten noch die zähe, widerstandsfähige Kraft eines frischen Greisenalters steckte. Nachdem er das Rad noch ein paar Umdrehungen hatte machen lassen, nahm er den Fuß vom Trittbrett der Drehbank herunter, wischte den Drehstahl ab, warf ihn in eine an der Drehbank angebrachte Ledertasche, ging an den Tisch und rief seine Tochter heran. Er segnete seine Kinder niemals; so hielt er ihr denn nur seine stachlige, an diesem Tag noch nicht rasierte Wange hin, musterte sie mit einem prüfenden Blick und sagte in strengem Ton, aus dem aber doch eine gewisse Zärtlichkeit herauszuhören war: »Wohl und munter? Nun, dann setz dich!« Er griff nach einem von ihm eigenhändig geschriebenen Geometrieheft und zog sich mit dem Fuß seinen Sessel heran.
»Für morgen!« sagte er, indem er schnell eine Seite aufschlug und mit seinem harten Nagel von einem Paragraphen bis zu einem andern einen Strich als Zeichen eindrückte. Die Prinzessin beugte sich über den Tisch und das Heft.
»Warte; da ist ein Brief für dich«, sagte der alte Mann, holte aus einer oberhalb des Tisches befestigten Tasche einen Brief, dessen Adresse eine weibliche Hand erkennen ließ, und warf ihn auf den Tisch.
Beim Anblick des Briefes erschienen auf dem Gesicht der Prinzessin rote Flecke. Eilig griff sie nach ihm und bückte sich über ihn.
»Von deiner Héloïse?« fragte der Fürst kühl lächelnd, wobei seine starken, gelblichen Zähne sichtbar wurden.
»Ja, von Julja«, antwortete die Prinzessin; sie blickte den Vater schüchtern an und lächelte zaghaft.
»Noch zwei Briefe will ich durchlassen; aber den dritten werde ich lesen«, sagte der Fürst in strengem Ton. »Ich fürchte, ihr schreibt einander viel dummes Zeug. Den dritten Brief werde ich lesen.«
»Sie können ja auch diesen schon lesen, Väterchen«, antwortete die Prinzessin, noch stärker errötend, und reichte ihm den Brief hin.
»Den dritten; ich habe gesagt: den dritten!« rief der Fürst kurz und stieß den Brief zurück. Dann stützte er den Ellbogen auf den Tisch und zog das Heft mit den geometrischen Figuren näher heran.
»Nun, mein Fräulein«, begann der Alte, beugte sich dicht neben seiner Tochter über das Heft und legte den einen Arm auf die Lehne des Sessels, auf dem die Prinzessin saß, so daß diese sich von allen Seiten von einer ihr schon längst bekannten Atmosphäre, gemischt aus Tabaksgeruch und jener scharfen Hautausdünstung, wie sie alten Leuten eigen ist, umgeben fühlte. »Nun, mein Fräulein, diese Dreiecke sind einander ähnlich; du siehst: der Winkel A B C ...«
Die Prinzessin blickte ängstlich nach den so nahe neben ihr blitzenden Augen des Vaters; rote Flecke erschienen auf ihrem Gesicht, und es war klar, daß sie nichts verstand und sich dermaßen fürchtete, daß diese Angst sie auch hindern würde, alle weiteren Darlegungen des Vaters zu begreifen, mochten sie an sich auch noch so klar sein. Ob nun die Schuld an dem Lehrer lag oder an der Schülerin, genug, jeden Tag wiederholte sich derselbe Vorgang: es wurde der Prinzessin dunkel vor den Augen, sie sah und hörte nichts mehr, sie fühlte nur in ihrer nächsten Nähe das hagere Gesicht des strengen Vaters, sie empfand seinen Atem und seinen Geruch und hatte nur den einen Gedanken, wie sie wohl am schnellsten aus dem Arbeitszimmer des Vaters herauskommen und auf ihrer eigenen Stube sich die Aufgabe in Ruhe zum Verständnis bringen könne. Der Alte geriet in Erregung, schob den Sessel, auf dem er saß, mit Gepolter vom Tisch zurück und wieder heran, suchte sich zu beherrschen, um nicht heftig zu werden, und wurde es doch fast jedesmal, schalt und schleuderte manchmal ärgerlich das Heft auf den Tisch.
Die Prinzessin hatte eine falsche Antwort gegeben.
»Na, du bist aber doch auch zu dumm!« rief der Fürst, stieß das Heft von sich und wandte sich schnell ab. Im nächsten Augenblick stand er auf, ging ein paarmal im Zimmer hin und her, berührte leise mit den Händen das Haar der Prinzessin und setzte sich wieder hin.
Er rückte seinen Sessel an den Tisch heran und fuhr in seinen Erläuterungen fort.
»Ja, das muß sein, Prinzessin, das muß sein«, sagte er, als die Prinzessin das Heft mit den Aufgaben für das nächste Mal genommen und zugemacht hatte und bereits im Begriff war wegzugehen. »Die Mathematik ist eine wichtige Sache, mein Fräulein. Ich möchte nicht, daß du unsern dummen jungen Damen ähnlich bist. Nur Ernst und Ausdauer; dann gewinnt man die Sache lieb.« Er streichelte ihr mit der Hand die Wange. »Die Mathematik macht den Kopf klar.«
Sie wollte hinausgehen; aber er hielt sie durch eine Handbewegung zurück und nahm von dem Stehpult ein neues, unaufgeschnittenes Buch herunter.
»Da ist noch ein Buch mit dem Titel ›Der Schlüssel des Geheimnisses‹; das schickt dir deine Héloïse. Sie ist wohl sehr religiös. Nun, ich lasse jeden Menschen glauben, was er will, und menge mich da nicht ein. Ich habe nur ein wenig hineingesehen. Nimm! Nun, dann geh nur, geh!«
Er klopfte ihr auf die Schulter und machte selbst hinter ihr die Tür zu.
Prinzessin Marja kehrte mit der trüben, verschüchterten Miene, die nur selten von ihr wich und ihr an sich schon unschönes, kränkliches Gesicht noch unschöner machte, in ihr Zimmer zurück und setzte sich an ihren Schreibtisch, auf dem eine Menge kleiner Porträts standen und Hefte und Bücher in Massen umherlagen. Die Prinzessin war ebenso unordentlich, wie ihr Vater ordentlich war. Sie legte das Geometrieheft hin und erbrach ungeduldig den Brief. Der Brief kam von der besten Jugendfreundin der Prinzessin; diese Freundin war jene selbe Julja Karagina, die am Namenstag bei Rostows gewesen war.
Julja schrieb auf französisch:
»Liebe, teure Freundin!
Es ist doch etwas Schreckliches, etwas Entsetzliches, voneinander getrennt zu sein. Ich mag mir noch so oft sagen, daß Sie die Hälftes meines Daseins und meines Glückes bilden und daß trotz der Entfernung, die uns trennt, unsere Herzen durch unauflösliche Bande verknüpft sind, dennoch bäumt sich mein Herz gegen das Schicksal auf, und trotz der Vergnügungen und Zerstreuungen, die mich umgeben, bin ich nicht imstande, eine gewisse heimliche Traurigkeit zu überwinden, die ich seit unserer Trennung im tiefsten Grunde meines Herzens empfinde. Warum sitzen wir nicht mehr wie in diesem Sommer in Ihrem großen Zimmer zusammen auf dem blauen Sofa, dem ›Sofa der vertraulichen Bekenntnisse‹? Warum kann ich nicht mehr wie vor drei Monaten neue seelische Kraft aus Ihrem so sanften, ruhigen, tiefdringenden Blick schöpfen, aus diesem Blick, den ich so sehr liebte, und den ich jetzt, wo ich an Sie schreibe, vor mir zu sehen glaube!«
Als Prinzessin Marja bis zu dieser Stelle gelesen hatte, seufzte sie und betrachtete sich in dem Trumeau, der rechts von ihr stand. Der Spiegel zeigte ihr einen unschönen, schwächlichen Körper und ein mageres Gesicht. Ihre Augen, auch sonst immer traurig, blickten jetzt mit dem Ausdruck ganz besonderer Hoffnungslosigkeit auf ihr Spiegelbild. »Sie will mir schmeicheln«, sagte die Prinzessin zu sich selbst, wandte sich vom Spiegel ab und fuhr fort zu lesen. Jedoch hatte Julja ihrer Freundin wirklich keine leere Schmeichelei geschrieben: die großen, tiefen, leuchtenden Augen der Prinzessin, die mitunter geradezu ganze Garben eines warmen Lichtes auszustrahlen schienen, waren tatsächlich so schön, daß trotz der Unschönheit des ganzen übrigen Gesichtes diese Augen oft reizvoller wirkten als es ein schönes Gesicht vermocht hätte. Aber die Prinzessin bekam diesen schönen Ausdruck ihrer Augen nie zu sehen, diesen Ausdruck, welchen sie in den Augenblicken annahmen, wo sie gar nicht an sich selbst dachte. Wie bei allen Menschen erhielt ihr Gesicht einen gespannten, unnatürlichen, häßlichen Ausdruck, sobald sie sich im Spiegel betrachtete. Sie las weiter:
»Ganz Moskau spricht nur vom Krieg. Von meinen beiden Brüdern befindet sich der eine schon im Ausland; der andere steht bei der Garde, die jetzt ihren Marsch nach der Grenze antritt. Unser teurer Kaiser hat Petersburg verlassen, und wie man behauptet, beabsichtigt er, sein kostbares Leben selbst den Wechselfällen des Krieges auszusetzen. Gott wolle geben, daß das korsische Ungeheuer, das die Ruhe Europas stört, durch den Engel niedergeschmettert werde, den Er, der Allmächtige, in Seiner Barmherzigkeit uns zum Herrscher gegeben hat. Ganz abgesehen von meinen Brüdern hat mich dieser Krieg eines Umganges beraubt, der meinem Herzen besonders teuer war. Ich meine den jungen Nikolai Rostow, der in seiner Begeisterung es nicht hat ertragen können, untätig zu bleiben, und die Universität verlassen hat, um in die Armee einzutreten. Ja, liebe Marja, ich will es Ihnen gestehen, daß, obwohl er noch ein sehr, sehr junger Mensch ist, sein Abgang zur Armee mir ein großer Schmerz gewesen ist. Dieser junge Mann, von dem ich Ihnen schon im Sommer erzählte, besitzt eine edle Gesinnung und eine echt jugendliche Frische, wie man sie nur so selten in unserem Jahrhundert antrifft, wo wir unter zwanzigjährigen Greisen leben. Besonders hervorzuheben sind sein Freimut und seine Herzhaftigkeit. Sein ganzes Denken ist so rein und poetisch, daß meine Beziehungen zu ihm, so flüchtig sie auch waren, dennoch eine der süßesten Freuden meines Herzens bildeten, das schon so viel gelitten hat. Ich werde Ihnen später einmal erzählen, wie wir voneinander Abschied nahmen, und Ihnen alles mitteilen, was wir dabei gesprochen haben. Jetzt ist das alles noch zu frisch. Ach, meine teure Freundin, Sie können sich glücklich schätzen, daß Sie diese Freuden und diese qualvollen Leiden nicht kennen. Jawohl, glücklich; denn die letzteren sind gewöhnlich viel stärker! Ich weiß sehr wohl, daß Graf Nikolai zu jung ist, als daß er mir jemals mehr als ein Freund werden könnte. Aber diese süße Freundschaft, dieses reine, poetische Verhältnis ist meinem Herzen ein Bedürfnis gewesen. Aber sprechen wir nicht mehr davon.
Die große Tagesneuigkeit, die ganz Moskau beschäftigt, ist der Tod des alten Grafen Besuchow und seine Hinterlassenschaft. Denken Sie sich, die drei Prinzessinnen haben nur ganz wenig bekommen, Fürst Wasili gar nichts, und Monsieur Pierre hat alles geerbt und ist obendrein als legitimer Sohn anerkannt worden, somit jetzt Graf Besuchow und Besitzer des größten Vermögens in ganz Rußland. Es heißt, Fürst Wasili habe in dieser ganzen Angelegenheit eine recht häßliche Rolle gespielt und sei mit sehr langem Gesicht nach Petersburg zurückgefahren.
Ich muß Ihnen gestehen, mein Verständnis von diesen Testamentsangelegenheiten ist nur ein sehr geringes; aber seit der junge Mann, den wir alle unter dem simplen Namen Monsieur Pierre kannten, Graf Besuchow und Herr eines so gewaltigen Vermögens geworden ist, ist es für mich ein köstliches Amüsement, bei den mit heiratsfähigen Töchtern gesegneten Müttern und bei diesen jungen Damen selbst zu beobachten, wie sich ihr Ton und ihr ganzes Benehmen diesem jungen Mann gegenüber geändert haben, der mir, beiläufig gesagt, immer als ein herzlich unbedeutendes Individuum erschienen ist. Wie die Leute schon seit zwei Jahren ihr Vergnügen darin finden, mich mit jungen Männern zu verloben, die ich meistens gar nicht kenne, so macht mich jetzt der Moskauer Heiratsklatsch zur Gräfin Besuchowa. Aber Sie können sich leicht denken, daß mein Streben nicht im entferntesten dahin geht, es zu werden. Da ich aber gerade vom Heiraten rede: was sagen Sie dazu, daß mir vor kurzem die ›Allerweltstante‹ Anna Michailowna unter dem Siegel des tiefsten Geheimnisses ein Heiratsprojekt für Sie anvertraut hat? Und zwar handelt es sich um nicht mehr und nicht weniger als um den Sohn des Fürsten Wasili, Anatol, der durch die Heirat mit einem reichen, vornehmen Mädchen wieder in geordnete Verhältnisse gebracht werden soll; und da ist nun die Wahl seiner Eltern auf Sie gefallen. Ich weiß nicht, wie Sie die Sache ansehen werden; aber ich habe es für meine Pflicht gehalten, Sie davon in Kenntnis zu setzen. Es heißt, er sei ein sehr schöner junger Mann, aber ein arger Taugenichts; das ist alles, was ich über ihn habe in Erfahrung bringen können.
Aber nun genug mit diesem Geplauder! Ich bin schon am Ende des zweiten Briefbogens angelangt, und Mama läßt mich rufen, da wir zu Apraxins zum Diner müssen.
Lesen Sie das mystische Buch, das ich Ihnen gleichzeitig schicke; es macht hier bei uns gewaltiges Aufsehen. Obgleich in diesem Buch Dinge stehen, an die der schwache Menschenverstand kaum heranreicht, so ist es dennoch ein bewundernswürdiges Buch, dessen Lektüre auf die Seele beruhigend und erhebend wirkt. Adieu! Richten Sie bitte meine Empfehlungen an Ihren Herrn Vater und meine Grüße an Mademoiselle Bourienne aus. Ich umarme Sie in herzlicher Zuneigung.
Julja.
PS: Schreiben Sie mir doch, wie es Ihrem Bruder und seiner reizenden kleinen Frau geht.«
Die Prinzessin sann ein Weilchen mit einem schwermütigen Lächeln nach, wobei ihr Gesicht, von den strahlenden Augen erhellt, sich völlig verklärte; dann stand sie schnell auf und ging mit ihren schweren Schritten an den Tisch. Sie holte sich Briefpapier hervor, und ihre Feder begann schnell darüber hinzufahren. Die Prinzessin schrieb folgende Antwort:
»Liebe, teure Freundin!
Ihr Brief vom 13. hat mir eine große Freude bereitet. Sie lieben mich also immer noch, meine poetische Julja. Die Trennung, von der Sie so viel Böses sagen, hat also auf Sie ihre gewöhnliche Wirkung nicht ausgeübt. Sie klagen darüber, daß Sie von diesem und jenem getrennt sind – was müßte ich erst sagen, wenn ich überhaupt wagte, mich zu beklagen, ich, die ich aller derjenigen beraubt bin, die mir teuer sind? Ach, wenn wir nicht die Religion hätten, um uns zu trösten, so wäre das Leben doch gar zu traurig. Warum setzen Sie bei mir eine strenge Beurteilung voraus, wenn Sie mir von Ihrer Neigung zu dem jungen Mann schreiben? In solchen Dingen bin ich gegen niemand streng als gegen mich selbst. Ich habe für diese Gefühle bei anderen Verständnis, und wenn ich ihnen auch nicht eigentlich Beifall zollen kann, da ich sie nie selbst empfunden habe, so verurteile ich sie doch nicht. Nur bin ich der Ansicht, daß die christliche Liebe, die Nächstenliebe, die Liebe zu unseren Feinden verdienstlicher, süßer und schöner ist als die Empfindungen, welche die schönen Augen eines jungen Mannes bei einem poetisch veranlagten, der Liebe zugänglichen jungen Mädchen, wie Sie, hervorrufen können.
Die Nachricht von dem Tod des Grafen Besuchow war uns schon vor Ihrem Brief zugegangen, und mein Vater war davon tief ergriffen. Er sagt, das sei der vorletzte Repräsentant jenes großen Jahrhunderts gewesen, und nun komme er selbst an die Reihe; indes werde er tun, was in seinen Kräften stehe, um erst möglichst spät daranzukommen. Gott wolle uns vor diesem furchtbaren Unglück bewahren!
Ihre Meinung über Pierre, den ich schon gekannt habe, als wir noch Kinder waren, vermag ich nicht zu teilen. Er schien mir immer ein vortreffliches Herz zu besitzen, und das ist die Eigenschaft, die ich an den Menschen am höchsten schätze. Was seine Erbschaft anbelangt und die Rolle, die Fürst Wasili dabei gespielt hat, so ist das für alle beide recht traurig. Ach, liebe Freundin, das Wort unseres göttlichen Erlösers, es sei leichter, daß ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als daß ein Reicher in das Reich Gottes komme, dieses Wort ist ebenso wahr als furchtbar; ich beklage den Fürsten Wasili, aber noch mehr bedauere ich Pierre. So jung noch und dabei mit diesem Reichtum belastet, welche Versuchungen wird er da nicht durchzumachen haben! Wenn man mich fragte, was ich mir auf der Welt am meisten wünschte, so wäre mein Wunsch der, ärmer zu sein als der ärmste Bettler. Tausend Dank, liebe Freundin, für das mir freundlichst übersandte Werk, das bei Ihnen so großes Aufsehen erregt. Da Sie mir indessen schreiben, es enthalte neben mancherlei Gutem auch anderes, an das die schwache menschliche Vernunft nicht heranreicht, so scheint es mir ziemlich zwecklos, sich mit einer unverständlichen Lektüre zu beschäftigen, die eben deshalb keinerlei Vorteil gewähren kann. Unbegreiflich ist mir immer die Passion mancher Leute gewesen, sich die eigene Denkkraft dadurch zu verwirren, daß sie sich mit mystischen Büchern abgeben, die nur Zweifel im Geist des Lesenden erregen, seine Phantasie überreizen und seinem ganzen Wesen etwas Übertriebenes geben, das zu der christlichen Einfalt im schroffsten Widerspruch steht. Wir tun besser, die Schriften der Apostel und die Evangelien zu lesen. Aber auch da sollen wir nicht den Versuch machen, in das einzudringen, was sie Mysteriöses enthalten; denn wie könnten wir elenden Sünder uns erdreisten, in die furchtbaren, heiligen Geheimnisse der Vorsehung eindringen zu wollen, solange wir diese fleischliche Hülle an uns tragen, die zwischen uns und dem Ewigen gleichsam eine undurchdringliche Scheidewand errichtet? Begnügen wir uns lieber damit, die erhabenen Weisungen in uns aufzunehmen, die unser göttlicher Erlöser uns für unser irdisches Leben hinterlassen hat; suchen wir, uns nach ihnen zu bilden und ihnen zu folgen; lassen wir uns von der Überzeugung durchdringen, daß, je weniger freien Spielraum wir unserm schwachen menschlichen Geist verstatten, er um so angenehmer dem Allmächtigen ist, der alle Weisheit verwirft, die nicht von Ihm kommt, und daß, je weniger wir das zu ergründen suchen, was unserer Kenntnis zu entziehen Ihm gefallen hat, Er um so eher es uns durch Seinen Heiligen Geist wird erkennen lassen.
Von einem Bewerber um meine Hand hat mir mein Vater nichts gesagt; er hat mir nur mitgeteilt, er habe einen Brief vom Fürsten Wasili erhalten und erwarte dessen Besuch. Hinsichtlich des mich betreffenden Heiratsprojektes muß ich Ihnen, liebe, teure Freundin, sagen, daß die Ehe meiner Ansicht nach eine göttliche Einrichtung ist, der wir uns fügen müssen. Sollte der Allmächtige mir jemals die Pflichten einer Gattin und Mutter auferlegen, so werde ich, mag es mir auch noch so schwer werden, sie so treu, wie ich nur irgend kann, zu erfüllen suchen, ohne vorher eine ängstliche Prüfung meiner Gefühle gegen denjenigen vorzunehmen, den Er mir zum Gatten geben wird.
Von meinem Bruder habe ich einen Brief erhalten, in dem er mir seine und seiner Frau baldige Ankunft in Lysyje-Gory in Aussicht stellt. Aber es wird nur eine kurze Freude sein; denn er verläßt uns, um an diesem unglückseligen Krieg teilzunehmen, in den wir, Gott weiß wie und warum, uns haben hineinziehen lassen. Nicht nur dort bei Ihnen, im Mittelpunkt des geschäftlichen und gesellschaftlichen Lebens, bildet der Krieg das einzige Gesprächsthema; auch hier inmitten dieser ländlichen Arbeiten und dieses stillen Friedens der Natur, der nach der gewöhnlichen Vorstellung der Städter auf dem Land herrscht, macht sich das Geräusch des Krieges hörbar und in schmerzlicher Weise fühlbar. Mein Vater redet nur noch von Märschen und Kontremärschen, Dingen, von denen ich nichts verstehe, und als ich vorgestern bei meinem gewöhnlichen Spaziergang durch die Dorfstraße kam, wurde ich Zeugin einer herzzerreißenden Szene. Es war ein Trupp Rekruten, die bei uns ausgehoben waren und nun zum Heer abgehen sollten. Es war entsetzlich zu sehen, in welchem Zustand sich die Mütter, die Frauen und die Kinder der abmarschierenden Männer befanden, entsetzlich zu hören, wie die Zurückbleibenden und die Wegziehenden schluchzten! Man möchte sagen, die Menschheit habe die Gebote ihres göttlichen Erlösers vergessen, der uns doch geheißen hat, einander zu lieben und Beleidigungen zu verzeihen, und suche nun ihr größtes Verdienst in der Kunst, sich wechselseitig zu morden.
Adieu, liebe, gute Freundin! Mögen unser göttlicher Erlöser und Seine allerheiligste Mutter Sie in ihren heiligen, mächtigen Schutz nehmen.
Marja.«
»Ah, Sie sind dabei, einen Brief für die Post zurechtzumachen, Prinzessin; ich habe den meinigen schon fertiggestellt. Ich habe an meine arme Mutter geschrieben«, sagte rasch mit angenehmer, vollklingender Stimme, das r etwas schnarrend, die lächelnde Mademoiselle Bourienne; sie brachte in die bedrückende, trübe, ernste Atmosphäre der Prinzessin gleichsam einen Hauch aus einer ganz anderen Welt, etwas Leichtlebiges, Vergnügtes, Selbstzufriedenes.
»Ich muß Sie warnen, Prinzessin«, fügte sie mit leiserer Stimme hinzu; »der Fürst hat einen Wortwechsel« (das Wort »Wortwechsel« sprach sie ganz besonders schnarrend und hatte offenbar ihr Vergnügen daran, sich selbst zu hören), »einen Wortwechsel mit Michail Iwanowitsch gehabt. Er ist sehr übler Laune, sehr mißgestimmt. Seien Sie also gewarnt; Sie wissen ja ...«
»Oh, liebe Freundin«, erwiderte die Prinzessin Marja, »ich habe Sie gebeten, niemals mit mir darüber zu sprechen, in welcher Laune sich mein Vater befindet. Ich erlaube mir nicht, über ihn zu urteilen, und mag nicht gern, daß andere es tun.«
Die Prinzessin sah nach der Uhr, und als sie bemerkte, daß bereits fünf Minuten von der Zeit verstrichen waren, die sie auf das Klavierspiel verwenden sollte, ging sie mit erschrockener Miene nach dem Sofazimmer. Die Zeit von zwölf bis zwei Uhr widmete nach der festgesetzten Tagesordnung der Fürst der Ruhe und Erholung, und die Prinzessin hatte unterdessen Klavier zu spielen.