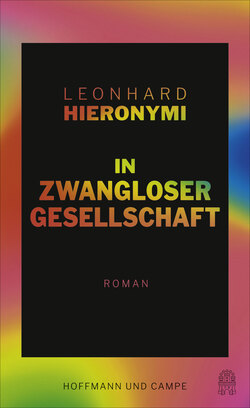Читать книгу In zwangloser Gesellschaft - Leonhard Hieronymi - Страница 6
2 Frankfurt am Main
ОглавлениеEs war warm, und von allen Stadträndern Frankfurts schoben sich schwere Regenwolken in unsere Richtung. Wir saßen im Auto meines Bruders und hörten das zweite Album der neuseeländischen Band Die! Die! Die!, was ich während der Fahrt zu einem Friedhof als etwas Unangenehmes empfand, aber man bekam die CD nicht mehr aus dem Schlitz der Anlage heraus.
Wir parkten am südlichen Eingang des Friedhofs zwischen einem Blumengeschäft und einer Pizzeria und gingen zügig in nördliche Richtung, wo wir begannen, nach dem Grab von Robert Gernhardt zu suchen, dem zweitgrößten Dichter Frankfurts.
Unter anderem waren hier die Schriftstellerinnen Dorothea Schlegel und Ricarda Huch, der Verleger Siegfried Unseld, die Frauenrechtlerin Meta Quarck-Hammerschlag und der Mundartdichter Friedrich Stoltze neben Adorno, Reich-Ranicki und Schopenhauer bestattet worden, aber Gernhardt war mir der Wichtigste. Beziehungsweise um ihn machte ich mir die meisten Sorgen. Denn während er vor zwanzig oder dreißig Jahren noch große Leserschaften erreichte, musste man ihn ein paar Jahre später schon immer wieder auffrischen und seine Gedichte zitieren, um die nächste Generation an ihn zu erinnern. Vielleicht ist es der ewige Fluch derjenigen Literatur, die Ernst und Spaß miteinander verbinden will, die Gernhardt vom großen Weltruhm bis heute fernhält. In diesem Land scheitert diese Literatur ja immer. Warum, das konnte nicht mal Gernhardt selbst sagen, aber er ärgerte sich: »All die Jahre hatte mich weniger der Unverstand der Kritiker bekümmert, als ihr Unwille oder ihr Unvermögen, sich zu den komischen Produkten zu äußern.«
Gernhardt starb im Sommer 2006, während des Sommermärchens, am Tag des Viertelfinalspiels Deutschland gegen Argentinien. Wahrscheinlich bei Sonnenschein oder im Lärm der Abenddämmerung, begleitet vom Hupen Hunderter Autos im Autokorso.
Die Grabnummer, die ich mir in mein Notizbuch geschrieben hatte, stimmte zwar, erwies sich aber als vollkommen nutzlos. Die einzelnen Abschnitte des Friedhofs hießen »Gewann«, aber sie folgten keiner Struktur. Wie wild durcheinandergewürfelt lagen mehrere hundert Tote auf diesen mit Gehwegen voneinander abgegrenzten Abschnitten, und da brachte einem die teilweise vierstellige Nummer wenig. Einige der Nummern waren an unscheinbaren Stellen auf die Grabsteine selbst graviert, aber meist wurden sie von Erde und Pflanzen verdeckt.
Ich beschrieb meinem Bruder detailliert die Stationen meiner geplanten Reise bis hin zur Rückkehr in die Kallistus-Katakombe, dort würde sich ein Kreis schließen.
Er konnte sich an unseren Lachanfall erinnern, er erkannte die Obsession in der Unternehmung und betrachtete wenigstens das (nicht die Suche an sich) als etwas Natürliches und Nützliches – und, genauso wie ich, überhaupt jedes künstliche Schaffen einer »Aufgabe« für eigentlich alle Personen dieser Erde als etwas Überlebenswichtiges.
Trotzdem machte meine Suche für ihn keinen Sinn.
Noch während wir im Gewann A nach dem Grab Nummer 1103 suchten, begann es in Strömen zu regnen. Ich stellte mich unter einen Lindenbaum und berührte dabei seinen Stamm nicht, während mein Bruder weiter die Reihen entlangging.
In Bratislava hatte ich vor einigen Jahren in der Nähe des unter Denkmalschutz stehenden Gaistor-Friedhofs einmal mehrere Topvar-Biere in der Abenddämmerung getrunken und war dann über den dunklen Friedhof gelaufen. Die Grabsteine hingen dort windschief zwischen den Tannen, man konnte die Inschriften nicht mehr erkennen, und obwohl der Friedhof unter Denkmalschutz stand, befand er sich in einem geisterhaften Auflösungszustand. Plötzlich fühlte ich mich seltsam erschöpft, es war einer der ersten warmen Frühlingstage gewesen, also nahm ich unter einer Tanne Platz und lehnte mich an ihren Stamm. Irgendeine Seele wollte den Friedhof aber verlassen und schien mich als Portal benutzen zu wollen. Über meinen Rücken zog sich ein eisiger Schauer. Sofort schoss ich in einem Anflug von Aberglaube und Pathetik auf und rannte über den Friedhof zum Ausgang und in die Stadt zurück.
Das seltsame Gefühl hielt aber an. Ich beschloss, fast panisch, Bratislava und die Slowakei noch an diesem Abend zu verlassen, und setzte mich in meinen Ford, um nach Wien zu fahren. Als ich den ersten Gang einlegen wollte, tat sich nichts. Irgendetwas schien zu klemmen. Ich schlug auf das Armaturenbrett ein, es gab einen gewaltigen Schlag, und ich fuhr los. Ich war mir sicher, dass der Geist direkt vom Baum in meinen Körper und von dort aus über die Gangschaltung ins Auto gerast war. Und erst auf der Autobahn und kurz hinter der slowakisch-niederösterreichischen Grenze verflüchtigte sich das seltsame Gefühl, weil ich annahm – und überhaupt allgemein angenommen wird –, dass Seelen nicht mit mehr als fünfzig Stundenkilometer reisen können.
Seitdem weiß ich: Friedhofsbäume sind keine normalen Bäume. Man sollte es vermeiden, sie zu berühren.
Ich blickte mich um, mein Bruder war verschwunden.
Ganz in der Nähe stand eine Frau an einem Familiengrab, das am Rande einer Mauer lag – gegenüber von Familie Neckermann. Es war eine echte Frankfurter Bürgerin. Sie trug eine seltsame Baumwollpopeline-Tunika und ein Foulard aus Seidentwill. Unsere Blicke trafen sich, und sie fragte, ob ich jemanden Bestimmten suchen würde.
Ich trat ein wenig unter der Linde hervor.
»Ja, Robert Gernhardt.«
»Ach, Gernhardt.« Sie überlegte und sagte dann: »Nein, weiß ich leider nicht. Sehen Sie, ich habe so lange gebraucht, um dieses Grab nach der Beerdigung wiederzufinden.« Sie zeigte auf einen großen Stein. »Ich habe mir dann den Weg beim dritten Mal aufgezeichnet. Inzwischen brauche ich meine Wegbeschreibung nicht mehr, aber es ist schon kompliziert, nicht?!«
»Irgendwie schon.«
»Na ja, vielleicht geh ich dann das nächste Mal auch noch kurz zum Gernhardt. Auf Wiedersehen.«
In Frankfurt hatte es um die Gründer der Satiremagazine pardon und Titanic und der daraus entstandenen Neuen Frankfurter Schule, der Gernhardt angehörte, eine jahrzehntelange und gut funktionierende »Verbrüderung zwischen Künstlern und Bürgertum« gegeben. FAZ-Redakteur Platthaus schwärmt in einem kurz nach der Trauerfeier veröffentlichten Text vom vergangenen Beieinander- und Zusammensein, dem gemeinsamen Tennisspielen und Tischtennisspielen, den Gartenpartys und Urlauben und Besuchen und Dinners und den endlosen Nächten in den Kneipen, in denen man heimlich von Gernhardt in ein Schulheft von Brunnen gezeichnet wurde.
Ich stellte mich zurück unter die Linde. Es regnete immer noch. Die Friedhofsgärtner hatten ihre Arbeit eingestellt und standen mit ihren Wagen unter kleinen Hütten. Ich rief meinen Bruder an, aber er konnte natürlich nur schwer erklären, wo er war, also legte ich wieder auf. Als ich ihn von weitem sah, traute ich mich aus Pietätsgründen nicht zu schreien, ich traute mich auch nicht, zu ihm zu rennen. Ich beobachtete seine Laufwege und beschloss, ihm den Weg abzuschneiden. Ich ging nach rechts an einer Reihe Urnensteinen vorbei und dann nach links, wo ich auf einmal ungeschützt im Regen und am Grab von Arthur Schopenhauer stand. Unweigerlich musste ich an eine seltsame Geschichte denken, die ich zuvor im Internet gelesen hatte: Vor mehr als dreißig Jahren hatte man nämlich das Grab von Schopenhauer geöffnet und, ohne mit der Wimper zu zucken, den (zu diesem Zeitpunkt bereits ehemaligen) Präsidenten der Schopenhauer-Gesellschaft, Arthur Hübscher, einfach mit zu Schopenhauer ins Grab gelegt. »Der Tod hat sie endlich vereint«, hieß es in einer Grabrede, dabei kannten sich die beiden überhaupt nicht. Einen Interpreten zusammen mit dem Verfasser der zu interpretierenden Objekte zu begraben, das kommt schon einer Grabschändung gleich. Gerade Schopenhauer sollte man lieber in Ruhe lassen, schließlich handelt es sich bei ihm um den Mann, der gesagt hat, dass die sogenannten Menschen »fast durchgängig nichts anderes sind als Wassersuppen mit etwas Arsenik«. Schopenhauer hätte es allerdings wie Shakespeare machen sollen, auf dessen Grabplatte ein Fluch graviert ist: »Gesegnet sei der Mann, der schonet diese Steine, und jeder sei verflucht, der stört meine Gebeine.« Bis heute hat sich niemand an die Innereien seines Grabes getraut.
Zum Glück hielt Schopenhauer die Lehre von der Seelenwanderung nur für eine populäre Form der Lehre des Willens zum Leben – und deshalb auch selbst nichts von Unsterblichkeit. Also konnte es ihm im Grunde genommen egal sein, mit wem er dort nun begraben liegt.
Aber es ist fraglich, wem das Grab Schopenhauers gehört. Wenn damals die Familie schon verschwunden war und sich die Stadt Frankfurt mit der Schopenhauer-Gesellschaft zusammentat, wer könnte dann die mit Hunderten kulturbürokratischen Verträgen abgesicherte (und dadurch als selbstverständlich betrachtete) Grabschändung noch zurücknehmen?
Ich drehte mich um und zuckte zusammen, mein Bruder stand wie ein Geist neben mir. Auch er hatte Gernhardt noch nicht gefunden.
Wir stellten uns in einer kleinen Holzhütte unter, wo ein junger Gärtner mit Hörgerät auf seinem Bewässerungswagen saß. Von Gernhardt hatte dieser noch nie etwas gehört. Wir sagten ihm die Nummer, da runzelte er kurz mit der Stirn.
»Das ist da hinten, hinter den Schwestern.«
»Hinter den Schwestern?«
»Ja genau.«
»Okay …«
Wir wussten natürlich nicht, wer die Schwestern waren, konnten es uns aber denken.
»Regnet es eigentlich stark?«, fragte er.
»Es geht. Nein, eigentlich nicht mehr …«
Wir gingen in die Richtung, die er uns angezeigt hatte, aber auch da, »hinter den Schwestern«, konnten wir den Grabstein nicht finden. Wir gingen weiter ziellos umher und schritten die Reihen ab. Es hörte langsam auf zu regnen, die Schwüle kam zurück. Mein Bruder schaute immer wieder auf die Uhr, weil irgendein Treffen mit irgendeiner Frau näher rückte. Ich machte mir schon ein schlechtes Gewissen, aber da sahen wir es plötzlich.
Es bestand aus einer kleinen nach oben hin abbrechenden und von Efeu umschlungenen Säule toskanischer Ordnung. Auf der Säule standen nur sein Name, das Geburts- und Todesdatum, der Name seiner ersten Frau Almut und die Namen Chia und Bella, den Haustieren.
»Wie war das damals, auf Gernhardts Beerdigung?«, wollte ich später in einer E-Mail vom ehemaligen Chefredakteur und heutigen Herausgeber des von Gernhardt mitgegründeten Titanic-Magazins, Hans Zippert, wissen. »Gab es irgendwelche Erscheinungen? Irgendwelche Seltsamkeiten?«
Er antwortete prompt.
»Ich kann mich nicht erinnern, ich war nämlich nicht dabei. Nur als Chlodwig Poth zu Grabe getragen wurde, hörte ich schon von weitem jemanden heftig schluchzen, und irgendwann saß da schließlich auf einer Bank der von heftigen Weinkrämpfen geschüttelte Wilhelm Genazino, der entweder aufgrund seiner Beleibtheit nicht in der Lage war, sich an einen dezenteren Ort zurückzuziehen, oder aber seine lautstarke Trauer öffentlich ausstellen wollte. Es war bizarr und anrührend zugleich.«
Alle waren kurz hintereinander gestorben. Erst Bernd Pfarr, zwei Tage später Chlodwig Poth, ein Jahr nach ihnen F.K. Waechter, dann Gernhardt. Mit einem Rundumschlag hatte die Frankfurter Satirikerszene Mitte der Nullerjahre einen Großteil ihrer Mitglieder an den Totengott Mors verloren.
Tot also waren diejenigen Autoren und Zeichner, deren ernstgemeinte Aufgabe es war, irgendwann und trotz der bei der Kritik verpönten komischen Literatur als Klassiker zu gelten – und die diese Aufgabe unweigerlich durch ihre relativ frühen Tode auch erfüllt hatten.
Vor seinem Tod bekam Gernhardt viel Krankenbesuch. Eckhard Henscheid wollte sich von seinem langjährigen Freund verabschieden, sie unterhielten sich, und Gernhardt erklärte Henscheid, er habe ein »schönes Leben geführt und keinen Grund zur Klage«, was Eckhard Henscheid wunderte, »angesichts der richtig bösartig fatalitätsmäßigen Abfolge von Gattinnenkrankheit und -tod, Schlaflosigkeit, Verlegermalaisen mit erheblichen Geldverlusten, Herzinfarkt und schließlich Krebs«. Für Henscheid eine »eindrückliche«, eine wie ihm schien »sehr gottgefällige Gesinnung«.
Oliver Maria Schmitt, aus der zweiten Generation der Neuen Frankfurter Schule, fragt sich in seinem fünf Jahre vor Gernhardts Tod erschienenen Buch Die schärfsten Kritiker der Elche, »warum aber ausgerechnet dieser so ganz unschöpferisch und unhypertonisch, vielmehr gelassen und cool wirkende Herr, der nie ein aggressiver oder polemisch-schimpfender Satiriker war, eher ein spottender und selbstbewußt Verlachender, nie ein vom Furor Getriebener, immer ein Betreibender – warum ausgerechnet der vom fiesen kleinen Herzkasperle heimgesucht wurde.« Ihm ist dann aber auch klar, dass »dies ew’ge Rätsel« sich in allen fortregt und dass außer Gernhardt wohl aus diesem Leid kaum jemand so viel gemacht hätte.
Wenige Tage vor Henscheid war schon Benjamin von Stuckrad-Barre bei Gernhardt. Barre wohnte zu dem Zeitpunkt gerade bei seinem Bruder in Frankfurt, um seine Kokainsucht zu bekämpfen – und er fuhr mit dem Fahrrad zu Gernhardt nach Hause, um diese letzte Begegnung für den Spiegel aufzuschreiben.
Sie sprachen bei Cappuccino und Kuchen über mögliche Grabsteininschriften, und Barre schlug als Vorlage die von Karl Kraus auf dem Wiener Zentralfriedhof vor – ein Grab, auf dem nichts steht außer Karl Kraus. Sei eine gute Idee, meinte Gerhardt dann, besser, als wenn da ein Hesse-Spruch draufkäme. Dann betrachteten sie Gernhardts knapp zweihundert Skizzen- und Notizhefte von Brunnen, die in einem Magazinschrank lagen und die er selbst als die Summe seines Werks bezeichnete. Er hat sie dem Literaturarchiv in Marbach verkauft, mit den Worten: »So was bekommt ihr nicht mehr wieder, dieses Doppeltalent.«
Zweieinhalb Wochen nach Barres Besuch, während des Lärms, der Autokorsos, während alle hupten und feierten, starb Robert Gernhardt. Und Barre, der an jenem Abend noch einmal mit dem Fahrrad an Gernhardts Haus vorbeifuhr, dachte: Vielleicht hupen sie ja nicht nur für den Fußball, sondern auch für ihn!
Mir gegenüber stand mein Bruder, er fotografierte mich. Ich trug ein Hawaiihemd und ließ die Schultern hängen. Ich war kein Grabräuber und kein Spiritist und gab mich an diesem Ort auch keinen äußerlich sichtbaren Ritualen hin – ich legte keine Blumen auf das Grab, beschwor keine Geister und zitierte auch keine Gedichte. Als ich an die Seele des menschlichen Körpers dachte, an Ektoplasma und Energie, da wurde mir schnell klar, dass Robert Gernhardt sicherlich schon lange nicht mehr hier gewesen war, an einem Ort, der für ihn schließlich das Ende der Welt bedeuten musste.
Unsterblich war er ja jetzt. Obwohl er auch gesagt hat: »Was nützen mir Buch / und Unsterblichkeitsscheiß / Wenn Marina nichts davon weiß?«
Marina war seine Friseurin.
Trotzdem wird Gernhardt nie verschwinden. Höchstens werden die Anekdoten baden gehen, zum Beispiel die, wie Gernhardt mal in feuerroten Hosen vom Dreimeterbrett im Schwimmbad von Nottula gesprungen ist.
Obwohl, gerade die nicht, die hat sein Freund F.K. Waechter in einer Bildergeschichte verewigt. Und Geschriebenes – Geschichten sind immerhin beständiger als das Wirkliche.
Mein Telefon vibrierte, ich hob ab:
»Wer ist da?«
»Ich bin’s, Maria. Was machst du?«
»Ich bin doch in Frankfurt, auf der Suche nach Gräbern.«
»Klingt aufregend«, sagte sie, ohne zu versuchen, dabei überzeugend zu klingen. »Ich muss dich um etwas bitten. Kannst du nächste Woche mit mir an die Oberhavel fahren? Ich glaube, meine Mutter braucht unsere Hilfe.«
»Was ist denn passiert?«, fragte ich.
»Es ist nichts Schlimmes, es ist gar nichts. Ich muss sie einfach mal wieder besuchen. Und es wäre schön, wenn du mitkommst.«
»Aber ich bin gerade erst losgefahren zu den Friedhöfen. Ich muss noch nach Mainz zu Ida Hahn-Hahn und zu Kathinka Zitz-Halein und nach Friedrichsdorf ans Grab von Karl-Herbert Scheer.«
»Zu wem?«
»Alle vergessen, alle tot.«
Kurz herrschte Stille, weil ich es ihr nicht erklären konnte.
»Gut, ist nicht so wild. Ruf mich an, wenn du es dir anders überlegst«, sagte sie.
»Moment!«, rief ich.
Ich überlegte. Einerseits konnte ich meine Reise doch nicht schon am Anfang unterbrechen, andererseits: Sicherlich würde ich auch dort, im Nordosten, Gräber finden, Friedhöfe sehen und Stimmungen einfangen können.
Ich betrachtete meinen Bruder, er scharrte mit den Füßen am Boden. Er wollte los, er wollte jetzt endlich zu diesem Treffen.
»Maria?«
Sie war noch dran.
»Ich hab’s mir anders überlegt.«