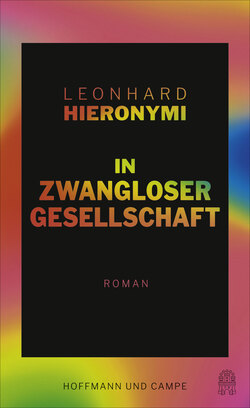Читать книгу In zwangloser Gesellschaft - Leonhard Hieronymi - Страница 8
4 Hamburg-Ohlsdorf
ОглавлениеDie Vespa sprang nach fünf Minuten endlich an, ich hatte sie seit vergangenem Oktober nicht mehr bewegt. Ich nahm von Süden kommend die ewig lange Fuhlsbüttler Straße und stellte das Moped vor einer Tischtennisplatte des Gartenvereins Klein Borstel ab, wo sich alle paar Minuten die U1 nach Norderstedt schob.
Ich hatte nichts dabei, keine Zigaretten, nichts zu trinken, keine Pfefferminzbonbons. Der Eingang »Kleine Horst«, der direkt von den Schrebergärten auf den Friedhof Ohlsdorf führt, war unscheinbar und schmal, ein Schild wies mahnend darauf hin, das Radrennen zu unterlassen, um Trauernde und die Totenruhe nicht zu stören.
Ich öffnete die App Friedhof Ohlsdorf, die ich mir am Tag zuvor für 2,99 Euro heruntergeladen hatte, und suchte nach Roger Willemsens Grab, es musste ganz in der Nähe sein. Die Existenz der App ist bezeichnend für die Dimensionen dieses Friedhofs: Es ist der größte Parkfriedhof der Welt. Er ist so groß, dass verschiedene Buslinien ihn durchqueren, Radfahrer ihn als Abkürzung durch die Stadt benutzen und es allerlei geheime Winkel gibt, in denen sich Menschen verschiedensten Ritualen hingeben. Jedes Jahr wird hier mindestens ein neues Mausoleum im sechsstelligen Bereich in Auftrag gegeben. Es gibt einen Friedhof für chinesische Seeleute, eine Abteilung für islamische Bestattungen, ein Bombenopfer-Sammelgrab und eins für die Sturmflutopfer von 1962, es gibt britische Soldatengräber, Wassertürme, vorgeschichtliche Gräber, Rosengärten, Mahnmale und einen Gedenkplatz für nicht beerdigte Kinder. Auf fast vierhundert Hektar befinden sich über zweihunderttausend Grabstätten, auf dem gesamten Gelände wurden seit der Gründung des Friedhofs über 1,4 Millionen Menschen beerdigt, täglich kommen ein Dutzend hinzu – aber ich sah keinen einzigen Trauerzug.
Zwischen den Gräbern und im Unterholz der Gruften und Laubtunnel war es schattig, und nur die ausufernden Straßen und Alleen, auf denen die Autos und Busse fuhren, lagen im Licht. An diesem Mittwochnachmittag sah ich anfangs, bis auf die Radfahrer, nur wenige Besucher. Man muss sich an den Friedhof in Ohlsdorf genauso gewöhnen wie an das Betreten einer lichtdurchfluteten Straße nach stundenlangem Stubengehocke. Erst nach und nach fielen mir verdächtige Statuen und Sprüche auf, erst da sah ich auch aus der Erde gerissene Holzkreuze mit Abdrücken von Lippenstift, entdeckte versteckte Champagnerflaschen und verlorene Einkaufszettel. Anfangs jedoch war ich geblendet von der Gewaltigkeit und dem Platz zwischen den Grabsteinen – und lief auch fast an dem von Willemsen vorbei, der eigentlich nicht zu übersehen war.
Der beliebte Schriftsteller war mir ziemlich fremd, allerdings konnte ich mir an seinem Grab sicher sein, dass dort das Verschwinden noch nicht so weit fortgeschritten war. Er war der Antipol zu den beinahe (oder schon gänzlich) verschwundenen Körpern, Gräbern und Erinnerungen anderer verstorbener Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die ich im Laufe der Reise noch besuchen wollte.
Der Grabstein war erst knapp ein Jahr alt, daneben eine vom arabischen Frauenverein gestiftete Bank. Ich dachte an Willemsens Tod, der ihn im Alter von sechzig ereilte, und daran, dass man eigentlich sterben konnte, wann man wollte, es war egal, denn laut Medien ging man immer »zu früh«, man konnte die achtzig überschreiten, aber auch das war heute »zu früh«. Und eigentlich war das nur ein Verehrung heuchelnder Vorwurf an die Toten: »Zu früh! Viel zu früh!« – als hätte man eine Wahl.
In Mandalay, in Burma, im Schatten einer Buddhafigur erklärte ein Wahrsager Willemsen mal: »Älter als achtzig werden? Nein, das ist leider unmöglich für Sie.« Und Willemsen dachte: »Leider. Zum ersten Mal in meinem Leben möchte ich einundachtzig Jahre alt werden. Doch während ich noch mit meiner Lebenserwartung hadere, tunkt der Erleuchtete eine bittere erdbeerförmige Frucht in Salz, und seine Augen sagen: Heul doch!«
Etwa ein halbes Jahr später würde mir mein Freund Joshua, der einen Monat in der Villa Willemsen in Reinbek zu Gast war, vom Sterbezimmer des Autors berichten:
»Da war nichts, das Zimmer wurde quasi entkernt. Irgendwie will man nicht, dass da ein Kult entsteht.«
Mit dem Gedanken spielend, es selbst zu besichtigen und irgendwelche parapsychologischen Verbindungslinien zwischen Todesort und letzter Ruhestätte zu ziehen, erinnerte ich mich an das Haus meiner Großeltern, das meine Mutter und ihre Schwestern nach deren Tod an eine fünfköpfige Familie vermietet hatten.
Irgendwann, in einem Frühling, überkam die drei Frauen eine verständliche Sehnsucht nach ihrem alten Zuhause, also riefen sie die neue Mieterin an, die gegen einen Rundgang durch das renovierte Haus nichts einzuwenden hatte – und weil auch ich mich gut an den ursprünglichen Zustand des Hauses erinnern konnte, begleitete ich sie.
Als wir später zusammen im früheren Büro meines Großvaters standen, das irgendwann zum Schlaf- und Sterbezimmer umfunktioniert worden war, überrollte meine Mutter die Mieterin gedankenlos mit den Worten: »Das ist jetzt das Schlafzimmer?! Hier sind unsere Eltern gestorben!«
Meine Mutter, bis heute diesen Umständen ignorierend gegenüberstehend, würde niemals die blauen Flecken vergessen, die ihre Schwestern und ich (aus Mangel an anderen sie zum Schweigen bringenden Möglichkeiten) danach auf ihrer Schulter hinterließen und die dadurch, dass meine Mutter von Natur aus wenige Thrombozyten besitzt, auch sofort anfingen, dunkelblau zu leuchten.
Dabei hatte meine Mutter recht, es ist doch beinahe unmöglich, in einer Großstadt in eine alte Wohnung oder ein altes Haus zu ziehen, in dem noch niemand ums Leben gekommen ist. So normal wie die lebendige Mieterin selbst (deren Blick ich niemals vergessen werde). Und Verbindungslinien ins Jenseits suchte man auch im Haus meiner Großeltern, so wie in dem Willemsens, vergeblich.
Wenig später – ich stand in Schmetterlingsblüten und wischte mir den Schweiß von der Stirn – sah ich einen kleinen Grabstein, von dem ich zuerst glaubte, es sei der des Schriftstellers und Kritikers Alfred Kerr, zumindest lag er in ähnlicher Position im Quadranten Z21, aber er war es nicht, es war der Grabstein einer Frau namens Waldtraut Pukall-White – »Schriftstellerin«.
Steine mit Berufsbezeichnungen waren nicht selten. Pukall-White lag dort alleine, wie Willemsen, und wann sie gestorben war, wollte man dem Besucher verheimlichen. Und später, als ich ihren Namen im Internet nachschlug, ergab er keinen einzigen Treffer, also war sie auch dort nicht mehr lebendig und für immer vergessen.
Ich ging weiter, immer weiter, durch Schatten und Licht und die Mischung aus Schatten und Licht. Aus dem Eingang einer von Bäumen überdachten Familiengruft schaute mir ein Feldhase entgegen. Ich kam endlich am Grab von Alfred Kerr vorbei, der gesagt hatte: »Man stirbt einen Tod und weiß nicht welchen, vielleicht ein schmuckes Schlaganfällchen.« Ich fragte mich, ob nicht das eigentlich der perfekte Spruch für einen Grabstein war.
Zum Ausruhen setzte ich mich an die Bushaltestelle »Nordteich«, auf meiner Liste hatten sich verschiedene prominente oder halbprominente, aber immer schreibende Hamburgerinnen und Hamburger versammelt: Hertha Borchert und ihr Sohn Wolfgang, die Schriftstellerin Marie Hirsch, der Schlagertexte schreibende Boxpromoter Walter Rothenburg und die Prinzessin Salme von Oman und Sansibar.
Gegenüber der Haltestelle bog ich nach der Hitzepause in einen von Tannennadeln bis an die Ränder gefüllten Weg ab, der neben einem düsteren Tümpel lag, wo ich den unter dem Namen »Seeteufel« bekannten Graf Luckner suchen wollte. Aber auch nach kleinlicher Untersuchung des Quadranten konnte ich ihn nicht finden. Wahrscheinlich war er dem Vergessen anheimgegeben worden, schließlich hatte er, neben seinen Seeabenteuern, die er unter den Titeln Seeteufel erobert Amerika oder Seeteufels Weltfahrt veröffentlichte, auch minderjährige Frauen missbraucht, darunter seine eigene Tochter.
Und obwohl die Sonne schien und ich von dem Dickicht, in dem der Seeteufel hätte liegen müssen, auf die große Norderstraße abgebogen war, bekam ich eine Gänsehaut bei dem Gedanken an die Verbrechen, die alle anderthalb Millionen Toten auf diesem Friedhof zusammengerechnet ausgeführt haben mussten.
Beinahe ohne Absicht entdeckte ich nur kurze Zeit später den Grabstein Harry Rowohlts. Am oberen Ende eines Hangs lag ganz alleine ein dicker weißer Ballon, aus dem über Nacht die Luft entwichen war. Hinter dem Stein, außerhalb des Friedhofsgeländes, fuhr die U1 ihre Runden, ein unruhiges Plätzchen.
Auf dem Stein befanden sich als Inschrift nur Geburts- und Todesjahr und die in ihn hineingekratzte Unterschrift Rowohlts. Zuerst las ich Henry Burgum, dann Iturk Norsklav, bis ich mich anhand der Jahreszahlen daran erinnerte, dass Harry Rowohlt genau siebzig Jahre alt geworden und damit leider auch »viel zu früh« von uns gegangen war. Er selbst dachte allerdings: »Immerhin bin ich siebzig geworden, mehr kann man nicht verlangen.«
Die Unterschrift auf dem eigenen Grabstein machte mich erst ein wenig stutzig, dann beinahe rasend. Bedeutete das, dass man den eigenen Tod quasi als letzten zu unterzeichnenden Vertrag selbst unterschrieben hatte? Eher deutete mir viel darauf hin, dass es sich bei diesem Stein um einen letzten Akt perfider deutscher Kulturbürokratie handelte.
Als ich direkt vor dem Stein stand, sah ich rechts hinter ihm etwas liegen, es war eine kleine Plastikflasche »Johnny Walker Red Label«-Whiskey. Ich drehte sie mit meinem Fuß um, sie war leer. Ich schaute noch tiefer ins Gestrüpp hinter dem Grabstein, aber da lag nichts mehr, nur diese Whiskeyflasche.
Wieder, wie nach meinem Besuch des Grabs von Gernhardt, fragte ich später Hans Zippert nach ungewöhnlichen Erscheinungen während der Beerdigung Rowohlts. Er antwortete auf Anhieb in einer langen E-Mail:
»Rowohlts Beisetzung habe ich nicht erlebt, nur die öffentliche Trauerfeier in der Fabrik in Altona. Auf Wunsch der Witwe war Oliver Maria Schmitt als Moderator engagiert worden, aber ihm schlug von der ersten Sekunde eine vollkommen unverständliche Abneigung entgegen, so als habe er sich da reingedrängt und als Nichthamburger schon gar kein Recht, sich einzumischen. Ein sehr schwerer Abend für ihn. Für mich war es ein Triumph, weil ich mit Vacoped-Schuh, nach gerade überstandenem Achillessehnenriss, auf die Bühne kam und sagte, es sei jetzt lange genug über Harry geredet worden und viel zu wenig über mich. Das gefiel den Leuten und hatte etwas Marktwainhaftes, ich glaube, Harry hätte es auch gemocht.«
Ob es Rowohlt mit der Ewigen Wiederkehr und dem endlosen Gehen im Kreis hielt oder ob er annahm, dass man für immer verschwand, das konnte man wohl nicht so genau sagen. In einem Brief an Karl-Otto Saur jedenfalls befindet sich dann doch ein kleiner Hinweis: »Nichts geht verloren, fast jeder Kreis schließt sich.« Als Beweis nennt er die Sonne von Mexico:
»Sogar in der Sonne von Mexico links hinter dem Frankfurter Hauptbahnhof haben wir gesoffen, einer Kneipe für den gehobenen Pennerbedarf, die eines Tages verschwunden war und, wie im ›Fliegenden Wirtshaus‹ von Chesterton, an anderer Stelle wieder auftauchte, im Sandweg, aufs Haar genauso, nur mit einem Hühnerdraht um den Bollerofen, weil es da in der kalten Jahreszeit immer zu häßlichen Verbrennungen gekommen war.«
Die Unsterblichkeit, wenn nicht des Körpers, dann doch wenigstens der Kneipe.
Ich drehte mich um, da hinten lag Hellmuth Karasek, oje. Eilig ging ich davon, die Whiskeyflasche ließ ich liegen.
Am Ende der Teichstraße lag zwischen Douglasien und Ahornbäumen eine Kapelle, dahinter irgendwo der Ohlsdorfer Wasserturm. Auch hier war der Friedhof ausladend, mit viel Platz zwischen den Gräbern. Vereinzelt schlenderten Herren mit grauen Bärten und Profikameras um den Hals durch die Reihen und blickten unschlüssig mal auf ein Eichhörnchen, dann auf eine dicke Hummel, die auf einer seltenen Pflanze saß, und schließlich fotografierten sie doch einen Grabstein aus der Zeit des Nationalsozialismus – die gekreuzten Schwerter vor dem Stahlhelm, das Eichenlaub auf deutschem Marmor.
Hinter dem an der Südallee stehenden Wasserturm ging ich nach links und folgte einem Schild zum »Garten der Frauen«. Auf dem Weg dorthin entdeckte ich das Grab von Fiete und Lissa Claussen, einem Paar, beide 1900 geboren, beide einhundert Jahre später, im Jahr 2000, gestorben. Kurz dachte ich, über etwas gestolpert zu sein, die Jahreszahlen auf dem Grabstein lösten bei mir ein Gefühl der Irritation aus, aber als ich mich am Boden umblickte, war da nichts.
Der Garten der Frauen ist ein über 1600 Quadratmeter großes und vom Rest des Friedhofs durch hüft- bis kopfhohe Hecken abgegrenztes Areal, auf dem an bekannte und wichtige Hamburger Frauen erinnert wird. Ich wurde schnell zu dem Kernstück geführt, der Erinnerungsspirale – einem leicht stilwidrig wirkenden Beton-Zengarten, in dem unterschiedlich geformte Steinklötze einen Kreis bilden. Dort wird an diejenigen Frauen erinnert (wenn sie nicht sogar anonym bestattet wurden), deren Grabsteine bereits vom Friedhof entfernt und zerstört worden sind. Eine Spirale also, die das Verschwinden weiter verschieben soll. Man erinnert sich hier an als Hexen beschuldigte und verbrannte Frauen, an Widerstandskämpferinnen, an die Opfer häuslicher Gewalt, aber auch an die Prinzessin Salme von Oman und Sansibar, die 1866 nach Hamburg floh und dort den Kaufmann Heinrich Ruete heiratete. Ihr eigentliches und in Granit gefasstes Grab lag in der Nähe – und auch sie war Autorin gewesen (Leben im Sultanspalast). Aber »in der Nähe« bedeutete hier nicht »um die Ecke«, also musste ich diesen Besuch verschieben.
Überall im Garten standen alte und vor dem Verschwinden bewahrte Grabsteine bekannter Frauen, aber es gab auch neue Gräber, eins davon war das der Sexarbeiterin Domenica Niehoff: St. Paulis großes Herz, Streetworkerin, Besitzerin der Kneipe Fick (1998–2000) und Autorin von Domenicas Kopfkissenbuch – eine Frau, über die Wolf Wondratschek mal gesagt hat: »Wenn sie mit dem Hintern wackelt, fließen die Flüsse bergauf.«
Wie kann man so was sagen, dachte ich, und warf dem Grabstein der durch die Poesie Wondratscheks missbrauchten Frau einen letzten Blick zu.
Ich drehte mich um, an der Glasscheibe eines kleinen Pavillons wurde auf die baldige Enthüllung einer Gedenktafel für die Maskentänzerin Lavinia Schulz hingewiesen, die, zusammen mit ihrem Mann Walter Holdt, kein Geld für ihre Aufführungen verlangt hatte und deshalb Anfang der zwanziger Jahre beinahe den Hungertod gestorben wäre, hätte sie nicht vorher ihren Mann und dann sich selbst erschossen.
Erschießen und erschießen lassen, der ewige Kreis, die Ewige Wiederkehr auch der Straftaten. Das muss für heute reichen, dachte ich, notierte mir den Termin der Enthüllung und trat den Rückweg an.
In den Abendstunden füllte sich der Friedhof. Fahrradfahrer mit plappernden Kindern im Kindersitz kurvten zwischen letzten Ruhestätten entlang, Autos und Busse fuhren in erhöhtem Takt an mir vorüber: Feierabend!
Ich wählte die verwinkelten und verzweigten Wege zwischen den Paaranlagen, Mausoleen und einem Bereich für anonyme Beisetzungen. Die Sonne stand noch immer hoch und verbrannte die Natur, die von unermüdlichen Grabpflegern vor dem Austrocknen bewahrt werden musste.
Als ich ins Dickicht der schiefen Steine und geschlossenen Laubdecken abtauchte, lagen dort auf einmal, links von mir, zwei Frauen in engen roten Kleidern und mit geschminkten Gesichtern im Gras und schauten mich mit einer Mischung aus Erstaunen und feierlicher Strenge an. Die Lippen tiefrot, sich gegenseitig halb durch Schulterschluss vor mir versteckend, wie in einem impressionistischen Gemälde einer Landpartie.
Ich hustete ihnen ein scheues »Hallo« entgegen und wollte schnell über eine Brücke davongehen, als auf einmal aus den Büschen der gegenüberliegenden Seite ein alter Mann mit Strohhut, grauem Vollbart und Spiegelreflexkamera herausstolperte und ihnen Anweisungen gab.
»Deshalb der laszive Blick«, dachte ich und schlug mir mit der flachen Hand auf die verschwitzte Stirn.
»Nein, Babe«, sagte der alte Fotograf, »Mausi, halloo?! Sooo, genau! Ja – und nicht anders. Bitte, bitte, mach’s einmal so, wie ich’s dir sage!«
Ich wusste nicht, ob ich mich verhört hatte, jedenfalls lachten die zwei Frauen jetzt unentwegt, und ich entschloss mich, nachdem ich schon über die Brücke gegangen war, umzukehren und noch einmal zu schauen und zu fragen, was das denn sollte.
»Entschuldigung«, sagte ich schüchtern, als ich wieder bei ihnen stand. »Darf ich fragen, was Sie hier heute noch so machen?«
»Wir schießen Fotos. Es gibt doch keinen schöneren Ort dafür, oder nicht?«, sagte der alte Fotograf misstrauisch.
»Ja, schon. Aber sind Sie eine Band oder so was?«, wollte ich wissen.
»Nein«, antwortete er genervt, so als hätte ich sie bei etwas wirklich Wichtigem gestört. »Wir kommen auch nicht von hier. Wir machen einen Fotoband.«
Alle drei schüttelten die Köpfe und lächelten gleichzeitig, dabei begannen sich die Frauen im Sitzen umständlich umzuziehen.
»Wir haben uns einfach gefunden, o.k.?«, sagte eine von ihnen, und das war für mich das Signal, den Tatort zu verlassen.
Am Ende riefen sie mir aber doch noch hinterher:
»Viel Glück auf deiner Reise!«
Ich ging zum dritten Mal über die Brücke und wollte nach links abbiegen, als ich dort einen anderen alten Mann sah, mit langen grauen Haaren und Halbglatze. Ich hatte ihn vor etwa einer halben Stunde schon einmal in der Nähe der Teichstraße gesehen. Er stand lang gestreckt da und hob beide Arme hoch in die Luft. In einer Hand hielt er eine Gießkanne, und er redete laut und fordernd auf den Grabstein vor ihm ein. Aber ich war ganz sicher, er befand sich dort alleine.
Entgegen aller Annahmen fand ich schnell zurück zum Fußgängereingang »Kleine Horst«.
Durch den Feierabendverkehr fuhr ich durch Barmbek zurück nach Dulsberg. Die Sonne schien, keine Wolke war am Himmel. Zu Hause setzte ich mich an den Schreibtisch, es war immer noch sehr heiß, und ich trank kalten Pfefferminztee. Niemand hatte von mir Besitz ergriffen.