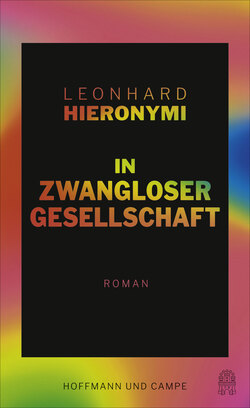Читать книгу In zwangloser Gesellschaft - Leonhard Hieronymi - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 Stechlin
ОглавлениеWenige Tage später fuhren wir an die Oberhavel.
Es hatte in Brandenburg seit Wochen nicht geregnet, und das ganze Land glich einem neumexikanischen Wüstengrab. Von den abgeernteten und ausgedörrten Rapsfeldern stiegen meterhohe Staubwolken auf, die den Horizont verschleierten.
Auf der Autobahn hatte Maria ihre Schuhe in einem Wurm-loch verloren. Sie war in Hamburg noch mit ihren Badeschlappen ins Auto gestiegen, als sie aber an der Raststätte Prignitz hinauskletterte, waren sie nicht mehr aufzufinden, und weil erhöhte Waldbrandgefahr herrschte, musste ich mit meinen Segelschuhen die Zigaretten austreten, die sie am Rand glutheißer Teerbeläge rauchte. Segelschuhe sind zwar die bequemsten Schuhe, die man im Sommer tragen kann, aber meine langen und schmalen Füße sahen darin aus wie weich gekochte Rigatoni in einem Kindersarg.
Wir erreichten Neuglobsow am frühen Abend, legten unser Gepäck im Ferienhaus von Marias Mutter ab und gingen gleich hinunter zum Großen Stechlinsee. Die nassen Köpfe der Badenden glitzerten im Licht wie Wasserspinnen, und der See war ruhig und wartete auf die wasserfärbende Wirkung der noch immer hochstehenden vergilbten Staubsonne. Der See, er war ähnlich wie Fontane ihn in seinem Buch Wanderungen durch die Mark Brandenburg beschrieben hat: »Da lag er vor uns, geheimnisvoll, einem Stummen gleich, den es zu sprechen drängt. Aber die ungelöste Zunge weigert ihm den Dienst, und was er sagen will, bleibt ungesagt.«
Irgendetwas will dieser tiefe See tatsächlich sagen, aber weniger dringend und direkt, als Fontane meint, eher schickt er seine Botschaften durch starke naturbedingte Stimmungsschwankungen an seine Umgebung heraus, er wirkt unberechenbar, unheimlich, tief und finster.
Ich schlug mein Notizbuch auf, in das ich mir mehrere Namen geschrieben hatte: Armin T. Wegner, Lola Landau, Hanns Krause, Lori Ludwig und Theodor Fontane. Alle waren hier Gast gewesen oder hatten in Neuglobsow gelebt, aber Fontane liegt in Berlin-Mitte begraben, Wegner starb in Rom, Landau in Jerusalem und Ludwig in Fürstenberg. Einzig Hanns Krause, ein DDR-Kinderbuchautor, war auch in Neuglobsow gestorben, ihn würde ich in den nächsten zwei Tagen suchen.
Wir befanden uns in einem Ortsteil der Gemeinde Stechlin, kurz vor der mecklenburg-vorpommerschen Grenze. Ein sowohl im Winter als auch im Sommer märchenhafter und bizarrer Ort. Umgeben von Wald hing der See wie ein Kalmar am Rande des aus Ferienhäusern, giftgrün gestrichenen Bungalows und einem alten verfallenden Hotel bestehenden Dorfs. Am anderen Ende des tiefen Sees stachen aus dem Wald heraus stumm die Antennen eines ehemaligen Atomkraftwerks hervor.
Auf der rechten Seite des Ortes wiederum, durch den nur eine lange Straße führte und dessen Wochenendvillen sich an kleinen, wahrscheinlich erst seit kurzem asphaltierten Straßen wie dünne Adern einen Hang hinauf im Wald verloren, lag eine evangelische Kirche – dort wollte ich am nächsten Tag Ausgrabungen betreiben, um Hanns Krause zu finden. Allerdings hatte ich über Krauses Grab keinerlei Informationen und dachte, dass auch seine Bücher in westdeutschen Bibliotheken wohl nicht mehr aufzutreiben waren. Wahrscheinlich lagern und verfaulen sie in Truhen, auf Dachböden, in Pappkisten oder Kellern, dachte ich.
Ob Neuglobsow überhaupt einen Friedhof hatte, wusste ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, aber die Titel der Kinderbücher Hanns Krauses gefielen mir so gut, dass ich ihn unbedingt finden wollte, um zu schauen, in welchem Zustand sich sein Grab befand: Löwenspuren in Knullhausen / Holzdiebe im Jagen 45 / Alibaba und die Hühnerfee / Bärenjagd in Tulpenau / Kein Bett, kein Geld und große Ferien.
Am späten Abend verließen wir die Ufer des Sees und setzten uns in den Garten des Ferienhäuschens am Ortseingang. Aus dem Wald, der am anderen Ende des Gartens begann, tönte ein Käuzchen, und mit der spät einsetzenden Dämmerung kamen scharenweise die Kriebelmücken, als hätte man mit einer Glocke zum Abendbrot geläutet. Die Kriebelmücken stachen uns nicht, sie zerrissen uns die Haut mit Beißzangen, wo sich am nächsten Tag große Blutergüsse bildeten. Zum ersten Mal seit langem rauchte ich wie wild Zigaretten, um sie abzuwehren, dazu trank ich Dosenbier.
Und mit der Nacht kamen auch die Froschkaskaden. Es war ein wildes, durchdringendes und bei der Vorstellung des massenhaften Fortpflanzens fast ekelhaftes Tönen.
Den ganzen nächsten Tag lagen wir am See, aber natürlich ging ich nicht ins Wasser. Ich betrachtete die glatte Oberfläche und die wenigen Badenden. Angeblich waren während des im Herbst 1755 stattgefundenen Erdbebens von Lissabon hier staubende Wasserhosen zwischen den Ufern aufgetaucht, auch hatte das Senkblei bei frühen und ungenauen Messungen den Grund des Sees nicht gefunden. Marias Mutter war ebenfalls mit der Theorie vertraut, die man auch in Fontanes Roman Der Stechlin nachlesen kann: Angeblich ist der See durch unterirdische Kapillare mit einem Vulkan auf einer pazifischen Insel verbunden. Sollte es auf der Pazifikseite einmal zu Ausbrüchen oder Seebeben kommen (wobei man seltsamerweise jedes verheerende Beben mit dem Stechlinsee in Verbindung bringt), lösen sich vom Grund des Sees rote Algen, die an die Oberfläche schwimmen und dem Wasser einen rötlich schimmernden Glanz verpassen, fast so, als würde der See brennen. Dieses Phänomen ist in der dreihundert Einwohner umfassenden Idylle Neuglobsow nur unter dem Namen »der rote Feuerhahn« bekannt.
Zweimal in der Stunde – immer mit Blick auf den See, weil ich Angst hatte, es könnte etwas aus ihm hinaussteigen, während ich ihm den Rücken zuwandte – lief ich zu einem Kiosk in der Nähe und kaufte dort Eis und Bier. In einem Fischrestaurant, das dreihundert Meter durch den Wald am Seeufer lag, aß ich in den Nachmittagsstunden eine nach Fontane getaufte und nur im Stechlinsee beheimatete Stechlin-Maräne (Coregonus fontanae).
Maria lag während meiner Wanderungen durch einen kleinen Teil der Mark Brandenburg stundenlang mit einem knallroten Badebrett im Wasser, also entschuldigte ich mich bei ihr und ging gegen Nachmittag den Ort hinauf zur Kirche. Ich konnte schon von weitem erkennen, dass sie abgeschlossen war, trotzdem ging ich um das Gebäude herum, um es zu untersuchen. Es machte einen leicht maroden Eindruck, an den Fenstern hingen hellgrau und in dicken Schichten Spinnweben, und trotzdem fanden hier anscheinend Gottesdienste statt. Rechts und links vom Kirchenschiff gab es kleine Seitenflügel, die mehr wie Abstellkammern wirkten. Ich schlug mich ein paar Meter hinter ihnen ins Gestrüpp, aber natürlich war da kein Fried- oder Kirchhof.
Ich erinnerte mich an Stephen Kings Roman Friedhof der Kuscheltiere, den mein Vater früher in der Nähe seines Privatklos im Regal stehen hatte. Er hatte dort neben Hunderten ausgelesenen und aufgeweichten Drachenfliegerzeitschriften und Westernromanen gelegen, ein schwarzes Buch ohne Umschlag.
Gleich nachdem ich lesen gelernt hatte, nahm ich es aus dem Regal, weil ich wusste, dass sich mein Vater vor ihm fürchtete und es nicht zu Ende lesen konnte. Ich wollte unbedingt herausfinden, was diesen sonst so furchtlosen Erfinder der Überlaufgarnitur an ein paar Beschreibungen von alten Friedhöfen aus der Ruhe bringen konnte. Er gab mir gegenüber zum ersten Mal in seinem Leben zu, vor etwas Angst zu haben – und dann war es ausgerechnet die Literatur. (Später, als wir alt genug waren für wahren Horror, schilderte er mir und meinem Bruder seine größte Angst: den Voodoo und die lebenden Toten.)
In Kings Roman zieht eine Familie in die tiefen Wälder Neuenglands; Wälder, in denen noch immer Dämonen leben. In der Nähe ihres Hauses liegt ein Tierfriedhof, dahinter versteckt eine alte Begräbnisstätte des indianischen Volks der Mi’kmaq. Dort begräbt der Familienvater nacheinander die überfahrene Katze, den verstorbenen Sohn und die ermordete Frau. Alle kehren zurück ins Leben, nach Erde riechend und mit teuflischem Benehmen.
Der Roman behandelt, wenn man es so will, die Theorie der Ewigen Wiederkehr von Nietzsche. In der Fröhlichen Wissenschaft heißt es:
»Dieses Leben, wie du es jetzt lebst und gelebt hast, wirst du noch einmal und noch unzählige Male leben müssen; und es wird nichts Neues daran sein, sondern jeder Schmerz und jede Lust und jeder Gedanke und Seufzer und alles unsäglich Kleine und Grosse deines Lebens muss dir wiederkommen, und Alles in derselben Reihe und Folge – und ebenso diese Spinne und dieses Mondlicht zwischen den Bäumen, und ebenso dieser Augenblick und ich selber. Die ewige Sanduhr des Daseins wird immer wieder umgedreht – und du mit ihr, Stäubchen vom Staube!«
Ähnliche Gedanken über kreisförmige Labyrinthe und die zyklische Zeit finden sich auch schon bei den Pythagoreern oder David Hume. Und als die Punkband Ramones den Schriftsteller King in den achtziger Jahren in seinem Haus besuchte, damit sie sich gegenseitig die Ehre erweisen konnten, schrieb Dee Dee Ramone innerhalb weniger Minuten den Song »Pet Sematary« mit den Lyrics: »I don’t wanna be buried in a pet cemetery, I don’t want to live my life again.« Dafür, dass dieser Song dann für die Goldene Himbeere als schlechtester Filmsong des Jahres 1989 nominiert wurde, enthält er eine zutiefst traurige Nachricht. Denn die (egal zu welchem Zeitpunkt eines Lebens) gezogene Bilanz, das bisher gelebte Leben nicht noch einmal leben zu wollen – und das nicht mal als Punkrocker –, bedeutet nur, dass mehr als fünfzig Prozent eines Lebens entweder aus Langeweile, Banalitäten und grauen, traurigen Augenblicken voller Scham, Gemeinheit und Elend besteht oder spätestens beim zweiten Mal dann nur noch aus womöglich schmerzender Langeweile bestehen würde. Und wer würde das ganz ernsthaft wollen? Es ist der weiseste Song, den es gibt.
Als ich hinter der Kirche durch das Gestrüpp streifte, schüttelte es mich trotz der Hitze. Hier lag kein Kirchhof, sondern der große Garten des von Fontane beschriebenen Herrenhauses Schloss Stechlin, »ein gelb getünchter Bau mit hohem Dach und zwei Blitzableitern«, der auf den Trümmern eines schon längst verschwundenen, wirklichen Backsteinschlosses, mit Rundtürmen und Schlossgraben, erbaut worden war.
Im Garten lagen dort zwei angebräunte Rentner auf weißen Liegestühlen und sonnten sich. Bevor sie mich sehen konnten, drehte ich mich um und lief zurück zum See.
Nach meiner ergebnislosen Exkursion holte ich Maria ab. Wir gingen durch den Ort und irgendwann zurück ins Ferienhaus.
Später, als draußen die ersten Blitze quer durch den Himmel schossen und ein schweres Hitzegewitter in der Luft lag, legten wir uns schlafen. Drei oder vier übereinanderliegende Unwetterfronten hingen bei vollkommener Windstille stundenlang über dem See. Es regnete nicht, es stürmte nicht, es donnerte nur ununterbrochen, während die Vögel im anbrechenden Morgengrauen gegen das Gewitter anschrien. Dann, nach drei Stunden, begann es langsam zu regnen, und wir schliefen endlich ein.
Am nächsten Morgen lief ich alleine los, um in der Nähe der Bushaltestelle eine kleine Ortsübersicht zu studieren. Der nächste Friedhof lag in Dagow, einem zu Stechlin gehörenden Ortsteil, der nur ein kleines Stück weit den Wald hinunter lag. Nur dort konnte Hanns Krause noch liegen.
Danach weckte ich Maria, und wir gingen los.
Der Friedhof lag abschüssig in einem Hain. Wir öffneten ein Eisengatter und betrachteten die historische Hinweistafel, auf der ich aber Informationen über Hanns Krause nicht ausmachen konnte. Stattdessen gab es wieder nur den Verweis auf Theodor Fontane und seine Beschreibung desselben Friedhofs in den Wanderungen.
Nach hundert Metern durchs Dickicht hielt mich Maria schon erschrocken am Arm fest. Ich schaute in ihre graugrünblauen Augen – sie zeigte auf mein rechtes Schienbein, dort saßen, in aller Seelenruhe und inbrünstig an mir saugend, mehrere Zuckmücken. Ich schlug wie wild auf sie ein und erwischte dabei die langsamste. Ein großer schwarzer Fleck bildete sich sofort da, wo sie mich gestochen hatte.
»Lass uns hier abhauen!«, rief Maria.
Über eine weitere Eingangstür verließen wir fluchtartig den mückenverseuchten Friedhof und wenig später die Ortsgrenze von Dagow.
Am Nachmittag fuhren wir zurück nach Hamburg. Die Mücken hatten auf unseren Armen und Beinen Dutzende dunkelrote Blutergüsse hinterlassen. Über der ganzen Stadt lagen Gewitter. Ich fand nach stundenlanger Recherche heraus, dass Krause mit seiner Frau auf dem Friedhof in Fürstenberg begraben lag, ganz in der Nähe von Neuglobsow.
Ich lehnte mich zurück. Man muss das Scheitern genießen.