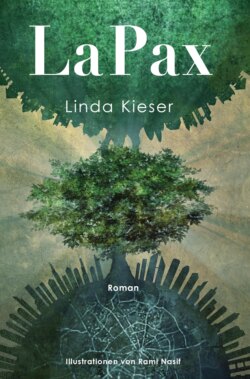Читать книгу LaPax - Linda Kieser - Страница 5
ОглавлениеGroßmutter
»Weißt du, meine liebe Ray, Seven meint es doch nicht böse.« Die Großmutter setzte sich auf Rays Bett, die ihren Kopf in den Kissen vergraben hatte. »Er macht sich Sorgen um uns alle. Seit euer Vater fort ist, hat er als der Älteste immer mehr Verantwortung übernommen.«
Ray schluchzte. »Aber immer hackt er auf mir herum!«
Großmutter schüttelte den Kopf. »Er wollte dir seine Wasserration überlassen, obwohl er selbst den ganzen Tag in der Sortierfabrik gearbeitet hat«, wendete sie ein.
Ungläubig schaute Ray auf. »Ehrlich? Und ich dachte, er wäre bloß sauer auf mich.«
»Nein, er hat dich sehr lieb.«
»Woher weißt du das?«
»Ich weiß es,« sagte die Oma leise und streichelte über Rays Kopf, »weil ich es fühlen kann. Wir dürfen nie aufhören, Gefühle füreinander zu haben. Sonst werden wir wie die Assistenten.«
Da senkte Ray wieder den Kopf und gestand: »Heute wollte ich am liebsten nur eine Nummer im System sein. Ich wollte nichts mehr fühlen, nur einfach arbeiten und fertig! Ich habe gedacht, gar keine Gefühle mehr zu haben wäre doch besser als neben den wenigen guten Gefühlen so oft schlechte Gefühle haben zu müssen.«
»Ja, das ist es, was sie mit dir machen. Sie lassen dich für sie schuften, bis du genauso gefühllos und kalt wirst, wie sie es sind. Nur so kann Nummer 1 seine Überwacher und Assistenten ausbilden und kontrollieren.« Die Großmutter nahm ihre Enkelin in den Arm. »Aber weißt du, trotz vieler schlechter Gefühle in diesem Leben haben wir einander und erleben doch auch viele schöne Momente zusammen, die die anderen Nummern nicht kennen. Das ist doch kostbar in dieser Welt, oder nicht?«
Ray nickte zögerlich. »Oma, woher weißt du eigentlich all diese Dinge über das System?«
»Ich weiß es nicht wirklich auf die Weise, wie sie Dinge wissen, aber mein ganzes Leben lang hat sich für mich der Eindruck erhärtet, dass es tatsächlich so ist. Ich beobachte die Veränderungen schon seit ich eine junge Frau war.« Und mehr zu sich selbst flüsterte sie weiter: »Damals hätte ich noch die neue Welt suchen können. Jetzt bin ich zu alt.«
Da richtete Ray sich schlagartig auf, sagte: »Du und alt? Du bist doch voll fit!«, und schlang ihre Arme um die Großmutter.
Diese lächelte und sagte mit einem Augenzwinkern: »Nun ja, es gibt ein altes Sprichwort, das meine eigene Oma mir immer gesagt hat, als sie älter wurde. Das heißt: Die Hoffnung stirbt zuletzt.«
Irritiert sah Ray in das faltige Gesicht der alten Frau. »Was ist das eigentlich genau: Hoffnung? So etwas hast du vorhin schon gesagt, als ich nach Hause gekommen bin.«
»Wenn ich es richtig verstanden habe, heißt Hoffnung, dass man das Gefühl hat, die Zukunft wird irgendwie besser werden als die Gegenwart. Vielleicht täusche ich mich auch. Aber ich will einfach glauben, dass für euch eines Tages alles besser wird.«
»Und wie soll das gehen?« fragte Seven, der gerade zur Tür hereingekommen war. Er deutete hinunter ins Wohnzimmer. »Mini ist unten auf dem Sofa eingeschlafen.« Und zu Ray gewandt fuhr er fort: »Ray, ich, … es tut mir leid, dass ich dich vorhin so angegiftet habe. Ich habe dich auf dem Feld gesehen und habe mich so hilflos gefühlt. Ich konnte dir nicht helfen und da bin ich wütend auf mich selbst geworden und habe es an dir rausgelassen. Das tut mir leid.« Ray zögerte einen Moment und schaute ihre Oma an, die ihr aufmunternd zunickte.
»Hey, ich bin fast 13 und brauche keinen Aufpasser mehr, klar?«, sagte sie störrisch zu beiden. »Aber …«, sie blickte zu ihrem Bruder, der sie mit seinen großen braunen Augen unsicher ansah und zum ersten Mal fiel ihr auf, wie viel Ähnlichkeit er mit ihrem Vater hatte. »Entschuldigung angenommen.« Da stand sie auf und nahm Seven in den Arm. Er war wirklich ganz schön stark geworden, seit er auf der Sortierstation arbeitete.
»Seht ihr,« sagte die Oma, »deshalb habe ich Hoffnung für euch. Ihr kennt eine andere Art zu leben als die Assistenten, Überwacher und die zahllosen Nummern des Systems. Und ihr werdet sicher euer Leben lang nach diesem Leben suchen.«
»Ist Papa deshalb weggegangen, weil er ein besseres Leben suchen wollte?« fragte Ray.
»Ich weiß es nicht sicher, aber ich fürchte mein Sohn ist fortgegangen, weil er ein Leben mit weniger Gegenwind haben wollte. Diese Hoffnung kann das System bis zur Perfektion erfüllen, wenn man sich an ihre Spielregeln hält.«
Die Trauer über den Verlust ihres einzigen Sohnes war der alten Frau ins Gesicht geschrieben.
Die drei schwiegen eine Weile, dann sagte Ray: »So, jetzt raus aus meinem Zimmer. Ich muss schlafen, damit ich morgen mein Pensum schaffe und nicht wieder irgendeine Babyface-Nummer daherkommt und mich übers Ohr haut.«
»Gute Einstellung, Schwesterherz!«, meinte Seven zustimmend und fügte, zur Großmutter gewandt, hinzu: »Und ich trage Mini ins Bett.«
»Alles klar, gute Nacht ihr beiden!«, antwortete die Großmutter und machte sich auf den Weg in ihr Schlafzimmer.
Sie fühlte sich schwach. Ihre Knie machten ihr jeden Tag mehr Sorgen und Seven hatte Recht, dass sie zu wenig trank. Nur selten musste sie überhaupt noch Wasser lassen und dann brannte es und roch nach faulen Eiern. Sie wusste, dass dies nichts Gutes bedeuten konnte, aber sie musste durchhalten – für die Kinder. Sie hatte nun schon so lange für die Familie gekämpft und glaubte noch immer fest daran, dass es einen Ausweg aus dem System gab. Ein Wort drängte sich in ihre Gedanken.
»Clara.« Der Name bedeutete ihr viel. Es war dieser Name, der sie an einer Hoffnung auf eine bessere Zukunft festhalten ließ. Eine merkwürdige Begegnung mit einem noch merkwürdigeren Mann in ihrer Jugend hatte dazu geführt, dass sie sich selbst seitdem gerne so nannte. Sie war gerade bei der Arbeit auf dem Feld gewesen, da war ihr ein zerlottert gekleideter Mann ohne Nummer aufgefallen, der über das Feld gehumpelt kam.
»Hallo Clara«, hatte er ihr zugerufen und fragend hatte sie sich umgeschaut, um zu sehen, mit wem er redete. Aber alle anderen jungen Arbeiter hatten sich immer absichtlich von ihr fern gehalten, da sie ja eine Natürliche war. Da war sonst niemand gewesen, den er gemeint haben konnte.
»Ja, dich meine ich. Ich will dir was sagen.« Der etwas unheimliche Typ mit den zerzausten Haaren und der schmutzigen Kleidung hatte sie zu sich gewunken. Zögernd war sie näher getreten. Der Mann hatte ihr merkwürdige, aber faszinierende Dinge von einer besonderen Stadt erzählt, in der alle Menschen lustige, bunte Kleidung trugen und fröhlich waren.
»Wo soll denn diese geheimnisvolle Stadt sein?«, hatte sie ihn damals zweifelnd gefragt.
»Sie ist nicht fern von den Menschen, aber sie ist von den Systemstädten aus nur schwer zu erreichen«, hatte der Mann rätselhaft geantwortet. »Ich glaube, ich war schon mal dort, aber ich erinnere mich nicht mehr, wo sie ist.« Dann hatte er noch mit einem besonderen Glanz in den Augen etwas von Liebe und Hoffnung erzählt, das sie sich als junges Mädchen nur schwer hatte merken können. Trotzdem hatte sie diese Worte in ihrem Herzen behalten.
»Liebe. Hoffnung«, murmelte sie leise vor sich hin, während sie versuchte sich an Einzelheiten aus dem Gespräch von damals zu erinnern.
Je älter sie wurde, desto wichtiger schienen Clara diese Begriffe zu werden. Allerdings hatte sie nie verstanden, warum der Mann sie so genannt hatte und irgendwann hatte sie nicht mehr an die Begebenheit gedacht. Erst einige Jahre später traf sie erneut auf eine rätselhafte Person. Es war eine Frau, die ausgesprochen geheimnisvoll in der Wäscherei auftrat. Sie war auf alle Nummern zugegangen und hatte nur das eine Wort »Hoffnung« in ihre Ohren geflüstert. Die meisten hatten sie angewidert zur Seite geschoben, doch Großmutter hatte sie mit großen Augen angeschaut. Sie hatte vor kurzem ein Baby bekommen, einen kleinen Jungen, und auf einmal hatte sie gespürt, was Hoffnung war: Dieser Junge sollte es einmal besser haben als sie selbst.
Doch die Frau hatte nur noch gesagt: »Lass sie nicht sterben.« Dann war sie von den Überwachern aufgegriffen und weggeschleppt worden.
Die sonderbaren Begegnungen mit den Fremden hatten in Clara einen Wunsch geweckt. Sie wollte unbedingt diese Stadt finden. Sie selbst würde jedoch nicht mehr auf die Suche gehen können, denn sie spürte, dass sie nicht mehr allzu lange Zeit zu leben hätte. Die Strapazen einer Reise würde sie mit ihrem Knie ohnehin nicht überstehen. Vielleicht konnten ihre Enkelkinder die Stadt für sie finden.
Clara seufzte und sah aus dem Fenster. Der Mond nahm gerade zu und erhellte die angebrochene Nacht. Ma würde jetzt sicher nicht mehr nach Hause kommen.
Als ihr Sohn sich vor etwa 17 Jahren in sie verliebt hatte, war sie überglücklich gewesen. Er hatte erleben dürfen, was Liebe bedeutet. Natürlich hatte jeder Mensch im System Empfindungen wie Hunger und Durst. Auch Sex wollten die Menschen noch, aber der wurde nur über den Bildschirm bestellt. Kaum jemand, der im System lebte, kannte die Liebe noch. Sie war laut Propaganda in der fortschrittlichen Welt des Systems nicht mehr nötig, um die Menschen glücklich zu machen. Genau genommen gab es fast niemanden mehr, der überhaupt das Wort Liebe noch kannte. Schon lange war es aus dem Grundwortschatz in den Kinderhäusern gestrichen worden. Für die Fortpflanzung sorgten die Kliniken in ihren Hochsicherheitstrakten, wo sie ideale Genkombinationen paarten und die entstandenen Kinder bis zum Alter von 3 Jahren aufzogen. Danach kamen die kleinen Nummern in die Kinderhäuser, wo besonders ausgebildete und systemtreue Assistenten für die Aufzucht sorgten. Die Arbeiter sollten wahrscheinlich nicht den typischen Kinderfragen ausgesetzt werden, wie: »Warum gibt es eigentlich die Nummern?« oder »Warum passt jede Woche jemand anders auf uns auf?«
Die alte Frau kannte ähnliche Fragen von ihren eigenen Enkelkindern. Sie konnte sich gut vorstellen, wie die Assistenten in den Kinderhäusern ihre immer gleichen Antworten abspulten, bis die Kinder selbst überzeugt waren, nur so sei ihr Leben normal, wie es ihnen vom System verkauft wurde. Anders konnte sie sich nicht erklären, dass sie im Dorf kaum mehr Menschen begegnete, die den Eindruck machten, als könnten sie überhaupt noch selber denken. Das System schien es immer besser zu schaffen, alle Menschen im Griff zu haben. Hauptsache die Menschen hatten eine Beschäftigung und genügend Nährstoffe, dann waren sie zufrieden.
Das einzige Problem des Systems war das Wasser. In ihrer Gegend gab es gerade noch genügend, um die Kartoffelfelder zu bewirtschaften, die den Grundstoff für all die Stärkeprodukte stellten, die in der Stadt produziert wurden. Da gab es eine Fabrik für irgendeine Tablettenherstellung, eine Fabrik für Kartonagen, eine Fabrik für Kunststoff-Verpackungen und vieles mehr. Das Wasser in der Gegend war zwar so stark verunreinigt, dass die Menschen es nicht mehr trinken konnten, für die Bewässerung der Felder wurde es jedoch noch genutzt und für die Zwecke der verschiedenen Fabriken wurde es notfalls chemisch gereinigt. Clara wusste von Ma außerdem, dass das Wasser, welches zum Auswaschen der Stärke aus den Kartoffeln gebraucht wurde, später mit großen Mengen chemischen Düngers angereichert und wieder auf die Felder zurückgeleitet wurde.
»Zum Glück tragen die Jugendlichen bei der Arbeit Handschuhe«, dachte die alte Frau und sah in Gedanken, wie Ray auf dem Feld schwitzte.
Im ganzen System herrschte Wasserknappheit. Es regnete nur vier- bis fünfmal im Jahr und das reichte kaum, um alle ausreichend zu versorgen. Auch deshalb wollte das System unbedingte Geburtenkontrolle. Da machten die Natürlichen ihnen einen gewissen Strich durch die Rechnung, aber ihre Zahl wurde immer unbedeutender. Trotzdem – oder gerade deshalb – wurden sie überall angefeindet und unterdrückt, bis sich die meisten von ihrer alten Heimat trennten und in das System einfügten.
Als Clara sich auf ihr Bett setzte, stöhnte sie vor Schmerz leise auf. Sie rieb sich das Bein. Vor Jahren hatte das Systemkrankenhaus eine ihrer großartigen Knieoperationen an ihr durchgeführt. Sie hatte dieses Krankenhaus gehasst. Zum ersten Mal in ihrem Leben hatte sie erfahren, wie es war, wirklich nur eine Nummer im System zu sein. Sie hatte Angst, doch niemand hatte sie wirklich als Person gesehen. Mit einem Arzt hatte sie nie gesprochen. Nur ein Assistent hatte ihr den Mikro-Chip mit allen wichtigen Informationen überreicht. Zusammen mit etwa 20 anderen war sie auf eine Liege geschnallt und betäubt worden. So weit sie wusste, wurden solche Routine-Operationen am Fließband durchgeführt. Aber darüber hatte sie damals nicht nachdenken wollen. Natürlich hatten sie sie perfekt medizinisch behandelt. Vor allem für seine Mediziner liebten die Menschen ja das System. Sie hatte bereits zwei Tage nach der OP wieder normal und schmerzfrei gehen können. Es war kaum zu fassen gewesen und alle hatten sich gefreut. Aber seit etwa einem Jahr spürte sie mehr und mehr, dass sie nicht mehr ihre eigenen Knie hatte, und die Schmerzen wurden von Woche zu Woche schlimmer. Sie hatte das System im Verdacht, die Operationen gerade so gut auszuführen, dass die Menschen damit nicht unnötig alt würden oder im Alter noch mehr vom System abhängig sein sollten. Im kleinen Altenhaus des Dorfes lebten schon jetzt nur noch zwei oder drei Leute, die wie sie selbst bereits deutlich über 80 waren. Alle anderen waren gerade mal 70 und hatten erst vor kurzem aufgehört zu arbeiten. Wenigstens mussten die nicht mehr alle zwei Monate umziehen, sondern blieben normalerweise ein bis zwei Jahre im selben Altenhaus. Manche konnten es sich sogar leisten, sich auf Reisen zu begeben, wenn sie sich im System verdient gemacht hatten. Sterben tat allerdings fast nie jemand im Dorf. Bevor es so weit war, wurden die Nummern weggebracht. Keiner wusste wohin, aber es interessierte auch niemanden.
»Gerade im Älterwerden sollen die Menschen abhängig vom System bleiben, um ihre Systemtreue zu festigen. Ob sie mich auch abholen werden, wenn sie mitkriegen, wie krank ich schon bin?«, dachte sie gerade, als der Nachrichtensender auf ihrem Zimmerbildschirm sie aus ihren Gedanken riss.
»…ein neues Gesetz auf den Weg gebracht, das es den Natürlichen erleichtern soll, sich im System zurechtzufinden.«
»Welche Teufelei haben sie jetzt wieder vor?«, fragte sie sich, plötzlich hellwach. Normalerweise liefen die Propaganda-Nachrichten immer, ohne dass überhaupt jemand so recht Notiz davon nahm. Die Großmutter hatte alle Bildschirme in den Zimmern bereits eingeschaltet, bevor sie mit Ray gesprochen hatte, denn jeder Bewohner musste seinen eigenen Bildschirm haben und war verpflichtet, den Sender eine Stunde täglich zu sehen. Die meisten Nummern besaßen tragbare Bildschirme und verbrachten ohnehin die meiste Zeit des Tages damit, daran zu spielen, Filme zu sehen und Musik zu hören. Dass sie damit laufend Propaganda-Informationen in verschiedener Form eingetrichtert bekamen, störte niemanden, denn es war keinem bewusst.
»Das System weiß ja nicht, dass wir nicht vor dem Bildschirm sitzen, sondern in der Küche miteinander spielen«, hatte Großmutter jahrelang die Familie beruhigt.
Aber diese aktuelle Nachricht schreckte sie aus ihren Gedanken hoch. Der Assistent auf dem Bildschirm teilte die erschütternde Neuigkeit genauso tonlos mit, als wäre bei der Vitaminherstellung ein Übermaß an Vitamin C festgestellt worden.
»Im Interview erklärte Nummer 1 heute Nachmittag, dass dieser Schritt notwendig geworden sei, um die Natürlichen besser im System zu integrieren. Das völlig veraltete Gesetz zur Bestandserhaltung von baufälligen Wohnanlagen der Natürlichen sei heute nicht mehr tragbar und gefährde nur unnötig deren Bewohner.«
»Ja, weil wir ja auch nichts renovieren dürfen!«, entfuhr der schockierten Großmutter ein aufgebrachter Schrei. Erschüttert saß sie am Bildschirm, als Seven bei ihr hereinplatzte. Er hatte schon seinen Schlafanzug an und denselben entsetzten Gesichtsausdruck wie seine Oma.
»Hast du …?«, fing er an.
»Ja, ich hab es auch eben gehört«, unterbrach sie ihn. »Der Gegenwind, vor dem euer Vater schon Angst hatte, wird stärker.«
Ray lag in ihrem Bett und schaltete den Bildschirm aus. Ihre Stunde war nun auch vorüber. Was würde aus ihrer Familie werden, wenn sie alle in ihre eigenen Gruppenhäuser ziehen mussten? Wenn sie Glück hatte, könnte sie mit Seven zusammenbleiben. Sie waren fast gleich alt. Allerdings würde das sicher nicht lange so gehen, da sie ja auch ständig würden umziehen müssen. Großmutter müsste natürlich in ein Altenhaus. Mini würden sie sicher ins Kinderhaus bringen, wo er jetzt schon jeden Vormittag hin musste. Vielleicht wäre es doch besser gewesen, ihn gleich ganz ins System zu integrieren. Dann würde ihn das alles nicht so betreffen. Aber Großmutter wollte unbedingt für ihn sorgen, als er noch ein Baby war, so wie sie für Seven und Ray gesorgt hatte. Ohne Oma hätten sie nie alle zusammen wohnen dürfen. Wahrscheinlich hätten sie sich sogar nicht einmal kennengelernt. Das System legte Wert darauf, dass die Natürlichen nach Möglichkeit an unterschiedlichen Orten aufwuchsen, damit sie besser integriert werden konnten. Dagegen hatte Oma sich immer gesträubt. Aber nun hing Mini so sehr an der Familie. Was wäre, wenn er plötzlich alleine wäre? Er würde sie alle so sehr vermissen, dass sein kleines Herz brechen würde. Niemand würde ihn mehr Miniseven nennen. Er wäre nur noch der Junge mit der Nummer MI771771N. Nicht einmal Mama könnte er mehr sehen, da sie dann ja auch an ihrer Arbeitsstelle wohnen müsste. Apropos Mama? Mama war immer noch nicht von der Arbeit zurückgekommen. Das machte Ray mehr aus, als sie zugeben wollte.