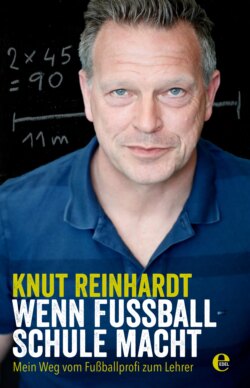Читать книгу Wenn Fußball Schule macht - Lisa Bitzer - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Von einem, der auszog,
das Spielen zu lernen
ОглавлениеObwohl Fußball ein absoluter Breitensport ist und es viele Menschen gibt, die eine Karriere in diesem Sport anstreben, schaffen es nur ganz wenige bis nach oben, also in den sichtbaren Bereich. Als „Schallmauer“ gelten zehn bis zwölf Jahre als Profi beziehungsweise dreihundert Pflichtspiele im Lauf der aktiven Karriere (ich hatte übrigens 297 in der Bundesliga). Man kann es ein bisschen mit einem Eisberg vergleichen, der eine schmale Spitze über der Meeresoberfläche und eine riesige unsichtbare Basis unter Wasser hat.
Aber was ist mit all den anderen Spielern? Denen in der Zweiten und Dritten Bundesliga? Den Regional- und Oberligen? Auch diese Spieler verbringen Stunden, Tage, Jahre ihres Lebens auf dem Fußballfeld und opfern eine beachtliche Zeit für Training und Spiele, ohne jemals einen nennenswerten Bekanntheitsgrad zu erlangen oder das „Schmerzensgeld“ zu erhalten, das die wenigen verdienen, die es in die Erste Liga schaffen. Und dabei hat Fußball diesen besonderen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie viel Leidenschaft und Energie man aufbringen muss, um in einer weniger populären Sportart wie Handball, Biathlon oder Leichtathletik auf einen grünen Zweig zu kommen – zudem in diesen Sportarten auch noch viel niedrigere Honorare gezahlt werden und die meisten Sportler am Ende mit einer Nullrechnung rauskommen.
Warum ist das im Fußball anders? Warum kann ein Fußballer, wenn er etwas Glück hatte und sein Geld gut angelegt hat, auch später noch von seinen Erfolgen zehren, während ein Skispringer vermutlich seinen Sport ausüben muss, ohne erwähnenswerte Ersparnisse zu erwirtschaften? Es liegt an der besonderen Faszination, die der Fußball auf viele Menschen ausübt. Er ist alltäglich und überall – in jedem noch so kleinen Kaff gibt es einen Fußballverein. Außerdem kann Fußball ohne besondere Ausrüstung von so gut wie jedem gespielt werden. In Afrika habe ich zum Beispiel schon Kinder gesehen, die sich aus alten Lumpen einen Ball zusammenbanden und damit stundenlang barfuß kickten. Es braucht außerdem keine besonderen Fähigkeiten, um das Spielgerät in Bewegung zu setzen, denn gegen etwas treten, damit es nach vorn fliegt, schafft in der Regel jeder (zumindest nach ein paar Versuchen). Das Spiel funktioniert nach einem einfachen Prinzip und ist viel leichter zu begreifen als zum Beispiel Football oder Baseball. Und nicht zuletzt spricht der Teamgedanke viele Zuschauer und Spieler an, mehr als so manche Individualsportart. Darüber hinaus ist der Fußball durch seine Popularität medial viel präsenter als andere Disziplinen.
Für mich stellt den größten Reiz des Fußballs dar, dass das Spiel zu jedem Zeitpunkt umschlagen kann. Und dass es keine Elitesportart ist. Theoretisch hat jeder, der die nötige Begabung und Ausdauer mitbringt, die Chance, Teil der großen Maschine „Fußball“ zu werden – wenn vielleicht auch nicht auf Profiniveau. Von den fünf Blondies, die damals vom TuS Quettingen zu Bayer Leverkusen wechselten, schaffte es trotz Begabung und Möglichkeit letztlich nur einer, seinen Traum von der Profikarriere als Fußballer zu verwirklichen: ich. Auf dem Weg zur Spitze gehen einfach unglaublich viele Talente verloren.
Und auch bei mir war keineswegs von Anfang an klar, dass ich es in die Erste Bundesliga schaffen würde. Trotzdem bekam ich meine Chance – heute wäre das vermutlich nicht mehr so. Denn in Zeiten, in denen der Leistungsdruck in diesem Bereich so hoch ist, hat ein junger Spieler nicht viel Gelegenheit, den Ansprüchen des Vereins gerecht zu werden. Zweimal jährlich findet ein besonderes Training statt, in dem die Kinder vor Trainern und Vereinsleuten antanzen müssen, um ihre Entwicklungen zu präsentieren. Und wenn es keine Entwicklung gibt? Tja, dann ist die Karriere eben schnell wieder vorbei.
Und die Kinder? Die werfen dann oft alles hin, weil sie frustriert und verletzt sind. Denn für einen Sechs-, Acht- oder auch Zwölfjährigen ist es nicht nachvollziehbar, warum er erst gefördert und plötzlich fallengelassen wird. Er spielt Fußball, weil er den Sport liebt. Vielleicht träumt er insgeheim von einem Leben als Profi, aber in dem Alter ist man ja noch gar nicht in der Lage, das Ausmaß seines Traums, die Schmerzen auf dem Weg zur Umsetzung, die Niederlagen, Rückschläge und Krisen, die einem unweigerlich bevorstehen, zu überblicken. Und auch nicht, welche Opfer man bringen muss, wenn man das lebt, wovon andere träumen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass einige Kinder, wenn sie einmal eine solche mentale Schlappe einstecken müssen, etwa weil sie es nicht in die A-Mannschaft geschafft haben oder zukünftig nicht mehr so gefördert werden wie in den vergangenen Jahren, dem Fußball den Rücken zukehren und im schlimmsten Fall sogar ganz mit dem Sport aufhören.
Ich finde sehr bedauerlich, dass etwas, was vor allem Spaß machen soll, so frustrierend und demotivierend wird, dass es zu einer totalen Verweigerung führt. Im Grunde ist es mit dem Lernen in der Schule vergleichbar. Jedes Kind, das in der Schule ankommt, will lernen. Kinder sind wie trockene Schwämme, die begierig alles Wissen aufsaugen wollen, das ihnen begegnet. Es gibt keine demotivierten und lernfaulen Erstklässler. Das „lernen“ sie erst in der Schule. Aufgabe eines guten Pädagogen ist es, diese grundsätzliche Lust am Lernen so lange und intensiv wie möglich zu fördern.
In meiner Karriere ist mir nur eine einzige Schülerin untergekommen, bei der ich nach einer gewissen Zeit kapitulieren musste. Romina war vor ein paar Jahren in meiner Klasse und zeigte keinerlei Interesse für irgendetwas, das mit der Schule zu tun hatte, egal ob ich es ihr mit Strenge, mit Humor oder mit einer in Aussicht gestellten Belohnung präsentierte. Sie saß schlicht und ergreifend ihre Zeit ab – und das in der dritten Klasse. Dass sie auch keinerlei Interesse an ihren Mitschülern zeigte, machte die Sache nicht unbedingt besser. Eigentlich wollte sie nur eines: Am Nachmittag in die Stadt und zu der großen irischen Kette mit den Billigklamotten gehen, um für einen Euro ein Kleidungsstück zu kaufen, dass sie einen Tag später schon wieder vergessen hatte. Es ist tragisch, aber ein Mädchen wie Romina wird (und das konnte ich damals schon sagen, obwohl sie erst elf Jahre alt war) vermutlich keinen Schulabschluss machen. Mit etwas Glück wird sie vielleicht irgendwann einen Aushilfsjob ergattern. Doch ein respektierter Teil dieser Gesellschaft wird sie mit großer Wahrscheinlichkeit niemals werden.
Romina ist ein Einzelfall – und doch überrascht es vermutlich nicht, wenn ich verrate, dass sie nicht gut Deutsch spricht und kaum lesen und schreiben kann. Selbstverständlich ist sie nicht die Einzige, die Probleme mit der deutschen Sprache hat. Man darf nicht vergessen, dass für viele meiner Schüler Deutsch die zweite Muttersprache ist – oder erste Fremdsprache. Dass Kinder innerhalb so kurzer Zeit in der Lage sind, sich in einer ihnen fremden Sprache auszudrücken, erstaunt und überrascht mich jedes Mal wieder aufs Neue. Schwierig ist für die meisten nicht, einzelne Wörter zu erlernen, sondern ganze Sätze mit richtiger Syntax zu bilden oder eine Geschichte aufzuschreiben. Ein bisschen ist auch das mit dem Fußball vergleichbar: Du kannst die besten Freistöße im Training schießen, beim Spiel kommen Faktoren dazu, die du nicht absehen kannst und schon vergeigst du einen Schuss nach dem anderen. Wichtig ist in diesem Fall, dass die Kinder (und Kicker) weiter motiviert werden, damit sie die Sache nicht irgendwann an den Nagel hängen.
Hätten in meiner fußballerischen Karriere die Maßstäbe gegolten, die heute an die jungen Spieler angelegt werden, wäre ich vielleicht niemals Fußballer geworden. Die Sportfrühförderung hat sich in den vergangenen Jahrzehnten sehr professionalisiert und ist mit den Zuständen von damals nicht mehr vergleichbar. Und das hat nicht nur mit den Sportinternaten zu tun, die nach wie vor aus dem Boden schießen, sondern auch mit dem Förderungssystem, das dahintersteckt. Während früher ein Trainer mit seinem Assistenten die komplette sportliche Verantwortung zu tragen hatte, fahren heutzutage mehr Stab-Mitarbeiter als Spieler ins Trainingslager des Hamburger SV.
Das Perfide bei Sportinternaten und Co. ist: Da die Gehälter der Spieler immer astronomischer werden (und diese Gehälter ja nicht nur an die Spieler gehen, sondern anteilig auch an Vereine, Spielerberater, Manager und andere), ist es gar nicht notwendig, besonders viele neue Talente auf den Markt zu bringen. Es genügt schon alle drei bis vier Jahre ein Junge aus Nairobi oder Rio de Janeiro, der den Sprung auf die internationale Bühne schafft, und schon rentiert sich die Investition. Dass dabei viele andere auf der Strecke bleiben, wird billigend in Kauf genommen.
Tatsächlich war ich einer der wenigen aus meinem Umfeld, dem es gelang, sich von ganz unten bis nach ganz oben durchzuarbeiten – und das ohne Sportinternat und Spielerberater. Die meisten meiner Mitspieler mussten entweder verletzungsbedingt aufgeben oder verloren in der Pubertät den Spaß am Sport. Und auch ich hatte eine Phase in meinem Leben, in dem ich mir nicht mehr sicher war, ob ich mit dem Fußball aufs richtige Pferd gesetzt hatte.
In der Pubertät war ich nicht gerade ein Frühentwickler. Außerdem war ich, im April geboren, in meiner Altersklasse einer der Jüngsten. Stichtag war damals nämlich der 1. August, was bedeutet, dass ich zum Teil gegen Jungen spielte, die neun Monate älter und körperlich viel weiter entwickelt waren als ich. Oft konnte ich mich gegen die Stärkeren und Größeren nicht durchsetzen und war frustriert. In Leverkusen kickte ich seinerzeit in der dritten Jugendmannschaft und war Balljunge bei den Bundesliga-Spielen, konnte aber keinen rechten Stich gegen die anderen machen. Meine körperliche Unterlegenheit sorgte dafür, dass ich zum allerersten Mal in meinem Leben darüber nachdachte, Fußball vielleicht doch sein zu lassen.
Das lag aber nicht nur an meinem schmächtigen Körperbau, sondern auch an meinem Charakter. Heute würde ich sagen, dass ich damals ein Weichei war: weinerlich, sensibel, ängstlich. Ich war ein guter Fußballer, aber mir fehlte die geistige Konstitution, mich mit den anderen zu messen. Doch dann, als ich etwa fünfzehn war, geschah etwas, was nicht nur mich, sondern auch meine weitere Karriere maßgeblich beeinflusste. Ich bekam nämlich einen neuen Trainer in der B-Jugendmannschaft und das war ein richtig harter Knochen. Der nahm kein Blatt vor den Mund und war zum Teil richtiggehend beleidigend. „Ihr seid Jammerlappen!“, schrie er uns manchmal von seinem Platz aus zu. „Stellt euch mal nicht so an!“
Zuerst war ich geschockt. Die Lust auf den Sport war mir sowieso schon vergangen, weil ich in physischen Auseinandersetzungen auf dem Rasen alle naselang den Kürzeren zog. Und jetzt sollte ich mich auch noch anbrüllen lassen? Nein, das war nicht das, was ich wollte. Und dennoch ließ ich mich nicht unterkriegen und nahm mir vor, mir das Ganze zumindest ein paar Wochen anzuschauen, bevor ich das Handtuch warf. Jeder reagiert ja anders auf solche brachialen Methoden, die einen verweigern sich komplett, die anderen stacheln sie an. Und siehe da: Mich motivierte die Strenge des Trainers (auch wenn er sich von Zeit zu Zeit doch im Ton vergriff).
Plötzlich bemerkte ich, dass sich etwas in mir veränderte. Zuerst war es meine Einstellung. Ich wurde härter, bissiger, ging den Konfrontationen nicht mehr aus dem Weg, sondern suchte sie. Das blieb nicht ohne Konsequenzen. Denn je aggressiver ich auf dem Platz agierte, desto mehr konnte ich mich behaupten.
Ein Schlüsselerlebnis war, als ich in einem Spiel eine besonders harte Grätsche ansetzte. Eigentlich war ich eher der feine Mittelfeldspieler, der nicht besonders körperbetont auf dem Platz agierte, sondern die Gegner auszudribbeln versuchte. Ich stand auf dem Rasen und sah, dass einer der Gegenspieler mit dem Ball ab durch die Mitte wollte. Also jagte ich ihm hinterher. Normalerweise hätte ich versucht, zu ihm aufzuschließen und ihm möglichst elegant den Ball abzuluchsen. Diesmal aber tat ich etwas, was ich vorher noch nie in der Form getan hatte: Ich mähte ihn einfach um. Glücklicherweise traf ich nicht nur seine Beine, sondern auch den Ball. Ansonsten wäre das ein Fall für einen Platzverweis gewesen. So aber hatte ich Glück, konnte den Ball sichern und in die andere Richtung aufs gegnerische Tor davonrennen. Ein Zweikampf, der mich stärker machte.
Parallel zu diesem Erfolgserlebnis begann sich mein Körper zu verändern. Neben dem Fußballtraining war ich als Einziger meiner Mannschaft dreimal die Woche bei den Leichtathleten von Bayer Leverkusen, um meine Schnelligkeit zu verbessern. Ich spürte im Verlauf weniger Wochen, wie meine Muskeln merklich wuchsen, ich immer fitter und athletischer wurde und auch meine körperliche Präsenz davon profitiere. Innerhalb eines Jahres verwandelte ich mich vom eher schmächtigen Mittelfeldspieler zur Walze mit enormem Kraftpotenzial. Das wiederum ließ mein Selbstbewusstsein explodieren, denn mit einem Mal waren Zweikämpfe für mich keine Schreckensvorstellung mehr, sondern Möglichkeiten, meine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und mich zu messen. Ich arbeitete hart an mir und der Erfolg stellte sich beinahe automatisch ein – ein wunderbares Gefühl.
Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich ganz unmittelbar erlebte, welche Auswirkungen echte Initiative haben kann. Indem ich Zeit und Energie in meine Weiterentwicklung investierte, freiwillig zu Sondereinheiten mit den Leichtathleten kam, wurde ich besser und spürte die Auswirkungen beinahe sofort. Obwohl es hart war – fünfmal die Woche Fußballtraining, dreimal wöchentlich zusätzliches Athletik-Training, dazu die Spiele am Wochenende –, wurde ich für meine Bemühungen belohnt.
In der Schule versuche ich meinen Schülern genau das zu vermitteln: dass es sich immer rentiert, sich in eine Sache, die einem wichtig ist, richtig reinzuhängen. Selbst wenn man am Ende kein Bundesliga-Profi wird, Hauptsache, man hat alles für seinen Traum gegeben. In den meisten Fällen wird man irgendwann für seine Mühen belohnt.
Mir jedenfalls war das Glück ab diesem Zeitpunkt, an dem ich mich entschieden hatte, ihm ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, hold. Ich wurde eingeladen in die U18-Nationalmannschaft. Viele meiner Mitspieler in Leverkusen waren schon längst in den Jugendteams, U15, U16 und U17. Nur mich hatte noch nie jemand gefragt. Ich war bis dato ein guter Spieler, aber eben kein herausragender. Das änderte sich in diesem Sommer, ein Jahr, nachdem ich mit dem Zusatztraining angefangen hatte.
Ich war so aufgeregt! Die erste Reise mit der U18-Nationalmannschaft führte mich zum Spiel gegen die Auswahl aus Dänemark. In Rendsburg in Schleswig-Holstein sollte am 13. November 1985 das Qualifikationsspiel zur U18-Europameisterschaft in der Gruppe 5 stattfinden. Ein riesiges Paket inklusive eines offiziellen Briefes vom DFB wurde mir in den Tagen vor der Abreise per Post zugestellt. Alles komplett organisiert, als ob ich der Generalkonsul wäre, der zur Auslandsvisite fährt. Bahntickets, Ablaufplan, Beschreibungen – alles professionell auf DFB-Briefpapier gedruckt, dazu eine komplette Ausrüstung bestehend aus Turnschuhen, Laufschulen, Stollen- und Nockenschuhen (für sämtliche Beläge), mehrere Trainingsanzüge, Ausgehkleidung, Polos, Pullover – alles mit dabei! Wir waren die Elite des deutschen Fußballnachwuchses und ich war Teil des Teams! Mann, war ich stolz. Wir gewannen letztlich 3:1 gegen Dänemark und ich lief die ganze Woche mit den Klamotten vom DFB in der Schule herum.
Natürlich lag es nicht nur an mir selbst, dass ich mit einem Mal so große Karrieresprünge machte. Es gab einige wichtige Menschen, denen ich begegnete, die mir Türen öffneten oder mich auf besondere Art und Weise förderten, weil sie an mich glaubten. Michael Reschke, damaliger Trainer der U17- und U19-Mannschaften von Bayer Leverkusen, war so ein Typ. Heute ist er bei Bayern München, tütet die großen Transfers ein und kümmert sich um die Jugend. Von ihm habe ich viel gelernt, auch wenn ich ihn am Anfang für ziemlich durchgeknallt hielt.
Beim ersten Training kam es zum Eklat. Alles fing mit der viel zu kleinen Fußballhose an. Damals gab es noch keine einheitliche Kleidung im Training, jeder hatte an, was ihm gefiel und was ihm zur Verfügung stand, und wir bolzten und kickten einfach drauflos. Michael Reschke, der dem Treiben eine Weile vom Spielfeldrand aus zugesehen hatte, unterbrach plötzlich das Training und rief uns zusammen. Er war stocksauer. Denn er hatte bestimmte Vorstellungen von Fußball, die wir im Trainingsspiel nicht umgesetzt hatten. Reschke war außer sich und tobte. Für einen Perfektionisten war das, was wir ablieferten, schwer zu ertragen. Also musste er ein Exempel stationieren. Nur leider auf meine Kosten. Er schrie mich an: „Knut, du spielst wie ein Weichei!“ Er warf mir meine fehlende Aggressivität im Zweikampf vor und vielleicht auch meine viel zu kleine Fußballhose. „Geh dich umziehen!“, befahl er und schickte mich in die Kabine.
Auf dem Weg nach Hause weinte ich fürchterlich und verstand die Welt nicht mehr. Vor der nächsten Trainingseinheit (zu der ich überhaupt nur deshalb ging, weil meine Eltern mit Engelszungen auf mich eingeredet hatten) machte Reschke mir in einem persönlichen Gespräch klar, welche Möglichkeiten und Fähigkeiten in mir steckten und wie ich sie erreichen könne.
Klar, seine Schule war hart. Aber Lehrjahre sind keine Herrenjahre und andere Spieler hatten ähnliche Erlebnisse mit ihm. Unbestreitbar ist, dass wir in der Jugend bei ihm in guten Händen waren und viele Spieler den Weg in den bezahlten Fußball fanden und noch wichtige Titel gewannen. Auch mit Reschke selbst: Mit ihm als Trainer wurden wir in der A-Jugend Deutscher Vizemeister und 1986 sogar Deutscher Meister – ein wahnsinniger Erfolg für Bayer Leverkusen.
Es muss zu dieser Zeit gewesen sein, als mir dämmerte, dass ich nicht nur wie viele andere auch den Wunsch hatte, Profifußballer zu werden, sondern auch den nötigen Ehrgeiz und die Verfassung mitbrachte. Mir war zu jedem Zeitpunkt meiner Karriere bewusst, dass ich nicht der talentierteste Spieler auf dem Feld war. Aber ich wusste, dass ich meine Defizite sportlicher Natur mit meinem unbedingten Willen und einer riesigen Portion Durchhaltekraft wettmachen konnte. Ich war ein geradliniger und einfacher Fußballer, eher der Typ Arbeiter als der virtuose Zauberer am Ball. Im Orchester war ich nicht die erste Geige und nicht der beste Violinist, sondern der Trommler – also jemand, der den Takt vorgibt. Der die anderen vorantreiben und motivieren kann. In einer Mannschaft sind alle Positionen zu besetzen und gleichermaßen wichtig, nicht nur die des Spitzenstürmers. Daher hat es mir nie etwas ausgemacht, nicht der Star einer Mannschaft zu sein oder die attraktivste Position zu besetzen. Da, wo ich spielte, im Mittelfeld, war ich gut. Ich bekam Möglichkeiten und ich nutzte sie. Als Linksfuß war ich zudem eine Seltenheit.
In der Saison 1986/87 kam es bei Bayer Leverkusen in der A-Mannschaft aufgrund von Verletzungen und sportlicher Miseren zu einem Neuanfang. Teile der Mannschaft wurden ausgewechselt, einige neue Spieler dazugeholt – und prompt bekam ich die Chance, im Team der ersten Mannschaft, die in der Bundesliga spielte, mitzutrainieren. Mein Abitur stand unmittelbar bevor und ich konnte es kaum erwarten, endlich durchzustarten.
Natürlich wusste ich zu diesem Zeitpunkt schon, dass man als junger Spieler nicht nur aus Gefälligkeit zu einem Training der Profis eingeladen wird. Der Trainer braucht einen halbwegs vollständigen Kader, selbst in Übungseinheiten. Also ist es keine Seltenheit, dass Nachwuchsspieler dazugeholt werden, wenn Teile der eigentlichen Mannschaft ausfallen. So wie ich.
Ich erinnere mich gut daran, wie ich zu meinem ersten Training mit der ersten Mannschaft von Bayer Leverkusen anreiste: mit dem Mofa. Ich war ja erst siebzehn und hatte noch keinen Autoführerschein. Also knatterte ich mit meiner weißen Vespa Ciao zum Trainingsgelände und mischte mich unter die Großen.
Selbst wenn man nur das Team „auffüllt“: Zum Profitraining eingeladen zu werden, ist im Fußball eine große Sache. Man steht unter besonderer Beobachtung, wird an den Leistungen der echten Fußballspieler gemessen – das war damals so und das ist heute nicht anders. Ich wusste um die Bedeutung der Einladung. Also schraubte ich mir bei jedem Wetter die spitzesten Stollen unter die Schuhe und gab alles. Bei meinem ersten Training war ich natürlich total übermotiviert. Ich dachte: Die putz ich alle weg! Das war meine Gelegenheit, mich zu beweisen, und ich wollte mehr als hundert Prozent geben. Hundertfünfzig, ach was, zweihundert! Da ich am Morgen in der Schule gewesen war und nicht wie die anderen trainiert hatte, war ich voller Energie und scharrte mit den Hufen.
Heute kommen junge Spieler zu Vereinen, die sich in der Regel schon einen Namen gemacht haben – meistens sogar für astronomische Ablösesummen, bei denen den „Alten“ ganz schummrig wird. Oder sie kommen aus der eigenen Jugend und sind den Profis bereits bekannt. Früher aber war das eine richtige Hierarchie. Ich stieß als Greenhorn zur Mannschaft und war ein Niemand. Genau so wurde ich von den anderen auch behandelt, als wäre ich Luft – oder eine Art lebender Boxsack. Was bedeutet, dass ich ganz schön einstecken musste in den ersten Einheiten. Der Respekt, den ich gegenüber den erfahrenen Spielern empfand, machte die Sache eben nicht leichter. Noch vor ein paar Wochen hatte ich den Profis maximal die Bälle zuwerfen dürfen. Jetzt spielte ich mit ihnen zusammen. Ich wollte mich beweisen, wollte zeigen, was ich konnte – und hatte bei jedem Ball doch Angst, es richtig zu versauen. Also musste ich mich in Demut üben und zog in nicht nur einer der sportlichen Auseinandersetzungen den Kürzeren.
Erst als ich irgendwann den Mut aufbrachte, nicht nur einzustecken, sondern auch auszuteilen, gezielt in Zweikämpfe zu gehen und auch den gefeierten Stürmerstar beziehungsweise das eigene große Idol nicht zu schonen, lief es besser für mich. Denn auch die Profis haben einen harten Verteidiger, der die Grätsche beherrscht, lieber zum Freund als zum Feind.
Früher war es ganz normal, dass die Jungen nicht in der Kabine der Älteren waren, sondern eine eigene Umkleide hatten. Besser gesagt: eine Besenkammer. Die Großen hatten Cola-Automaten, eine HiFi-Anlage, einen eigenen Zeugwart und Massageliegen (die ich als Jüngster im Team übrigens immer tragen musste). Wir Jungen hatten nix und schleppten die Ballnetze. Das war der Deal. Ein bisschen wie bei der Bundeswehr, man musste sich eben hochdienen und erst den Respekt der Älteren verdienen. Wenn die aber merkten, dass man ein guter Fußballer war und der Mannschaft einen Dienst erwies, waren sie schnell freundlich. Immerhin ging es uns allen um das eine: möglichst guten Fußball zu zeigen.
Da ich das hierarchische Prinzip nicht anzweifelte, sondern dankbar über die Chance war, die man mir bot, haderte ich nicht mit meinem Schicksal, sondern tat all das, was man von mir erwartete, um so schnell wie möglich von meiner Mannschaft akzeptiert zu werden: Ich gab alles und war mir für nichts zu schade. Und ich wurde für meinen Einsatz belohnt. Erst kam ich einmal ins Training, dann die Woche drauf wieder und schließlich durfte ich regelmäßig dabei sein und wurde tatsächlich ein vollwertiges Mitglied der Mannschaft.
Wie unglaublich das alles war, bemerkte ich noch einmal sehr eindrücklich, als ich zu meinem ersten Bundesliga-Spiel eingeladen wurde. Am Vormittag des 18. April 1986 war ich in der Schule und hatte mich wieder einmal mit Sachen herumgeschlagen, die mich nicht die Bohne interessierten. Nach der Schule düste ich auf meinem Mofa zum Abschlusstraining, genau wie in den vergangenen Wochen auch. Mittlerweile fühlte ich mich nicht mehr wie der totale Außenseiter in der Mannschaft, sondern war leidlich akzeptiert bei den Profis. Zumindest aber wurde ich nicht mehr komplett ignoriert. Und dann, nach zwei Stunden auf dem Übungsplatz, meinte der damalige Trainer Erich Ribbeck zu mir: „Du fährst mit nach München. Ein Spieler hat sich beim Sprint heute Morgen einen Muskelfaserriss zugezogen und fällt verletzt aus. Wir haben für dich eine Sondergenehmigung beim DFB beantragt, da Jugendlichen eigentlich untersagt ist, in der Bundesliga zu spielen.“
Ich konnte es nicht fassen. Gegen Bayern München, im Olympiastadion. Am 32. Spieltag. Ich würde mich auf die Bank setzen dürfen? Für die erste Mannschaft? Berauscht und glücklich fuhr ich auf der Vespa nach Hause und packte schnell meine Sporttasche, um nur wenige Minuten später wieder auf mein Mofa zu steigen und zurück zum Stadion zu düsen. Kurz darauf würde es mit dem Mannschaftsbus zum Flughafen Köln-Bonn und von dort mit der Lufthansa nach München gehen.
Mein Herz schlug wild, als ich vor dem Tor des Stadions in Leverkusen anhielt und der Ordner aus seinem Häuschen trat.
„Wat willst du denn hier?“, fragte er wenig charmant. „Heut‘ is kein Spiel!“
„Doch, morgen in München. Und ich spiel vielleicht selbst“, sagte ich und platzte fast vor Stolz.
„Du?“ Der Ordner musterte mein Mofa, dann mich und ich konnte ihm deutlich ansehen, dass er mich für einen Aufschneider hielt, der einfach mal versuchte, es aufs Gelände zu schaffen. „Du hast doch ‚n Vogel.“
Ich grinste breit. „Nein, im Ernst. Ich bin morgen Teil der Mannschaft.“
Der Mann schüttelte den Kopf. „Dat glaubse doch selbst nich‘. Verzieh dich, Kleiner. Los, mach, dasse weggkomms‘!“
Da saß ich auf meinem Mofa. Fassungslos und auch ein wenig beleidigt. Vor allem aber: ratlos. Erich Ribbeck rechnete mit mir. Ich war im Kader der ersten Mannschaft von Bayer Leverkusen. Ich würde nach München fahren. Und vielleicht gegen die Bayern spielen. Und jetzt kam ich nicht mal aufs Gelände!
Das war’s, dachte ich. Es gab ja noch keine Mobiltelefone. Ich hätte den Trainer also gar nicht erreichen können. Wie sollte ich mich abmelden? Mit wachsender Verzweiflung sah ich mich um. Es musste doch irgendeine Möglichkeit geben. Und da sah ich sie und zwar in der recht beeindruckenden Statur von Manager Reiner Calmund, der aus einem der Stadioneingänge aufs Tor zugewackelt kam.
„Kalle, du kannst den Jungen reinlassen!“, rief er dem Ordner entgegen. „Der spielt vielleicht am Samstag.“
„Der da?“ Der Mann musterte mich erneut – diesmal jedoch mit etwas mehr Respekt, wie es mir vorkam. Dann zuckte er mit den Schultern und murmelte: „Also jut. Wenn der Ribbeck meint, dass dat ‚ne jute Idee is …“
Und ich war drin.
Allerdings würde ich noch einen hohen Preis dafür zahlen. Denn direkt im ersten Spiel (und ausgerechnet gegen die Bayern), bei dem ich übrigens so aufgeregt war wie selten vorher in meinem Leben, wurde mir gleich in meiner vierten Spielminute der Schneidezahn ausgeschlagen.
Es war in der zweiten Halbzeit, als Erich Ribbeck von seinem Platz aufstand, auf mich zulief und meinte: „Mach dich mal warm.“
Ich guckte nach links, nach rechts und fragte: „Wer, ich?“
Ribbeck nickte: „Jo.“
Und mein Herz fing wie verrückt an zu schlagen, beinahe so, als hätte ich neunzig Minuten Dauerlauf hinter mir. Leverkusens Minas Hantzidis war an der Mittellinie von Hansi Pflügler böse gefoult worden und musste verletzt vom Platz. Klar, das hatte ich mitbekommen. Aber dass der Trainer mich auswählte, um diesen Mann zu ersetzen … Uff!
Man hat mich mal gefragt, ob man in solch einem Moment weiß, was gerade auf dem Spiel steht. Wortwörtlich. In diesem Augenblick selbst, wenn einem der Trainer zu verstehen gibt, dass man sich warm machen soll, ist man so voller Adrenalin, ist so angespannt, dass man gar nicht mehr nachdenkt, sondern nur noch funktioniert. Hätte man all die Gedanken im Kopf, die in der Nacht vom Einschlafen abhalten, könnte man vermutlich nicht mal von der Bank aufstehen. Es hat schon viele hochgelobte Talente gegeben, die nach ein paar Einsätzen im Verein oder sogar in der Nationalmannschaft nie mehr gesehen wurden – einfach, weil sie dem Druck nicht gewachsen waren.
Nun war ich alles andere als ein hochgelobtes Supertalent, ich war genau genommen ein Nobody und durfte jetzt gegen die ganz Großen spielen. Das motiviert natürlich ungemein. Dennoch war mir klar, dass meine Premiere mit Argusaugen beobachtet werden würde. Ich müsste heute alles in die Waagschale werfen und um mein Leben laufen. Denn ich wollte keiner von denen werden, die wie ein Stern am Himmel aufsteigen, aber dann kometengleich auf die Erde zurasen.
Mit wackligen Beinen wärmte ich mich auf und dann war es tatsächlich so weit: Ich wurde eingewechselt. Leider machte ich nach nur wenigen Augenblicken auf dem Spielfeld die Bekanntschaft mit Klaus Augenthalers Ellenbogen. Den fuhr er in einem der ersten Zweikämpfe meiner Bundesliga-Karriere aus und knallte ihn mir gegen den vorderen Schneidezahn. Der prompt abbrach. Ich weiß heute gar nicht, ob ich den Schmerz überhaupt spürte, so euphorisiert war ich, dass ich spielen durfte. Deswegen kam es auch nicht infrage, dass ich mich auswechseln ließ oder aufhörte – ich war ja gerade erst aufs Feld gekommen. Also spielte ich weiter. Und wir konnten uns gegen die übermächtigen Bayern mit Spielern wie Matthäus, Brehme und Nachtweih mit einem 0:0 achtbar aus der Affäre ziehen.
Ich spielte nicht nur in dieser Partie, sondern auch in den folgenden beiden Pflichtspielen gegen Waldhof Mannheim und Blau-Weiß 90 Berlin. Wir gewannen zwei Spiele und spielten einmal unentschieden und schafften so die Qualifikation für den UEFA-Cup. Das allein machte mich schon wahnsinnig glücklich. Aber es kam noch besser. Als Belohnung für die Saisonleistung wurde das Team auf eine Reise nach Mauritius eingeladen. Eine Woche in einem richtig tollen Hotel mit allem Pipapo. Es war der Wahnsinn. Natürlich hatte ich schon mit meinen Eltern Urlaub gemacht und einige tolle Ziele in Europa und Übersee besucht. Aber in den Urlaub und noch dazu für lau? Wenn ich nicht schon längst mit dem Virus Fußball infiziert gewesen wäre, spätestens jetzt hätte ich mich für eine Karriere als Profi entschieden.
An einem Abend im Paradies lud man uns zum großen Bankett. Alle hatten sich herausgeputzt und saßen an einer langen Tafel, die Kellner schwirrten um uns herum, die Tische bogen sich unter den Leckereien – es war unglaublich. Natürlich floss auch der Alkohol in Strömen. Meine Teamkollegen tranken Bier, wie es sich für echte Rheinländer gehörte. Und was machte ich? Ich bestellte mir Rotwein. Auf Mauritius. Als der Servierwagen mit den verschiedenen Weinflaschen darauf klirrend in den Raum gerollt kam, blickten die anderen schon verwirrt auf. Als der Wagen jedoch vor mir, dem Jungspund, dem Grünschnabel, dem Nobody anhielt und der Kellner mich nach meinen Wünschen fragte, war die Sensation perfekt. Den anderen fielen fast die Augen aus dem Kopf. Die Spieler, der Trainer, alle guckten, was sich der Reinhardt da erlaubte.
Thomas Hörster, einer meiner Mitspieler, fragte über den Tisch hinweg: „Sag mal, Knut, was trinkst du denn da?“
Und ich antwortete: „Meine Mutter sagt: ‚In der Fremde immer ein Glas Wein trinken!‘“
Die anderen brüllten vor Lachen. Aber das war mir vollkommen egal.
Ich probierte mich durch die Rotweinauswahl und gab mir so richtig die Kante. Am nächsten Morgen rächte sich das, denn ich erwachte mit einem gigantischen Schädel. Anderthalb Liter Rotwein bei dreißig Grad Außentemperatur – ich hatte schon bessere Einfälle gehabt.
Die richtige Katerstimmung setzte sowieso erst ein paar Wochen später ein. Denn nach dem Urlaub marschierte ich zum Trainer und verlangte einen Profivertrag. Aber Ribbeck zuckte nur mit den Achseln und sagte: „Is nich.“
Ich war perplex. „Wieso nicht?“
„Es gibt eine neue Stallorder. Wir nehmen nur noch Leute mit Erfahrung unter Vertrag, keine Neulinge mehr.“
Mir klappte die Kinnlade auf die Brust. Was war denn das für ein Blödsinn? Da rackerte ich mich seit Jahren für den Verein ab, diente mich hoch, tat alles für die Mannschaft und dann wurde ich mit einer solchen Pauschalaussage abgebügelt?
Ich steckte in einer Zwickmühle. Mit der Schule war ich Gott sei Dank zu diesem Zeitpunkt fast fertig. Aber ich wollte unter keinen Umständen einen „normalen“ Beruf ergreifen, ich wollte Profifußballer werden. Außerdem hatte ich sehr viel Zeit auf der Reservebank abgesessen. Jetzt war ich bereit. Jetzt gab es nichts mehr, was mich aufhalten konnte! Wenn ich bei den Amateuren blieb, würde es schwer für mich werden, mal von dem leben zu können, was ich mit dem Kicken verdiente – ich wäre also gezwungen, eine Ausbildung zu machen oder ein Studium zu absolvieren, wenn ich es irgendwann mal auf einen grünen Zweig schaffen wollte.
Wie also konnte ich den Verein dazu bewegen, mich trotz der neuen Direktive unter Vertrag zu nehmen?
Ich war hin und her gerissen. Oberligist MSV Duisburg hatte sein Interesse an mir bekundet und die Avancen mit einem hübschen Honorar veredelt. Als Amateur bei Leverkusen standen mir monatlich etwa tausendfünfhundert Mark zur Verfügung. Duisburg war bereit, das Dreifache für meine Verpflichtung zu bezahlen. Das war natürlich sehr verlockend. Ich kam ja direkt von der Schulbank und hatte das Angebot, mit einem Schlag mehr als mein Vater zu verdienen. Ohne Ausbildung, Berufsabschluss und so weiter. Verrückte Welt.
Aber mit der Stadt Duisburg hatte ich meine Probleme. Denn dorthin ziehen wollte ich nicht. Und jeden Tag pendeln? Eine Dreiviertelstunde hin und eine weitere wieder zurück? Ich sagte ab und blieb für ein weiteres Jahr bei den Amateuren von Bayer Leverkusen, mit fünf Einsätzen und immerhin drei Toren in der Ersten Bundesliga.
Es war frustrierend. Da spielte ich einerseits in der deutschen U20-Nationalmannschaft, hatte immer wieder meine Momente in der Ersten Liga, wurde aber dazu verdonnert, mit Fußballern, die sich die Zeit bis zur Rente vertrieben und ihre Karriere ausklingen ließen, und Leuten, die tagsüber bei Bayer am Fließband arbeiteten, in der Oberliga vor mich hin zu kicken. Und dabei hatte ich mir doch so viel vorgenommen. Nach der Schule hatte ich richtig durchstarten wollen – und selbst das Abi hatte ich mit sehr viel gutem Zureden meiner Eltern hinter mich gebracht. So viele tolle Chancen mit der Nationalmannschaft hatte ich ausgeschlagen, um diese blöde Hochschulreife zu machen, und jetzt dümpelte ich in der Bedeutungslosigkeit herum und wartete darauf, dass das Leben so richtig losging.
Auch der Fußball selbst machte mir nicht mehr so viel Spaß. In der Oberliga ist das Niveau nicht schlecht, aber die anderen Spieler hatten so viel Routine, dass ich kaum eine Chance gegen sie hatte. Die erfahrenen Fußballer dribbelten mich aus, konnten Laufwege besser einschätzen und Flugkurven berechnen. Ich musste viel Lehrgeld zahlen in dieser Zeit und war oft frustriert. Ich war noch nicht reif genug, um zu erkennen, dass mir diese harte Lehrzeit noch sehr hilfreich für meine weitere Karriere sein würde.
Immerhin ging es mit meiner beruflichen Laufbahn voran – zumindest derjenigen, die mich nicht die Bohne interessierte. Direkt nach dem Abi war mir von Bayer nämlich, wie für die jungen Spieler der Mannschaft üblich, eine Stelle im Unternehmen angeboten worden. Natürlich hatte ich keine Lust, jemals als Bürokaufmann zu arbeiten. Aber das Angebot klang gut: Ich würde nicht oder nur sehr wenig im Büro arbeiten müssen, da ich ja die meiste Zeit auf dem Fußballplatz verbrachte. Es gab damals bei Bayer eine eigene Sportklasse mit Lehrern, die die Azubis unterrichteten und gezielt auf die Abschlussprüfung an der IHK vorbereiteten. An meinem trainingsfreien Montag besuchte ich diese Klasse, in der auch die Handballer, die Basketballer, die Leichtathleten und all die anderen Sportler noch einmal die Schulbank drückten. Immerhin musste ich nicht auch noch die Zeit im Büro ableisten. Bürokaufmann bin ich also streng genommen nur theoretischer Natur. De facto habe ich nie in diesem Beruf gearbeitet.
Es verwundert nicht, dass ich auch in dieser Abschlussprüfung keine Glanzleistung brachte. Ich schloss mit einer Drei vor der Industrie- und Handelskammer ab und hatte nun nach meinem Abitur eine abgeschlossene Berufsausbildung, sehr zur Freude meiner Eltern. Dafür hatte ich nicht viel mehr tun müssen, als zwei Jahre lang jeden Montag in der Berufsschule herumzusitzen und mich nicht allzu dumm anzustellen. Dennoch wusste ich vom ersten Tag an: Das willst du nicht. Vermutlich fiel mir das erste Jahr nach dem Abitur bei den Amateuren auch deswegen so schwer, weil ich eindrucksvoll erlebte, was die Alternativen zum Profifußballer sein würden – und dass ich definitiv keinen Plan B hatte.