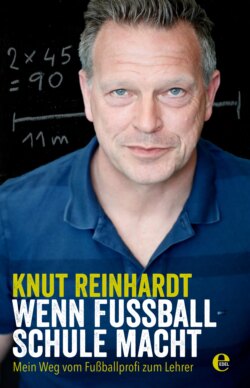Читать книгу Wenn Fußball Schule macht - Lisa Bitzer - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Am Anfang war der Ball
ОглавлениеAm 27. April 1968 wurde ich in Hilden geboren, einer Kleinstadt mit fünfzigtausend Einwohnern im Raum Düsseldorf. Ich wuchs in einer für damalige Verhältnisse sehr klassischen Familienstruktur auf. Mein Vater arbeitete im kaufmännischen Bereich in der Textilindustrie und machte sich später mit Schaumstofftechnik, Dämmmaterialien und Verkleidungen selbstständig. Meine Mutter war Hausfrau. Immer, wenn ich am Mittag aus der Schule oder am Abend vom Spielen nach Hause kam, stand das Essen auf dem Tisch. Uns mangelte es an nichts. Auch wenn wir nicht so wohlhabend waren, dass wir uns eine schicke Eigentumswohnung oder ein Häuschen mit Garten leisten konnten, war der Kühlschrank immer voll und in den Urlaub flogen wir auch einmal im Jahr.
Für meine größte Leidenschaft, den Fußball, war auch genug Geld da. Zum Beispiel für neue Stollenschuhe. Natürlich wollte ich nur die von Adidas haben, die mit den drei Streifen, die auch von den richtigen Fußballern getragen wurden. Aber ein Paar dieser Schuhe kostete sogar damals schon ein kleines Vermögen und mein Vater war der Meinung, dass mir auch die Modelle der günstigen Marke mit nur zwei Streifen gute Dienste tun würden. Also ging meine Mutter nebenbei putzen, um ein paar Mark extra zu verdienen, damit ich die Schuhe bekam, die ich mir so sehr wünschte. Das durfte mein Vater nicht merken – und so verrichtete meine Mutter ihren kleinen Nebenjob heimlich.
Dabei war mein Vater keineswegs geizig. Aber mein Hobby war nicht gerade günstig. Ständig brauchte ich neue Sachen, weil die alten Klamotten entweder kaputt oder zu klein waren. Als ich älter war, fuhr ich mehrmals im Jahr mit dem Verein ins Ausland, nach England, Frankreich, Amerika, in Trainingslager, zu Wettbewerben. Wenn man den Sport intensiv betreibt, kann Fußball ganz schön ins Geld gehen.
Und es gab ja nicht nur mich, sondern auch noch meine dreieinhalb Jahre jüngere Schwester Britta, die ebenfalls versorgt werden wollte. Im Gegensatz zu mir wünschte sie sich keine Sportoutfits oder Reisekostenzuschüsse, sondern ein Keyboard, denn Britta wollte eine Band gründen. Damals kostete ein Modell von Yamaha mit allem Schnickschnack rund dreitausend Mark. Und so einen Betrag zahlten meine Eltern nicht aus der Portokasse, dafür mussten sie sparen. Leider ist aus Brittas Musikkarriere nichts geworden. Sie klimperte ein paar Wochen auf dem Keyboard herum, dann wurde es in die Ecke gestellt und vergessen und meine Schwester wandte sich den bildenden Künsten zu. Zum Glück mit mehr Erfolg als auf dem Keyboard.
Britta und ich sind sehr unterschiedlich. Sie ist künstlerisch-musisch begabt, ich hingegen kriege nicht einmal einen geraden Strich hin. Dafür hat Britta rein sportlich betrachtet zwei linke Beine. Es kommt mir manchmal so vor, als wären die Talente bei den Reinhardts nicht gerecht auf beide Kinder verteilt worden, sondern alles Kreative vollständig auf Britta, alles Sportliche komplett auf mich ausgeschüttet.
Aber meine Schwester und mich unterscheiden nicht nur unsere Fähigkeiten und unsere Berufswahl. Nach einem Studium an der Kunsthochschule in Berlin arbeitet Britta mittlerweile als freie Künstlerin und ist dabei auch ziemlich erfolgreich. Ich habe so viel Ahnung von Kunst wie ein Schwein vom Ballett, doch es freut mich sehr, dass meine Schwester nach sicher nicht ganz leichten Jahren mittlerweile von ihrem Beruf leben kann.
Unser Verhältnis war nicht immer einfach. Ich setze mir große und kleine Ziele, die ich hartnäckig und mit Nachdruck verfolge, bis ich sie erreiche. Britta ist eine Träumerin, die immer lieber die Taube auf dem Dach als den Spatz in der Hand hat. Über viele Jahre, vor allem nachdem wir nicht mehr unter einem Dach bei meinen Eltern wohnten, fiel es Britta und mir nicht leicht, einen normalen geschwisterlichen Umgang miteinander zu pflegen, so wenig Verständnis hatten wir für die Art des anderen, das Leben zu meistern. Aber Familie sucht man sich nicht aus und glücklicherweise gelingt es uns mittlerweile besser, miteinander Zeit zu verbringen.
Ich bin von meiner Art her meiner Mutter sehr ähnlich, weshalb ich mich ihr immer sehr verbunden fühlte –
nicht nur, wenn sie mir heimlich die heiß begehrten Stollenschuhe kaufte. Damals verstand ich natürlich nicht, was meine Mutter für mich auf sich nahm – auch wenn ich es sehr zu schätzen wusste, dass ich endlich die Lieblingstreter an den Füßen hatte. Nicht nur aufgrund ihrer bedingungslosen Unterstützung war sie die wichtigste Vertrauensperson für mich, zu der ich bis heute ein sehr gutes und inniges Verhältnis habe. Auch wenn meine Frau Helena lästert, ich sei ein Mamasöhnchen, ist es mir doch wichtig, ein paarmal die Woche mit meiner Mutter zu telefonieren. Mein Vater arbeitete als offizieller Alleinverdiener viel und holte mich von Zeit zu Zeit vom Fußballtraining ab oder kam zu den Spielen mit. Aber meine Mutter war diejenige, der ich von meinen Sorgen und Nöten berichtete und die am meisten von mir mitbekam.
In die Grundschule ging ich immer gern, da gab es aber natürlich auch noch nicht so einen Druck wie später in der weiterführenden Schule. Ich war ein eher durchschnittlicher Schüler, denn ich hatte nur Fußball im Kopf. Einerseits wollte ich selbst einmal ein großer Kicker werden, andererseits fieberte ich bei jedem Spiel meines damaligen Lieblingsvereins mit, dem HSV. In den Siebziger- und Achtzigerjahren war der ja noch eine ziemlich große Nummer, galt zeitweise sogar als eine der besten Vereinsmannschaften der Welt und konnte zahlreiche Titel gewinnen: DFB-Pokal, Meisterschaften, 1983 gar den Europapokal der Landesmeister. Da wollte ich auch mal hin. Das war mein Ziel. Und ich hatte so viel Power! Deswegen waren meine Zensuren im Betragen, was es damals noch gab, auch nie besonders gut. Ich war aufmüpfig und testete gern meine Grenzen aus. Meine Energie konnte ich nur schwer kontrollieren – was für alle Beteiligten sicher nicht besonders angenehm war.
Auch später, als ich den Führerschein hatte, hatte ich (außer Fußball) nur Unsinn im Kopf. Ich war für jeden Quatsch zu haben, zum Beispiel am Morgen nach Paris fahren und am Abend wieder zurück und solche Sachen. Eine Portion Pommes kostete an der Seine zwar damals schon zwölf Mark, aber immerhin konnte ich danach behaupten, ich sei schon mal in Paris gewesen!
Der Unterricht in der Grundschule damals war klassisch, also frontal. Frau Günther hieß meine Lehrerin. Kurzhaarschnitt, gemusterter Schal, rote Ente – und einen für heutige Verhältnisse so langweiligen Unterrichtsstil, dass ich meistens einzuschlafen drohte. Einzig im Sport konnte ich mich richtig austoben, ansonsten saß ich in der Bank und langweilte mich zu Tode. Im Nachhinein weiß ich, dass ich ein anstrengender Schüler mit großem Potenzial war, dass die Lehrer meinem Temperament jedoch nicht gewachsen waren. Also wurde ich zum Klassenclown mit mittelmäßigen Zensuren und einer verdammt großen Klappe.
Meine Liebe zum Fußball ging damals schon so weit, dass ich als Sechsjähriger nichts anderes als mein Lieblings-T-Shirt anziehen wollte. Das war 1974, in dem Jahr, als Deutschland zum zweiten Mal Weltmeister wurde. Ich hatte ein hellblaues T-Shirt mit dem Kopf von Franz Beckenbauer vornedrauf. Das trug ich Tag und Nacht. Meine Mutter musste mich austricksen, wenn sie es in die Wäsche geben wollte. Von Zeit zu Zeit fragte sie mich: „Knut, was willst du mal werden, wenn du groß bist?“
Und ich rief, natürlich: „Beckenbauer!“
Mein erster Fußballverein war der TuS Quettingen in Leverkusen, den ich über zwei Freunde kennenlernte. Bis zum Alter von sechs Jahren hatte ich nur auf dem Bolzplatz gekickt, aber einer meiner Freunde nahm mich einfach mit zum Training und von diesem Tag an war ich dem Vereinssport hoffnungslos verfallen. Das hatte vor allem mit meinem ersten richtigen Torschuss zu tun. Schon als Knirps hatte ich nämlich einen ziemlich harten Schuss – so hart, dass das Tor, nachdem ich den Ball sauber getroffen und in eine Ecke gezimmert hatte, einfach umfiel. Heute vermute ich, dass das alte Ding komplett verrostet und instabil war. Aber damals fühlte ich mich wie der King. Dass ich quasi an meinem ersten Arbeitstag zum Kapitän der Mannschaft befördert wurde, machte die Sache natürlich noch besser. Der Ball war fortan mein ständiger Begleiter. Sogar beim Zähneputzen ließ ich ihn unter dem Waschbecken zwischen den Beinen hin und her rollen. Wenn wir umzogen, was zur damaligen Zeit nicht nur einmal vorkam, dauerte es in der Regel nur einen Tag, dann war die Lampe im Hof abgeschossen – und meistens war ich dafür verantwortlich.
Selbst die komplett verfärbten Trikots unseres Vereins konnten meiner Begeisterung keinen Abbruch tun. Denn wie es damals so üblich war, wuschen die Spielermütter reihum die Leibchen der gesamten Mannschaft – und je nach Haushalt fand mal eine rote Socke, mal eine Bluejeans den Weg mit in die Waschtrommel. Das sorgte dafür, dass unsere Trikots irgendwann nicht mehr grün-weiß, sondern kunterbunt waren. Aber das kümmerte uns herzlich wenig. Ich wäre vermutlich auch in einem Jutesack aufgelaufen. Hauptsache, ich durfte spielen.
Bis heute übt der Fußball einen enormen Reiz auf mich aus. Man kann so gut sein, wie man will, so viel trainiert und geübt, gedribbelt und gekickt haben, wie es geht: Am Ende ist jede Situation neu. Nie fällt der Ball im selben Winkel auf deinen Fuß, nie liegt er in derselben Position vor dir auf dem Rasen. Jeder Tritt ist anders, jeder Zustand neu, egal ob im Training unter Mannschaftskollegen oder im wichtigsten Spiel deiner Karriere im Champions-League-Finale. Auch höchstes Expertentum ist kein Garant dafür, dass du im entscheidenden Augenblick auf dem Platz das Richtige tust. Ich bin der Meinung, dass das Geheimnis dieses wunderbaren Sports genau in dieser Eigenschaft liegt, diesem Moment der Unberechenbarkeit. Nur so ist es zu erklären, dass Vereine, die im Vergleich zu den großen Namen beinahe bedeutungslos sind, urplötzlich den haushohen Favoriten aus dem Spiel kegeln, wie es der TSV Vestenbergsgreuth in der ersten Runde des DFB-Pokals 1994 eindrucksvoll gegen die Bayern unter Beweis stellte. Oder dass Mannschaften wie Werder Bremen nicht nur einmal, sondern gleich viermal das Unglaubliche schaffen: einen eigentlich uneinholbaren Rückstand innerhalb von wenigen Minuten aufholen, das Spiel am Ende sogar gewinnen und schon wieder für ein „Wunder von der Weser“ sorgen.
Was mich außerdem schon seit frühester Kindheit am Fußball fasziniert: Egal in welchem Land oder auf welchem Kontinent man ist, egal welche Sprache man spricht und aus welcher Kultur man stammt, Fußball verbindet. Ich war mit meinen Eltern in vielen Urlauben, in Italien, Kroatien, Marokko und immer hat es nur einen Ball und einen Schotterplatz gebraucht, um innerhalb kürzester Zeit Anschluss zu finden.
Schon während der Zeit in Quettingen zeigten alle Zeichen in Richtung Profikarriere. Einmal waren wir mit unserer kleinen Mannschaft auf einem großen Turnier eingeladen, das von Bayer Leverkusen veranstaltet wurde. Bayer Leverkusen! Das war der Himmel für uns, selbst wenn es natürlich nicht die Truppe der Ersten Bundesliga war, gegen die wir antraten, sondern die Kinder- und Jugendmannschaft. Auch der Nachwuchs von Gladbach und Schalke war bei dem Turnier anwesend, aber wir kleinen Pimpfe vom TuS Quettingen gingen am Ende tatsächlich als Sieger vom Platz. Wir schlugen sie alle. Da es in unserer Truppe fünf Jungs gab, die alle sehr gut kicken konnten (und zudem samt und sonders helles Haar hatten und bald die „Blondies“ genannt wurden), erregten wir das Interesse anderer Mannschaften – immerhin fegten wir die eigentlich besseren Teams vom Platz. Die Nachwuchsförderung steckte noch in den sprichwörtlichen Kinderschuhen. Es gab noch keine Spielervermittler, die schon Heranwachsende für Unsummen an große Vereine verkaufen. Man zog sich selbst die nächste Generation von Spielern groß.
Und so kam es, dass die fünf „Blondies“ ein Jahr später geschlossen zu Bayer Leverkusen wechselten – und ich war einer von ihnen. Das Niveau und die Förderung waren bei einem Verein dieses Formats natürlich viel höher als in Quettingen – wenn auch noch lange nicht so leistungsorientiert wie später in den Jugendmannschaften. Dreimal die Woche hatten wir Training, am Wochenende fanden Spiele statt. Die Ferien waren mit Trainingslagern gefüllt und endlich wurde auch die Ausstattung vom Verein gestellt und musste nicht mehr von den Müttern der Mannschaft daheim gewaschen werden. Was nicht nur den Trikots, sondern auch den Müttern guttat.
Nach der Grundschule wurde ich aufs Gymnasium geschickt, allerdings nur, weil damals (wie heute wieder) der Elternwille zählte. Das heißt, eigentlich wäre ich eher ein Fall für die Realschule gewesen, aber mein Vater legte gegen Frau Günthers Empfehlung Widerspruch ein. Auf dem Gymnasium war ich denn auch eher unterdurchschnittlich und hatte Mühe, nicht den Anschluss zu verlieren. Nicht, weil ich doof war, sondern weil ich mich wirklich nur für eines interessierte: Fußball.
Die Unterstufe überlebte ich irgendwie, doch ab der Pubertät wurde die Schule zu einem echten Problem für mich. Ich konnte nur an Fußball denken, etwas anderes gab es nicht. Meine Noten waren unterirdisch, weil der Sport immer wichtiger wurde und ich faul war wie nur was und beinahe hätte ich zu diesem Zeitpunkt meine bis dato eher schleppend verlaufende Schulkarriere ganz in den Sand gesetzt. Mit vierzehn, fünfzehn hätte ich die Schule am liebsten abgebrochen, um mich nur noch auf den Fußball zu konzentrieren. Tendenzen wie diese sind in dem Alter natürlich keine Seltenheit, was ich nicht zuletzt auch an der Einstellung meines Sohnes sehe, der gerade in dieser Phase ist und keinerlei Verständnis dafür hat, warum er Differentialgleichungen lösen und Fremdsprachen lernen sollte, anstatt auf einer frisch gemähten Wiese mit vollem Einsatz einem Ball hinterherzujagen.
Mir ging es damals ähnlich wie ihm heute. Nach der neunten Klasse stand meine Versetzung auf der Kippe – und die Stufe wiederholen zu müssen und noch ein Jahr länger auf der Schule zu bleiben, hätte für mich eine Katastrophe bedeutet. Also sagte ich der Lehrerin, in deren Fach ich wackelte, dass ich beabsichtige, nach dem Hauptschulabschluss (den man in Nordrhein-Westfalen mit dem erfolgreichen Abschließen der Jahrgangstufe neun von ganz allein bekommt) eine Lehre zu machen. Sie gab mir nicht die Fünf, die ich verdient hätte, sondern eine Vier und ich wurde versetzt – nur um gleich darauf die Schule zu wechseln. Vielleicht war ich nicht der schlauste Schüler, ganz sicher aber ein cleveres Kerlchen.
Ich kam auf eine weiterführende Schule, das Landrat-Lucas-Gymnasium in Leverkusen-Opladen, das heute die Sportelite von Bayer Leverkusen ausbildet und ein Teilinternat beherbergt. Damals, als ich dort Schüler war, war das Gymnasium mit dreitausend Schülern zwar riesig, aber nur eine Pilotschule ohne besondere Sportförderung. Das Einzugsgebiet war das gesamte Bergische Land, was bedeutet, dass die Elferklassen zum Beispiel bis zum Buchstaben N durchgezählt wurden. Also nicht wie vorher: „Ich gehe in die 11b!“, sondern plötzlich: „Der Stefan aus der 11m.“ Total verrückt und für mich die Möglichkeit, um in der Masse unterzugehen. Keiner nahm so richtig Notiz von mir, also konnte ich mich ganz entspannt weiter auf meine große Leidenschaft konzentrieren und Schule Schule sein lassen. In der Oberstufe suchte ich mir dann vor allem die Kurse und Lehrer heraus, von denen ich der Meinung war, dass sie leichter waren als der Rest. Ich wollte ja Fußballer werden – was brauchte ich da ein Einser-Abitur?
Mit siebzehn feierte ich meine Premiere in der Ersten Bundesliga gegen Bayern München. Spätestens ab diesem Zeitpunkt gab es für mich keine Alternative zur Profikarriere. Ich war angefixt! Ich war heiß. Ich wollte auf den Rasen und endlich mit den Großen spielen. Aber ich hatte meinen Eltern, vor allem meinem Vater, versprochen, dass ich das Abi machen würde. Immerhin ging meine Taktik in der Schule auf: Ich war nicht mehr so schlecht wie in der Mittelstufe, aber auch kein Anwärter auf den Posten des Klassenprimus. Dennoch, die allgemeine Hochschulreife war in greifbarer Nähe und das war mehr, als ich Jahre vorher hätte erwarten dürfen. Ich musste nur noch ein bisschen abwarten und dann im richtigen Augenblick zuschnappen. Dann dürfte ich endlich meine Fußballkarriere beginnen.
Ein Jahr vor dem Abitur, in der zwölften Klasse, wurde die Geduld meiner Eltern aber noch einmal auf eine harte Probe gestellt. Ich spielte damals schon für Bayer Leverkusen und bekam die Möglichkeit, mit der ersten Mannschaft für drei Wochen nach Südamerika zum Aspirin-Cup zu fahren. 125 Jahre Aspirin sollten gefeiert werden und zwar mit einem großen Fußballevent in Argentinien, Uruguay und Brasilien. Und ich war eingeladen mitzufahren. Doch die Schule wollte mich so kurz vor den Prüfungen nicht gehen lassen. Also tat ich das in meinen Augen einzig Richtige: Ich fuhr trotzdem, ohne mich offiziell abzumelden. Wenigstens meine Eltern wussten Bescheid. Da ich noch minderjährig war, brauchte ich ja ihre Einverständniserklärung, wenn ich mit nach Südamerika wollte. Sie knirschten zwar gut hörbar mit den Zähnen und befürchteten schlimme Konsequenzen für mein Abitur, erkannten aber auch, dass dieses Turnier eine große Chance für mich war. Also ließen sie mich fahren.
In einer riesigen Schule wie dem Landrat-Lucas-Gymnasium dauert es eine Weile, bis man als Schüler vermisst wird – besonders, wenn man die letzten Schuljahre hauptsächlich versucht hat, sich unsichtbar zu machen und irgendwie durchzumogeln. Durch das Kurssystem kann man außerdem fehlen, ohne dass es allzu schnell auffällt. Doch nachdem mich eine Woche lang kein Lehrer in der Schule gesehen hatte, wurde mein damaliger bester Freund gefragt: „Markus, wo ist eigentlich Knut?“ Und Markus antwortete: „Knut? Der liegt am Strand in Buenos Aires!“ Zugegeben, richtig schlau war die Antwort nicht. Aber ich hatte Markus auch nicht gut vorbereitet – denn ich hatte im Eifer des Gefechts und im Wusel der Reisevorbereitungen vergessen, ihm eine passende Antwort auf die erwartbare Frage einzutrichtern.
Als ich wiederkam, war die Kacke in der Pauke so richtig am Dampfen. Eine pädagogische Konferenz wurde einberufen, in der über mein Wohl und Wehe in der Schule entschieden werden sollte. Sowohl eine einfache Abmahnung als auch ein kompletter Schulverweis standen zur Debatte – und das wäre mein schulisches Ende gewesen, das wusste ich und das wussten meine Eltern. Ich wartete schon seit Jahren so sehnsüchtig darauf, endlich mit dem Fußball durchstarten zu können. Einen Rückschlag und ein oder zwei weitere Schuljahre hätte ich nicht hingenommen.
Es kam aber weder zur Abmahnung noch zum Schulverweis. Stattdessen gaben mir all meine Lehrer mündlich eine Sechs. Da die Epochalnoten damals die Hälfte zur Gesamtnote zählten, kam das in meinem Zeugnis einer Bankrotterklärung gleich, denn ich hatte durch meine dreiwöchige Abwesenheit so viele schlechte Zensuren gesammelt, wie ich mir eigentlich nur in der ganzen Oberstufe hätte leisten dürfen. Meine Lehrer waren der Meinung, dass sie damit die größtmögliche Strafe über mich verhängt hätten, denn mein Kontingent an schlechten Noten war aufgebraucht und vor mir lag noch ein sehr langes dreizehntes Schuljahr, das mit den Abiturprüfungen endete. Eigentlich die perfekte Retourkutsche, um mir ein unentschuldigtes Fehlen heimzuzahlen und mir aufzuzeigen, wer am Ende am längeren Hebel sitzt.
Alle gingen damals davon aus, dass ich die Klassenstufe wiederholen würde. Mit diesen schlechten Noten war es fast nicht mehr möglich, die Hochschulreife zu erlangen. Vor allem, wenn man ein so mäßiger Schüler wie ich war. Und als ob das alles noch nicht schlimm genug wäre, marschierte mein Vater nach der pädagogischen Konferenz zu einem meiner Lehrer und sagte: „Sie sind ja nur sauer, weil mein Sohn irgendwann einmal mehr verdient als Sie!“ Vielleicht nicht der klügste Schachzug in einer ohnehin recht ausweglosen Situation.
Aber es kam alles anders als gedacht. Ich wiederholte die zwölfte Klasse nicht, sondern entschied mich dafür, mich endlich auf den Hosenboden zu setzen und mich auf das Abitur zu konzentrieren. Ich wollte raus aus der Schule – und noch ein Jahr länger hätte ich nicht durchgehalten. Also sagte ich schweren Herzens die Europameisterschaft in Jugoslawien ab, für die ich in der Mannschaft der U18 nominiert war und so lange trainiert hatte. Ich gab dem Trainer einen Korb, weil ich mein Abitur machen wollte. Oder besser: musste.
Meine Eltern, vor allem mein Vater, hatten mir klargemacht, dass ich ohne eine anständige Schulausbildung im Leben keine echte Chance bekommen würde. Als Siebzehnjähriger denkt man selbstverständlich nicht so weit. Ich hangelte mich gedanklich von Training zu Training, von Spiel zu Spiel und von Saison zu Saison, aber das große Ganze konnte ich damals noch nicht überblicken. Dass es nicht mehr lange dauern würde, bis ich als Profi in der Ersten oder Zweiten Bundesliga durchstarten konnte, hatte ich zu diesem Zeitpunkt natürlich längst begriffen. Immerhin verdiente ich bereits sechshundertfünfzig Mark im Monat durch meine Vereinstätigkeit bei Bayer. Sechshundertfünfzig Mark! Ein Kaffee im Schulkiosk kostete damals fünfzig Pfennige. Ich war der reichste Schüler der Schule und mir war bewusst, dass das erst der Anfang war.
Für dieses Geld musste ich fünfmal die Woche trainieren, am Wochenende wurde gespielt und die Ferien verbrachte ich im Ausland bei Wettbewerben oder im Trainingslager. Fußball war allgegenwärtig. Am Rande nahm ich wahr, dass es so etwas wie eine weibliche Spezies gab, aber bei denen hatte ich sowieso keinen Erfolg. Ich galt als uncool und hatte nicht unbedingt den Ruf, ein Aufreißer zu sein. Denn wenn ich nicht im Training war, guckte ich mir die Fußballspiele der Großen an und träumte von meiner Karriere. Ich rauchte und trank nicht, weil meine Gesundheit mein Kapital war. Für die Mädchen, für die ich mich interessiert hätte, war ich ein Langweiler, der sein ganzes Leben auf den Fußball ausrichtete und wenig Platz im allzu engen Terminplan für alternative Freizeitbeschäftigung hatte. Am Wochenende musste ich um halb zehn zu Hause sein – nicht von meinen Eltern, sondern vom Verein aus. Die riefen zuweilen sogar daheim bei uns an, um zu kontrollieren, dass wir uns nicht mehr herumtrieben. Damals, ohne Handys, ging das ja auch noch. Das Telefon klingelte und wenn mein Vater oder meine Mutter rangingen, mussten sie mich an den Hörer holen, damit sich der Trainer persönlich davon überzeugen konnte, dass ich nicht zu nachtschlafender Zeit durch die Straßen zog.
Heute, im Zeitalter der mobilen Kommunikation, würde das nicht mehr funktionieren. Aber heute ist ohnehin vieles anders. Die jungen Spieler werden emotional und psychisch viel umfangreicher auf ein Leben in der Öffentlichkeit vorbereitet. Sie wissen, worauf sie sich einlassen, sind vertraut mit den Gepflogenheiten der Presse und nur selten passiert ihnen ein echter Lapsus, der dann zur Schlagzeile wird. Ein Ausbruch aus dem Trainingslager von Malente, wie ihn Breitner, Beckenbauer und Konsorten während der WM 1974 vollzogen, wäre heute nicht denkbar. Manchmal bedaure ich, dass es nur noch so wenige Revoluzzer im Fußball gibt. Kein Effenberg, der den Mittelfinger zeigt. Kein Matthäus, der mit legendären Zitaten in die Geschichte eingeht. Die Jungs von heute werden ab ihrer frühsten Kindheit auf ein Leben im Rampenlicht vorbereitet. Sie sind konzentriert, diszipliniert und routiniert, selbst wenn sie erst achtzehn oder neunzehn Jahre alt sind. Ein Zlatan Ibrahimovic fällt mit seinem flegelhaften Benehmen da sofort auf wie ein bunter Hund.
Ich war in diesem Alter noch nicht so „erwachsen“ wie die meisten Nachwuchsspieler heute. Und ich interessierte mich auch nicht besonders für mein Leben nach dem Fußball. Ich hatte ja noch nicht einmal mit meiner richtigen Karriere begonnen.
Dennoch bin ich kein Hitzkopf, der unbedingt seinen Willen durchsetzen will, sondern ein Mensch, der seine Ziele mit Disziplin und Leidenschaft verfolgt, wenn er sie einmal definiert hat. Nach dem Aspirin-Cup in Südamerika, bei dem mich meine Eltern so unterstützt hatten, hatte ich das Gefühl, ihnen etwas schuldig zu sein. Sie hatten mich fahren lassen, obwohl sie es nicht guthießen, dass ich für den Wettbewerb drei Wochen lang die Schule schwänzte und mein Abitur ernsthaft in Gefahr brachte. Nun lag es an mir, ihnen zu beweisen, dass sie mir nicht umsonst vertraut hatten.
Das kommende Jahr war wirklich hart für mich. Nicht nur auf die U18-Europameisterschaft musste ich verzichten, auch auf Berti Vogts als Trainer der U21. Doch meine Mühen waren nicht umsonst. Wider alle Erwartungen gelang es mir, das Abitur zu bestehen. Natürlich nur haarscharf. Für die Zulassung zu den eigentlichen Prüfungen waren mindestens einhundert Punkte vonnöten – und ich ging mit hundertsechs ins Rennen. Es war wirklich mehr als knapp. Aber es ging zu diesem Zeitpunkt nicht mehr darum, eine Medaille zu gewinnen, sondern irgendwie einen Haken unter dieses leidige Kapitel zu setzen.
Dass ich dann doch kein katastrophales, sondern sogar ein ganz passables Abitur schaffte, hing vor allem damit zusammen, dass zu dieser Zeit die Prüfungen in den Hauptfächern viel mehr gewertet wurden als der Weg dorthin. Heute wird den Noten, die man im Verlauf der Oberstufe macht, eine größere Bedeutung beigemessen. Das heißt, selbst wenn man eine schriftliche Abiturarbeit komplett versaut, kann man am Ende einen guten Schnitt haben. Zu meiner Zeit war das anders, da zählten die Arbeiten viel mehr – zu meinem Glück. Denn überraschenderweise war ich in allen drei Abschlussarbeiten nicht so schlecht, wie man es aufgrund meiner restlichen Zensuren hätte vermuten dürfen. Möglicherweise habe ich schon damals gezeigt, dass ich das Talent besitze, mich dann, wenn es darauf ankommt, zu hundert Prozent zu fokussieren und mich von keinen Nebenschauplätzen ablenken zu lassen. Im Fußball ist das eine wichtige Eigenschaft, aber auch für die Schule hat es sich für mich ausgezahlt, mich auf den Punkt konzentrieren und mein Wissen abrufen zu können.
Mit viel Glück bestand ich also das Abitur. Heute bin ich froh, dass mich mein Vater dazu gedrängt hat, bis zum Ende durchzuhalten, denn ohne seine Hartnäckigkeit wäre ich bestimmt ohne Abschluss von der Schule abgegangen und dann hätte sich mein Leben ein paar Jahre später mit Sicherheit in eine ganz andere Richtung entwickelt. Als Jugendlicher denkt man in der Regel nicht weiter, als man spucken kann. Irgendwann mal erwachsen sein und für seinen Unterhalt sorgen? Niemals habe ich mir deswegen den Kopf zerbrochen. Das kommt erst, wenn man einmal angefangen hat zu arbeiten, wenn man Verantwortung übertragen bekommt, für sich und für andere, vielleicht sogar eigene Kinder. Dann begreift man irgendwann, dass nichts so wichtig ist wie eine solide Grundlage – ganz egal, ob es um Schulbildung oder um Sport geht.
Ich war so erleichtert, als ich endlich „durch“ war mit den Prüfungen, musste aber bis zum Ende zittern. Und während meine Schulkameraden den Lehrern bereits vor dem Verkünden der Ergebnisse die Kennzeichen von den Autos schraubten oder sich mit Edding-Stiften auf der Karosserie der Pauker verewigten, hatte ich nur eines im Kopf: Abi bestehen – und dann ab auf den Rasen.